FACHBEREICH PHYSIK BERGISCHE UNIVERSITÄT GESAMTHOCHSCHULE WUPPERTAL
Nukleonenzerfall und
Neutrinoeigenschaften in einem
Massenmodell auf der
Grundlage einer
-Grand Unified-Theorie
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften
am Fachbereich Physik der Bergischen Universität
Gesamthochschule Wuppertal
vorgelegt von
Carsten Merten
WUB-DIS 99-14
Dezember 1999
FACHBEREICH PHYSIK BERGISCHE UNIVERSITÄT GESAMTHOCHSCHULE WUPPERTAL
Nukleonenzerfall und
Neutrinoeigenschaften in einem
Massenmodell auf der
Grundlage einer
-Grand Unified-Theorie
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften
am Fachbereich Physik der Bergischen Universität
Gesamthochschule Wuppertal
vorgelegt von
Carsten Merten
WUB-DIS 99-14
Dezember 1999
Wo Du das Nichts erblickst, ist eine Kraft,
Verborgen, unerreichbar allem Bösen,
Die aus sich selbst – sich und die Welt erschafft.
Und die vermag’s, das Rätsel aufzulösen.
Michael Ende, Das Gauklermärchen
Abstract
The Standard Model (SM) of elementary particle physics is a very successful theory. Its predictions have been tested experimentally to a high level of accuracy. However, the SM is not considered to be a fundamental theory of nature. It contains a lot of arbitrary parameters especially in the fermionic sector and it cannot give small neutrino masses which are indicated by recent experiments like Super-Kamiokande.
Grand Unified Theories (GUTs) can solve several weaknesses of the SM. They unify the SM interactions and lead to relations between the quark and lepton mass matrices, thus reducing the arbitrariness in the fermionic sector. Furthermore, GUT models with an intermediate symmetry breaking scale are able to produce small neutrino masses by means of the see-saw mechanism. All GUTs include baryon and lepton number violating interactions which mediate proton and bound neutron decay.
In this work a mass model based on a GUT with a global family symmetry is discussed which leads to an asymmetric Nearest Neighbour Interaction structure for the fermionic mass matrices. As a result of the analysis one gets three solutions of the model which include several large left- and right-handed fermion mixings. Those mixings are not observable in the SM where only the CKM quark mixing matrix can be measured, but they have testable effects on the branching ratios of nucleon decays in theories beyond the SM. One finds that decay channels with in the final state are suppressed while channels with and are enhanced compared to models with small mixings. The total nucleon lifetimes obtained should be observable by future experiments. The model also predicts the masses and mixings of the light neutrinos. They are in the right range to explain the anomalies of solar and atmospheric neutrinos by means of oscillations, preferring the small angle MSW solution for the solar neutrino deficit.
Einleitung
Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist eine äußerst erfolgreiche Theorie. Es beschreibt auf konsistente Weise die starke, schwache und elektromagnetische Wechselwirkung, und seine Vorhersagen sind experimentell mit großer Genauigkeit bestätigt worden. Nach der Entdeckung des top-Quarks steht lediglich der Nachweis des Higgs-Bosons, dessen Existenz von der Theorie gefordert wird, noch aus.
Es gibt jedoch verschiedene Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, daß das Standardmodell keine wirklich fundamentale Theorie darstellt, sondern vielmehr als effektive Niederenergie-Näherung einer solchen den heute experimentell zugänglichen Energiebereich beschreibt. So sind die Neutrinos im Rahmen des Standardmodells masselose Teilchen, während die Evidenz für nichtverschwindende Neutrinomassen durch Experimente wie Super-Kamiokande in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Auch die beobachtete Baryonasymmetrie des Universums läßt sich nicht befriedigend erklären.
Eine weitere formale Schwäche des Standardmodells besteht in der großen Zahl freier Parameter, welche durch die Theorie nicht festgelegt sind, sondern an experimentelle Ergebnisse angepaßt werden müssen. Es gibt 18 solcher Parameter, von denen allein 13 im Fermionsektor liegen; dies sind die Fermionmassen und die Quarkmischungen. Abgesehen davon liefert das Standardmodell keine wirkliche Vereinheitlichung der drei Wechselwirkungen, da die zugehörigen Kopplungskonstanten völlig unabhängig voneinander sind.
Um diese Schwachpunkte zumindest teilweise beseitigen zu können, ist eine Reihe von Versuchen gemacht worden, das Standardmodell in eine umfassendere Theorie einzubetten. Viele von ihnen liefern jedoch kaum Vorhersagen, welche in naher Zukunft experimentell verifiziert werden können. Einen in dieser Hinsicht vielversprechenden Ansatz liefern die sogenannten Grand Unified-Theorien, deren Grundidee darin besteht, die drei Kräfte des Standardmodells in einer einzigen Wechselwirkung zu vereinheitlichen. Formal geschieht das durch die Konstruktion einer Eichtheorie mit einfacher Symmetriegruppe, welche die Standardmodell-Symmetriegruppe als Untergruppe enthält. Motivation hierfür ist in erster Linie die Tatsache, daß die skalenabhängigen Kopplungen des Standardmodells sich bei sehr großen Energien von GeV näherungsweise in einem Punkt treffen. Mittels spontaner Symmetriebrechung erhält man aus der Grand Unified-Theorie als effektive Näherung bei niedrigen Energien wieder das Standardmodell.
Die wohl bemerkenswerteste Vorhersage von Grand Unified-Theorien besteht in der Instabilität des Protons und des gebundenen Neutrons aufgrund von baryon- und leptonzahlverletzenden Wechselwirkungen. Einerseits sind Zerfälle von Nukleonen bisher nicht beobachtet worden, andererseits ist die relevante Wechselwirkung in Grand Unified-Theorien wegen der großen Masse der zugehörigen Eichbosonen bei niedrigen Energien auch überaus schwach. Die einfachste der Grand Unified-Theorien, welche auf der Gruppe beruht, ist experimentell ausgeschlossen worden, da sie unter anderem zu kurze Lebensdauern für die Nukleonen liefert. Modelle auf der Grundlage der wie das hier untersuchte besitzen diesen Mangel nicht.
Da sich die laufenden Standardmodell-Kopplungen nicht exakt in einem Punkt treffen, ist eine direkte Vereinheitlichung der drei Wechselwirkungen nicht möglich; es muß eine zusätzliche intermediäre Symmetrie vorhanden sein. Die Skala, bei welcher diese Symmetrie in das Standardmodell gebrochen wird, liegt üblicherweise im Bereich GeV und hat somit die richtige Größenordnung, damit über den See-Saw-Mechanismus sehr kleine, aber nichtverschwindende Neutrinomassen erzeugt werden können. Weitere Vorzüge von Grand Unified-Theorien sind Beziehungen zwischen den Massenmatrizen der Quarks und der Leptonen. Infolgedessen können durch Kenntnis der Massenmatrizen der geladenen Fermionen Vorhersagen für die Neutrinomassen und -mischungen gewonnen werden. Weiterhin kann im Rahmen von -Modellen mit intermediärer Massenskala und schweren Majorana-Neutrinos die Baryonasymmetrie des Universums erklärt werden.
Ein anderer Versuch, den Fermionsektor des Standardmodells besser zu verstehen, besteht in der Untersuchung von phänomenologisch motivierten Ansätzen für die Massenmatrizen der Fermionen. Diese Ansätze zeichnen sich durch Symmetrieanforderungen oder sogenannte Texturen, das heißt Nullen als Matrixeinträge an bestimmten Stellen, aus. Auf die zugrundeliegende Theorie jenseits des Standardmodells, welche den Ansatz realisiert, wird im allgemeinen nicht weiter eingegangen. Damit will man die Zahl der freien Parameter des Standardmodells reduzieren und Beziehungen zwischen Massen und Mischungen erhalten.
Schließlich kann man beide Zugänge kombinieren und Massenmodelle auf der Grundlage von Grand Unified-Theorien konstruieren. Das eröffnet die Möglichkeit, die Vorzüge dieser Theorien gegenüber dem Standardmodell auszunutzen und die Ansätze wegen der gegebenen Beziehungen zwischen den Fermionmassenmatrizen weniger willkürlich zu machen. Ferner haben in solchen Modellen alle Fermionmischungen Einfluß auf zumindest prinzipiell observable Größen wie Nukleonzerfallsraten, während im Standardmodell lediglich eine bestimmte Kombination der linkshändigen Quarkmischungen, die CKM-Matrix, beobachtbar ist. Daraus folgen überprüfbare Konsequenzen, an denen man den Erfolg des Ansatzes messen kann.
Gegenstand dieser Arbeit wird ein Massenmodell im Rahmen einer -Theorie sein. Es wird ein asymmetrischer „Nearest Neighbour Interaction“-Ansatz für die Massenmatrizen der Fermionen benutzt, welcher durch eine globale -Familiensymmetrie realisiert wird. Dieser Ansatz führt auf voneinander unabhängige rechts- und linkshändige Mischungen und bietet ausdrücklich die Möglichkeit, daß diese betragsmäßig groß sind. In vielen Massenmodellen werden große Mischungen im Bereich der geladenen Fermionen mit dem Hinweis auf die relativ kleinen CKM-Mischungen der Quarks außer Acht gelassen. In der Tat besitzen alle gefundenen Lösungen des untersuchten Modells mehrere große Mischungen, was zu Verzweigungsraten der Nukleonen führt, die sich von denen im Fall verschwindender Mischungen deutlich unterscheiden. Zusätzlich sind die erhaltenen Neutrinoeigenschaften, welche ebenfalls Modellvorhersagen darstellen, in der Lage, die Anomalien der Sonnen- und atmosphärischen Neutrinos durch Oszillationslösungen zu erklären.
In den letzten Jahren hat sich die Forschungstätigkeit hauptsächlich auf supersymmetrische Grand Unified-Theorien, welche spontan in das minimale supersymmetrische Standardmodell gebrochen werden, beschränkt. Wird die Supersymmetrie, eine Symmetrie zwischen Fermionen und Bosonen, bei vergleichsweise niedrigen Energien von TeV effektiv gebrochen, so treffen sich die Kopplungskonstanten des supersymmetrische Standardmodells bei etwa GeV genau in einem Punkt. Da die Massen der Superpartner dann nicht sehr viel größer als die der gewöhnlichen Teilchen sind, bietet sich die Möglichkeit, das Divergenzverhalten der Theorie zu verbessern und das Hierarchieproblem zu lösen. Allerdings läßt die Abwesenheit von experimentellen Hinweisen auf eine bei kleinen Energien gebrochene Supersymmetrie in der Natur ein solches Szenario zunehmend unwahrscheinlicher erscheinen. Auch eine für die Erzeugung von Neutrinomassen über den See-Saw-Mechanismus erforderliche intermediäre Massenskala läßt sich in supersymmetrischen Grand Unified-Theorien nicht auf natürliche Weise realisieren. Desweiteren sind supersymmetrische Modelle in ihrer Vorhersagekraft durch den Einfluß zahlreicher unbekannter Größen, wie zum Beispiel die Massen der Superpartner, stark eingeschränkt. Deshalb wird hier der Standpunkt vertreten, daß Modelle ohne Supersymmetrie weiter untersucht werden sollten. Dies schließt eine Brechung der Supersymmetrie bei sehr hohen Energien keineswegs aus.
Im ersten Kapitel wird zunächst ein Überblick über die Grundkonzepte und wichtigsten Eigenschaften des Standardmodells gegeben, auch dessen Grenzen werden genauer betrachtet. Kapitel 2 behandelt den Themenkomplex der Grand Unified-Theorien. Nach einer Schilderung der grundlegenden Ideen und der allgemeinen Vorgehensweise bei der Konstruktion solcher Modelle werden die als Prototyp der Grand Unified-Theorien und die als das dieser Arbeit zugrundeliegende Beispiel ausführlich diskutiert; desweiteren wird auf Vor- und Nachteile der Modelle eingegangen. Gegenstand des dritten Kapitels sind die theoretischen Grundlagen und der experimentelle Status von Neutrino-Oszillationen. Die drei bis heute beobachteten Neutrino-Anomalien und ihre möglichen Oszillationslösungen durch massive Neutrinos werden vorgestellt. Kapitel 4 beginnt mit vorbereitenden Arbeiten wie der Bestimmung der Symmetriebrechungsskalen und Kopplungen. Mittelpunkt des Kapitels ist der Ansatz für das betrachtete -Massenmodell und dessen numerische Lösung. Als ein wichtiges Resultat erhält man daraus Voraussagen über die Eigenschaften im Neutrinosektor der Theorie, welche sich als phänomenologisch sinnvoll erweisen. In Kapitel 5 schließlich werden für die analysierten Lösungen die partiellen und totalen Zerfallsraten der Nukleonen berechnet. Diese stellen eine wesentliche und in absehbarer Zeit experimentell überprüfbare Vorhersage des untersuchten Modells dar.
Ziel und Motivation dieser Untersuchung lassen sich abschließend mit den einleitenden Worten aus [1] sehr treffend zusammenfassen:
„The Standard Model is unlikely to be a fundamental theory; it contains 18 arbitrary parameters, 13 of which are the fermion masses and mixing angles. In a fundamental theory, these should be calculable from a few inputs just as the hydrogen spectral lines follow from Quantum Mechanics. We are very far from such a theory of fermion masses. We would be fortunate to have an analogue of Balmer’s formula since it might lead us to the fundamental theory. The framework described here is, at best, an attempt to obtain such a formula.“
Kapitel 1 Das Standardmodell
1.1 Grundkonzepte des Standardmodells
Das Standardmodell (SM) der Elementarteilchenphysik [2] ist eine renormierbare Eichtheorie, welche die Theorie der starken Wechselwirkung, die Quantenchromodynamik (QCD), und das Glashow-Weinberg-Salam-Modell der elektroschwachen Wechselwirkung zusammenfaßt. Es basiert auf der Invarianz unter lokalen -Eichtransformationen; die Symmetriegruppe ist ein direktes Produkt aus drei Faktoren.
Die QCD [3] beruht auf der Eichgruppe und beschreibt die Wechselwirkung von Teilchen mit Farbladung, den Quarks und Gluonen. Die Quarks sind die fermionischen Grundbausteine der stark wechselwirkenden Materie und treten in drei verschiedenen Farbzuständen auf. Unter -Transformationen verhalten sie sich wie die Fundamentaldarstellung . In der Natur werden allerdings nur farbneutrale Kombinationen von drei Quarks (Baryonen) bzw. Quark und Antiquark (Mesonen) beobachtet; dieses Phänomen wird als Confinement bezeichnet. Die Gluonen sind die mit den acht Generatoren der verbundenen Vektorbosonen und transformieren sich gemäß der adjungierten Darstellung. Durch den Austausch von Gluonen wird die starke Wechselwirkung zwischen den Quarks vermittelt.
Die Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung [4] besitzt eine -Eichsymmetrie, die durch den Higgs-Mechanismus spontan in die der Quantenelektrodynamik (QED) gebrochen ist. Eine Grundeigenschaft dieses Modells ist die Paritätsverletzung, da das Transformationsverhalten der Fermionen von deren Chiralität abhängt. Man zerlegt die durch Dirac-Spinoren dargestellten Fermionfelder gemäß
| (1.1) |
in ihre links- und rechtshändigen Komponenten, sogenannte Weyl-Spinoren. Die linkshändigen Quarks und Leptonen sind in -Doubletts angeordnet, während die rechtshändigen Fermionen Singuletts bilden und an der schwachen Wechselwirkung nicht teilnehmen.
Die elektrische Ladung der Teilchen ergibt sich aus ihrer Hyperladung und der Komponente des schwachen Isospins ( mit sind die Generatoren der -Lie-Algebra) aus der Beziehung
| (1.2) |
In Erweiterungen des SM erweist es sich aus gruppentheoretischen Gründen als sinnvoll, statt der rechtshändigen Teilchen die linkhändigen Komponenten der Antiteilchen zu betrachten. Die Antiteilchen erhält man durch die Anwendung der Ladungskonjugation
| (1.3) |
Weiterhin gelten die Identitäten
| (1.4) |
Die Fermionen treten im SM in drei Familien mit jeweils gleichen Quantenzahlen auf. Jede dieser Familien transformiert sich nach der Darstellung
| (1.5) |
der SM-Symmetriegruppe . Der erste Eintrag bezeichnet hierbei die -Darstellung, der zweite die -Darstellung und der Index die -Hyperladungsquantenzahl (die komplex konjugierte Darstellung wird durch einen Querstrich gekennzeichnet). In Tabelle 1.1 ist der fermionische Teilcheninhalt des SM aufgeführt.
| Quarks | Leptonen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| , , | , , | ||||
| , , | |||||
| , , | , , |
Es ist zu beachten, daß im Fermionspektrum des SM keine rechtshändigen Neutrinos vorkommen, da diese sich aufgrund ihrer Farb- und Ladungsneutralität nach der -Darstellung transformieren würden, also an keiner SM-Wechselwirkung teilnähmen. Dies steht im Einklang mit der Tatsache, daß rechtshändige Neutrinos und linkshändige Antineutrinos in Experimenten nicht beobachtet werden.
Die Eichbosonen, die als Austauschteilchen die Wechselwirkung vermitteln, transformieren sich stets wie die adjungierte Darstellung der Symmetriegruppe, im Falle des SM also gemäß . Die Kopplungsstärken der SM-Eichbosonen an die fermionischen Ströme werden mit , und bezeichnet. Ferner besitzen Eichbosonen in Modellen mit nichtabelscher Symmetriegruppe auch eine Selbstwechselwirkung. In Erweiterungen des SM durch Grand Unified-Theorien (GUTs) wird statt im allgemeinen mit gearbeitet, da die korrekte Normierung besitzt. Die Eigenschaften der SM-Eichbosonen sind in Tabelle 1.2 zusammengefaßt.
| Bezeichnung | Spin | Kopplung | |
|---|---|---|---|
| Gluonen [] | 1 | ||
| -Bosonen [] | 1 | ||
| -Boson [] | 1 |
1.2 Renormierung und laufende Kopplungen
Ein wichtiges Kriterium für die formale Konsistenz einer Eichtheorie ist ihre Renormierbarkeit. Dies bedeutet, daß bei der Berechnung von physikalischen Prozessen in höheren Ordnungen der Störungstheorie nur endlich viele qualitativ verschiedene Divergenzen auftreten. Diese können dann durch eine Redefinition der Modellparameter wie Kopplungen und Massen absorbiert werden [5].
Die Unendlichkeiten treten in Form von divergenten Impulsintegralen auf. Durch Anwendung eines Regularisierungsverfahrens werden die Integrale durch Ausdrücke ersetzt, die von einem neuen Parameter, dem Regularisierungsparameter, abhängen, und für einen bestimmten Wert desselben wieder die ursprüngliche Gestalt annehmen. Bei der dimensionalen Regularisierung zum Beispiel werden die Integrale statt in vier in Impulsraumdimensionen gelöst; die Divergenzen gehen dann in Terme über. Im anschließenden Renormierungsprozeß werden die divergenten Parameter in der Lagrangedichte durch Einführung von Renormierungskonstanten , welche die -Terme aufnehmen, in die endlichen renormierten Größen umgewandelt: .
Im Rahmen der Regularisierung wird aus formalen Gründen zwangsläufig eine freie Massenskala in die Theorie eingeführt. Sowohl die Renormierungskonstanten als auch die renormierten Größen hängen von dieser Skala ab; man spricht von laufenden Größen. Die funktionalen Zusammenhänge, welche die Skalenabhängigkeit der renormierten Größen beschreiben, werden als Renormierungsgruppengleichungen bezeichnet [6]. Sie sind immer dann von Bedeutung, wenn physikalische Größen bei verschiedenen Massen- bzw. Energieskalen miteinander verglichen werden. Die in dieser Arbeit verwendeten Renormierungsgruppengleichungen sind in Anhang B angegeben. Die Energieabhängigkeit observabler Größen ist experimentell bestätigt; so hat die Kopplungsstärke der QED bei den Betrag 1/137, bei ist sie etwa 1/129 groß [7].
Die Renormierbarkeit einer Eichtheorie kann durch das Auftreten von Anomalien zerstört werden. Anomalien sind Symmetrien der klassischen Lagrangedichte, die durch den Prozeß der Quantisierung gebrochen werden [8]. In Modellen mit chiralen Fermionen äußert sich dies durch das Auftreten von linear divergenten Strahlungskorrekturen in Form von fermionischen Dreiecksdiagrammen mit einer ungeraden Anzahl axialer Vertizes . Die Divergenzen verletzen die Slavnov-Taylor-Identitäten, deren Gültigkeit für die vollständige Renormierung der Theorie in allen Ordnungen der Störungsrechnung benötigt wird. Diese Beiträge sind im wesentlichen proportional zu
| (1.6) |
wobei die die Generatoren der zur Symmetriegruppe gehörenden Lie-Algebra sind, und zwar in der Darstellung, nach der sich die links- beziehungsweise rechtshändigen Fermionen transformieren [9, 10]. Die Renormierbarkeit ist demnach sichergestellt, wenn
| (1.7) |
gilt. Im Rahmen des SM führt (1.7) auf die vier Bedingungen
| (1.8) | |||||
Die beiden oberen Gleichungen sind aufgrund der Spurfreiheit der -Generatoren automatisch erfüllt, die unteren beiden wegen der SM-Zuordnung der Hyperladungen in (1.5). Das SM ist also deshalb anomaliefrei, weil sich die Beiträge der Quarks und der Leptonen gerade aufheben.
1.3 Symmetriebrechung und Massenerzeugung
In Eichtheorien können prinzipiell zwei Arten von Massentermen vorkommen. Wenn ein Dirac-Spinor ist und seine links- und rechtshändigen Komponenten bezeichnet, so hat der Dirac-Massenterm die Gestalt (h.c. steht für hermitesch konjugiert)
| (1.9) |
Das ist derselbe Massenterm, der auch in der Dirac-Gleichung vorkommt. Unter Verwendung von (1.4) kann man auch als schreiben.
Desweiteren existieren die lorentzinvarianten Größen
| (1.10) | |||||
| (1.11) |
die man als Majorana-Massenterme bezeichnet, da sie nur für Majorana-Teilchen definiert sind. Letztere werden durch Spinoren beschrieben, für welche gilt, das heißt Teilchen und Antiteilchen sind identisch. Deswegen sind Majorana-Teilchen zwangsläufig elektrisch neutral. Majorana-Massenterme werden später im Zusammenhang mit Neutrinomassen von Bedeutung sein.
Das Transformationsverhalten von Massentermen für die geladenen Fermionen im SM sieht folgendermaßen aus:
| (1.12) | |||||
| (1.13) | |||||
| (1.14) |
Die Lagrangedichte des SM kann demnach keine Fermionmassenterme enthalten, da diese nicht invariant unter -Transformationen sind. Das steht aber im Widerspruch zu der experimentellen Beobachtung massiver Teilchen.
Abgesehen davon wird in der Natur keineswegs die Symmetrie des SM, sondern eine -Symmetrie beobachtet.
Beide Probleme können durch die spontane Brechung lokaler Eichsymmetrien, den sogenannten Higgs-Mechanismus, gelöst werden [11]. Dazu werden dem Teilchenspektrum der Eichtheorie Spin-0-Teilchen hinzugefügt. Im SM wird ein Doublett
| (1.15) |
dieser Higgs-Bosonen eingeführt, wobei und komplexe Skalarfelder sind; sie liegen in der -Darstellung . Das Potential für hat die Form
| (1.16) |
und erzeugt für einen nichtverschwindenden Vakuumerwartungswert
| (1.17) |
von . Den Wert von kann man in niedrigster Ordnung aus der meßbaren Fermi-Konstanten und der Beziehung bestimmen; er beträgt GeV. Nun ist der Vakuumzustand nicht mehr -symmetrisch; die Symmetrie der elektroschwachen Wechselwirkung wird spontan in die der QED gebrochen:
| (1.18) |
Durch ihre Wechselwirkung mit den Higgs-Teilchen erhalten die Eichbosonen Massenterme. Aus den vier -Bosonen entstehen so die physikalischen Eichbosonen, das heißt die Masseneigenzustände
| (1.19) | |||||
| (1.20) | |||||
| (1.21) |
ist der Weinberg-Winkel; für ihn gilt
| (1.22) |
ist das Eichboson der , das masselose Photon. Seine Kopplungskonstante, die Elementarladung , ergibt sich aus . Die - und -Bosonen erhalten die Massen
| (1.23) |
während die Gluonen masselos bleiben, da die Higgs-Teilchen farbneutral sind. Tabelle 1.3 enthält die Werte für die Massen und den Weinberg-Winkel:
| Größe | |||
|---|---|---|---|
| Wert | GeV | GeV |
Die experimentell meßbaren Eichkopplungen der -Theorie haben bei der Skala folgende Werte ( und ):
| Größe | ||
|---|---|---|
| Wert |
Daraus kann man mit Hilfe der Beziehungen
| (1.24) |
die Werte der SM-Größen berechnen:
| Größe | ||
|---|---|---|
| Wert |
Von den vier reellen Freiheitsgraden in ist nur einer physikalisch, er gehört zum elektrisch neutralen Higgs-Boson . Es ist das einzige SM-Teilchen, das experimentell noch nicht nachgewiesen wurde. Für seine Masse gibt es lediglich eine Untergrenze: GeV [12].
Die Fermionmassen werden durch Einführung von Yukawa-Kopplungen zwischen den Fermionen und den Higgs-Teilchen realisiert. Diese Yukawa-Terme können wegen (1.12)-(1.14) und eichinvariant konstruiert werden und haben die Form
| (1.25) |
mit
| (1.26) |
Die Indizes und bezeichnen die Fermionfamilien ( für ), die Elemente der (33)-Matrizen sind die Yukawa-Kopplungen. Die Fermionmassen entstehen im Rahmen der spontanen Symmetriebrechung, wenn seinen Vakuumerwartungswert ausbildet. Dann sind die Massenmatrizen durch
| (1.27) |
gegeben; (1.25) geht über in
| (1.28) |
Da die Massenmatrizen beliebige komplexe (33)-Matrizen sein können, sind die Fermionen in Tabelle 1.1, die Eigenzustände der -Wechselwirkung, im allgemeinen nicht mehr mit den physikalischen Teilchen definierter Masse identisch. Letztere erhält man, wenn man die Massenmatrizen durch biunitäre Transformationen diagonalisiert:
| (1.29) |
Die nichtverschwindenden Elemente der Diagonalmatrizen sind die Fermionmassen; ihre Werte sind in Tabelle 1.6 aufgelistet.
| Größe: | |||
|---|---|---|---|
| Wert: | MeV | MeV | MeV |
| Größe: | |||
| Wert: | MeV | GeV | GeV |
| Größe: | |||
| Wert: | keV | MeV | MeV |
Die Yukawa-Kopplungen sind ebenso wie die Eichkopplungen renormierte Größen und hängen somit von der Massenskala ab. Über (1.27) und (1.29) sind demnach auch die Fermionmassen und -mischungen skalenabhängig.
Die Transformationen (1.29) liefern den Zusammenhang zwischen den Eigenzuständen der SM-Wechselwirkungen, hier mit dem Index bezeichnet, und den Masseneigenzuständen:
| (1.30) |
Nun ist (1.30) auch in den übrigen Termen der Langrangedichte auszuführen, in denen Fermionfelder vorkommen. Während die neutralen Ströme, die an das -Boson und das Photon koppeln, invariant unter (1.30) sind, ändern sich die geladenen schwachen Ströme:
| (1.31) | |||||
| (1.32) |
Im Experiment tritt nur die (unitäre) Kombination der Mischungsmatrizen in Erscheinung; man nennt sie Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-Matrix (CKM-Matrix) [14]. Alle anderen Mischungen, insbesondere die rechtshändigen, sind im SM nicht observabel. Die experimentellen Grenzen für die Beträge der Elemente von liegen bei [7]:
| (1.33) |
Die in dieser Arbeit verwendete Parametrisierung für lautet:
| (1.34) |
mit und . Als numerische Werte für die Winkel werden , und benutzt. Ferner wird gewählt, da ein Modell mit reellen Massenmatrizen (und somit orthogonalen Mischungsmatrizen) Gegenstand der Untersuchung ist; auf das Problem der -Verletzung soll hier nicht näher eingegangen werden. Die Parametrisierung (1.34) mit wird auch für alle Mischungsmatrizen in (1.29) benutzt.
Die leptonischen Anteile der geladenen schwachen Ströme ändern sich im Falle masseloser Neutrinos nicht, da die linkshändigen Neutrinos derselben Transformation wie die geladenen Leptonen unterzogen werden können.
1.4 Grenzen des Standardmodells
Das SM ist nicht nur mathematisch konsistent, sondern auch phänomenologisch überaus erfolgreich. Viele seiner Vorhersagen sind auf eindrucksvolle Weise experimentell bestätigt worden, zum Beispiel die Existenz der dritten Fermiongeneration, der massiven - und -Bosonen und des neutralen schwachen Stroms. Lediglich die beobachtete Baryonasymmetrie des Universums [15] und die durch die Neutrinoexperimente der letzten Jahre implizierte Existenz massiver Neutrinos [16] lassen sich im Rahmen des SM nicht befriedigend erklären. Davon abgesehen ist die Übereinstimmung der theoretischen Vorhersagen des SM mit den experimentellen Ergebnissen sehr gut [17].
Es gibt allerdings auch eine Reihe von ungeklärten theoretischen Fragestellungen, die stark darauf hindeuten, daß das SM keine wirklich fundamentale Theorie ist, sondern lediglich die effektive Näherung einer solchen für niedrige Energien.
Zunächst ist die Zahl der freien Parameter im SM, deren Werte von der Theorie nicht vorhergesagt werden, sondern an experimentelle Resultate angepaßt werden müssen, sehr groß:
-
•
neun Massen der geladenen Fermionen
-
•
drei Winkel und eine Phase in der CKM-Matrix
-
•
drei Eichkopplungen
-
•
die Higgs-Masse und -kopplungskonstante
-
•
zwei -Parameter in den -verletzenden Lagrangedichte-Termen
Unter Berücksichtigung massiver Neutrinos kommen drei Neutrinomassen sowie drei Winkel und drei Phasen in der leptonischen Mischungsmatrix hinzu. Eine grundlegende Theorie sollte dagegen mit möglichst wenigen freien Parametern auskommen.
Weitere Aspekte, die auf eine Theorie jenseits des SM schließen lassen, sind:
-
•
Die Symmetriegruppe ist ein direktes Produkt, woraus die Existenz dreier voneinander unabhängiger und betragsmäßig stark unterschiedlicher Kopplungskonstanten folgt; eine Vereinheitlichung der Wechselwirkungen erfolgt nicht. Ebenfalls damit verbunden ist die komplizierte Darstellung (1.5), in der die Fermionen einer Familie liegen.
- •
-
•
Die bis heute beobachteten Fermionen liegen in drei Familien, die hinsichtlich ihrer Quantenzahlen und ihrer Wechselwirkungen völlig identisch sind, sich aber bezüglich ihrer Massen beträchtlich unterscheiden.
-
•
Der Hauptgrund für die Einordnung der linkshändigen Fermionen in -Doubletts und der rechtshändigen in Singuletts liegt im phänomenologischen Erfolg dieses Ansatzes.
-
•
Neutrinomassen können im Rahmen des SM zwar durch Einführung von nichtwechselwirkenden rechtshändigen Neutrinos konstruiert werden, aber es stellt sich dann die Frage, warum ihre Massen sehr viel kleiner als die der geladenen Fermionen sein sollten.
-
•
Der Higgs-Sektor des SM ist, sowohl was die Anzahl der Higgs-Teilchen als auch die Einordnung in Darstellungen von angeht, weitgehend willkürlich. Auch die Selbstkopplung sowie die Yukawa-Kopplungen und Massen der Higgs-Teilchen sind nicht festgelegt.
-
•
Der QCD--Parameter ist extrem klein, . Dies folgt direkt aus den experimentellen Grenzen für das Dipolmoment des Neutrons.
-
•
Die durch Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie beschriebene Gravitation läßt sich im Gegensatz zu den restlichen Wechselwirkungen nicht allein mit dem Prinzip der lokalen Eichinvarianz erklären. Alle bisher entwickelten Eichtheorien der Gravitation haben sich als nichtrenormierbar erwiesen.
Zahlreiche Modifikationen des minimalen SM sind konstruiert worden, um einzelne dieser Schwächen zu beheben. So kann das Problem der -Verletzung in der QCD durch ein Modell mit zwei Higgs-Doubletts und einer zusätzlichen chiralen -Symmetrie gelöst werden [18], während Modelle mit sogenannten horizontalen Symmetrien versuchen, die Massenhierarchie zwischen den Fermionfamilien zu erklären [19].
Im Gegensatz dazu gehen die Grand Unified-Theorien (GUTs), die im nächsten Kapitel diskutiert werden, über eine bloße Erweiterung des SM hinaus. Es wird vielmehr der Versuch gemacht, das SM in eine umfassendere Theorie einzubetten. GUTs können einige, wenn auch nicht alle, der oben erwähnten Schwächen beseitigen und zum besseren Verständnis des SM beitragen.
Kapitel 2 Grand Unified-Theorien
2.1 Grundidee und allgemeine Eigenschaften
Das Hauptziel bei der Konstruktion von Grand Unified-Theorien (GUTs) [20, 21] besteht darin, die drei qualitativ und quantitativ verschiedenen Wechselwirkungen des SM in einer einzigen zu vereinheitlichen. Formal geschieht dies durch die Einbettung der SM-Symmetriegruppe in eine einfache Lie-Gruppe . Diese neue Theorie soll das SM als effektive Niederenergienäherung enthalten, was durch spontane Symmetriebrechung in einem oder auch mehreren Schritten erreicht werden kann.
Motiviert wird dieser Ansatz in erster Linie durch die Skalenabhängigkeit der Eichkopplungen im SM [22]. Integriert man die Renormierungsgruppengleichungen (B.7-B.9) für die drei Größen [23] von der Skala zu höheren Energien, erhält man das in Abbildung 2.1 gezeigte Verhalten.
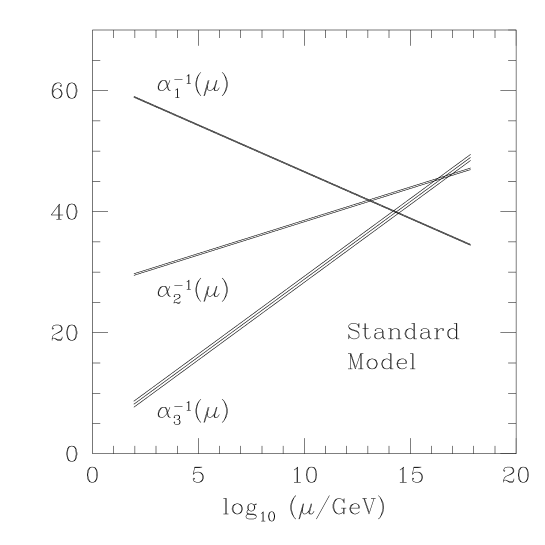
Die laufenden Kopplungen treffen sich näherungsweise im Bereich - und . Daß sie sich jedoch nachweislich nicht in einem Punkt kreuzen, ist erst seit der Inbetriebnahme des Teilchenbeschleunigers LEP am CERN 1989 und der damit verbundenen Steigerung der Meßwertgenauigkeit für bekannt [24].
Der erste Schritt bei der Konstruktion eines GUT-Modells besteht in der Wahl einer kompakten und einfachen Lie-Gruppe . Man kann prinzipiell auch halbeinfache Lie-Gruppen, also direkte Produkte von einfachen Gruppen, verwenden, erhält dann aber für jeden Faktor eine separate Kopplungskonstante. Damit diese Kopplungen gleich sind und eine Vereinheitlichung zustande kommt, müssen zusätzliche Symmetrien eingeführt werden. Deshalb sind einfache Gruppen vorzuziehen, da man auf diese Weise eine Wechselwirkung mit genau einer Kopplung erhält; die SM-Wechselwirkungen sind dann verschiedene Aspekte dieser Kraft.
Die einfachen Lie-Gruppen beziehungsweise -algebren sind vollständig klassifiziert und ihre Eigenschaften und die ihrer Darstellungen bekannt [25, 26]; Tabelle 2.1 gibt eine Übersicht.
| Algebra | Rang | Ordnung | Dim(f) |
|---|---|---|---|
| , | |||
| , | |||
| , | |||
| , | |||
| 2 | 14 | 7 | |
| 4 | 52 | 26 | |
| 6 | 78 | 27 | |
| 7 | 133 | 56 | |
| 8 | 248 | 248 |
Es gibt neben den vier unendlichen Reihen der klassischen Lie-Gruppen die fünf exzeptionellen Gruppen. Der Rang ist gleich der maximalen Anzahl miteinander kommutierender Generatoren, die Ordnung ist die Gesamtzahl der Generatoren und somit die Dimension der adjungierten Darstellung, und Dim(f) gibt die Dimension der Fundamentaldarstellung an.
Um eine geeignete Symmetriegruppe zu finden, sollte diese einer Reihe von Anforderungen genügen:
-
•
Zunächst muß die SM-Symmetriegruppe als Untergruppe enthalten. Da der Rang von gleich 4 ist, muß auch mindestens vom Rang 4 sein. Andererseits ist die Forderung nach der Minimalität des Ranges der Eichgruppe sicher sinnvoll, da mit dem Rang auch die Dimension der Darstellungen und somit der Umfang des Teilchenspektrums zunimmt.
-
•
Die Gruppe sollte komplexe Darstellungen besitzen [28] (eine Darstellung heißt komplex, wenn sie zu ihrer komplex konjugierten Darstellung nicht äquivalent ist; ansonsten wird sie als reell bezeichnet). Diese Forderung ist aus folgendem Grund plausibel:
Sei die Darstellung, nach der sich die links- beziehungsweise rechtshändigen Teilchen und Antiteilchen einer Fermionfamilie transformieren. Dann gilt wegen die Beziehung . Im SM ist die entsprechende Darstellung (1.5) komplex, was die Paritätsverletzung und die Nichtexistenz -invarianter Massenterme zur Folge hat. Um im Rahmen eines GUT-Modells eine reelle Darstellung verwenden zu können, müssen in ihr neben den SM-Fermionen zusätzlich linkshändige Fermionen liegen, die sich wie das komplex konjugierte von (1.5) transformieren. Diese neuen Teilchen werden auch als Spiegelfermionen bezeichnet. Da sie in der Natur jedoch nicht beobachtet werden, müssen ihre Massen während des Symmetriebrechungsschrittes entstehen, der auf das SM führt, was aufgrund von Mischungen wiederum superschwere Massen auch für die SM-Fermionen zur Folge hat. Dieses Problem läßt sich auf einfache Weise durch Verwendung komplexer Darstellungen für die Fermionen vermeiden. Von den einfachen Lie-Gruppen enthalten jedoch nur
(2.1) komplexe Darstellungen [29], was die Wahlmöglichkeiten für stark einschränkt.
-
•
Damit die Renormierbarkeit der Theorie sichergestellt ist, muß sie anomaliefrei sein, also (1.7) erfüllen. Während die orthogonalen Gruppen (außer ) [9] und [30] automatisch anomaliefrei sind, gilt dies bei den -Gruppen nur für bestimmte Kombinationen irreduzibler Darstellungen [31]. Im einfachsten Fall, der hier von Interesse ist, nämlich , ist die (komplexe) Summe
(2.2) anomaliefrei.
Berücksichtigt man bei der Wahl von diese Kriterien, so verbleiben folgende Möglichkeiten mit 4 Rang() 6:
| (2.3) |
Auf , und basierende GUTs werden in den nächsten Abschnitten behandelt; - und -Theorien bieten gegenüber diesen Modellen keinerlei Vorteile, sind aber in einigen Punkten wesentlich unhandlicher und deswegen weitgehend unbeachtet geblieben.
Hat man auf diese Weise eine Wahl für die Eichgruppe getroffen, so sind noch folgende Schritte durchzuführen:
-
•
Die Einbettung von in und das Schema
(2.4) für die Symmetriebrechung in das SM sind anzugeben. Der einfachste Fall, die direkte Symmetriebrechung , kommt allerdings wegen der Tatsache, daß die laufenden SM-Kopplungen sich nicht in einem Punkt treffen (siehe Abbildung 2.1), nicht in Frage.
-
•
Für jeden Symmetriebrechungsschritt in (2.4) müssen geeignete Higgs-Darstellungen festgelegt und zugehörige Potentiale konstruiert werden, welche ihn realisieren können. Dabei ist darauf zu achten, daß die Teilchen des SM nach wie vor erst im letzten Schritt bei ihre Massen erhalten, während alle zusätzlichen Teilchen sehr viel schwerer sind und deshalb mindestens Massen der Größenordnung haben. Dieser Sachverhalt wird auch als „Survival Hypothesis“ [32] bezeichnet.
-
•
Die komplexe und anomaliefreie Darstellung, in der die Fermionen liegen sollen, ist auszuwählen. Hierbei muß die Zerlegung der Fermiondarstellung unter die Zuordnung der korrekten SM-Quantenzahlen gestatten, das heißt die SM-Darstellung (1.5) enthalten.
Ist das geschehen, so ist die formale Konstruktion der GUT abgeschlossen. Die expliziten Eigenschaften und Vorhersagen des Modells, wie zum Beispiel Vereinheitlichungsmasse und -kopplung , Fermionmassenrelationen oder die Rate des Protonzerfalls und daraus eventuell resultierende Widersprüche zu experimentellen Resultaten sind dann im Detail zu untersuchen.
2.2
2.2.1 Konstruktion und Teilcheninhalt
Die -GUT [33] stellt gewissermaßen den Prototyp dieser Theorien dar. Wie oben gezeigt wurde, ist sie die einzige für die Konstruktion einer GUT in Frage kommende Gruppe mit Rang()=4. Da die SM-Eichgruppe eine maximale Untergruppe der ist, kann nur die direkte Symmetriebrechung
| (2.5) |
erfolgen, was wegen des durch Abbildung 2.1 verdeutlichten SM-Kopplungsverhaltens für eine realistische Theorie nicht in Frage kommt. Dennoch sollen hier kurz die grundlegenden Eigenschaften der -GUT zusammengefaßt werden, da sie sich zum großen Teil zumindest qualitativ auch auf andere GUT-Modelle übertragen lassen.
Betrachtet man die Verzweigungen der beiden -Darstellungen und unter
| (2.6) |
stellt man fest, daß die reduzible Darstellung gerade alle SM-Fermionen einer Familie aufnehmen kann (siehe Tabelle 1.1). Ferner ist sie komplex und anomaliefrei, erfüllt also alle notwendigen Bedingungen. Die gemeinsame Einbettung von Quarks und Leptonen in dieselbe irreduzible Darstellung ist eine Eigenschaft aller GUTs und führt, da die Eichtransformationen diese Teilchen miteinander mischen können, zur Verletzung der Baryon- und Leptonzahlerhaltung.
An dieser Stelle wird ein wesentlicher Erfolg von GUTs deutlich, nämlich die Erklärung für die Quantisierung der elektrischen Ladung. Sie gehört zu den allgemeinen Eigenschaften von Eichtheorien mit einfacher Symmetriegruppe, da die Eigenwerte der diagonalen Generatoren solcher Gruppen im Gegensatz zu den Eigenwerten der abelschen stets diskret sind. Der Ladungsoperator muß in der Cartan-Unteralgebra von liegen, also eine Linearkombination der diagonalen Generatoren sein. Da die Generatoren spurfrei sind, gilt dies auch für . Daraus folgt wiederum, daß die Summe der Ladungen der in den Darstellungen und liegenden Fermionen jeweils 0 sein muß: und . Quarks haben deshalb drittelzahlige Ladungen, weil sie in drei Farben auftreten, während Leptonen farbneutral sind.
Betrachtet man als Untergruppe von , sind die Hyperladungswerte in Tabelle 1.1 mit einem Faktor umzunormieren. Wegen (1.22), und gilt in GUTs mit einfacher Symmetriegruppe stets ; der Weinbergwinkel ist kein freier Parameter mehr. Der experimentelle Wert muß durch Integration der entsprechenden Renormierungsgruppengleichungen reproduziert werden.
Die adjungierte Darstellung, nach der sich in Eichtheorien die Eichbosonen transformieren, verzweigt sich bezüglich gemäß
| (2.7) |
Die ersten drei Summanden entsprechen den SM-Eichbosonen, während die Darstellungen und neue Bosonen enthalten, die mit und beziehungsweise und bezeichnet werden. Da diese experimentell nicht beobachtet werden, müssen sie Massen der Größenordnung haben.
2.2.2 Protonzerfall
Die - und -Bosonen, welche die elektrischen Ladungen +4/3 und +1/3 besitzen, tragen sowohl eine Farbladung als auch schwachen Isospin und können deshalb Quarks und Leptonen ineinander überführen. Während Baryon- und Leptonzahl globale -Symmetrien des (perturbativen) SM sind, werden sie in der -Theorie wie auch in allen anderen GUTs verletzt; allerdings bleibt erhalten. Die direkte Konsequenz der Baryonzahlverletzung ist die Instabilität von Proton und (gebundenem) Neutron. Der Nukleonenzerfall ist eine wichtige und experimentell überprüfbare Vorhersage von GUTs, die über das SM klar hinausgeht [34].
Der baryonzahlverletzende Teil der Lagrangedichte für die erste Fermionfamilie (unter Vernachlässigung von Mischungen) ergibt sich zu [20]:
| (2.8) | |||||
, und sind -Farbindizes. Das entspricht den in Abbildung 2.2 aufgeführten Wechselwirkungsvertizes.
Zwei typische Beispiele für Feynmandiagramme von Protonzerfallsprozessen zeigt Abbildung 2.3:
Der zugrundeliegende Prozeß lautet stets Quark+Quark Antiquark+Antilepton, was zu Zerfallskanälen Nukleon Meson+Antilepton führt. Alle anderen Elementarprozesse sind aufgrund von Phasenraumeffekten unterdrückt. Unter der Annahme kleiner Mischungen ist der dominante Kanal; eine qualitative Abschätzung der Lebensdauer gemäß
| (2.9) |
liefert mit und GeV für den Wert Jahre. Die neuesten experimentellen Grenzen liegen bei Jahre [35]. Die zu kurze Lebensdauer des Protons war die erste Vorhersage der -GUT, die eindeutig im Widerspruch zu experimentellen Resultaten stand.
2.2.3 Symmetriebrechung und Fermionmassen
Um den ersten Symmetriebrechungsschritt in (2.5) zu verwirklichen, benötigt man eine Higgs-Darstellung , die ein SM-Singulett enthält; dieses bildet dann den Vakuumerwartungswert (VEW) aus. Der zweite Brechungsschritt bei erfordert eine Darstellung , in der ein SM-Doublett liegt. Die einfachste Wahl hierfür lautet und (siehe (2.6) und (2.7)). Der VEW gibt allen Teilchen, die nicht zum SM-Spektrum gehören, Massen der Größenordnung , während die SM-Massen erzeugt.
Betrachtet man das Transformationsverhalten von Fermionmassentermen in der -Theorie, so ergeben sich die drei Tensorprodukte
| (2.10) | |||||
| (2.11) | |||||
| (2.12) |
Daran erkennt man zunächst, daß keine Fermionmassen entstehen können. Die Kopplung von an den Term erzeugt Dirac-Massen für die -Quarks und die geladenen Leptonen, jene an den Term Massen für die -Quarks. Majorana-Massen für die Neutrinos entstehen nicht, da nicht an koppelt.
Bei gilt die Beziehung , während von den anderen Massenmatrizen unabhängig ist. Vorhersagen von Relationen zwischen den fermionischen Massenmatrizen gehören zu den typischen Eigenschaften von GUTs. In diesem Fall ist die Vorhersage nicht realistisch, da sich nach Berücksichtigung der Renormierungseffekte die Beziehung ergibt, was im Widerspruch zu den Fermionmassen aus Tabelle 1.6 steht. Durch Einführung einer zusätzlichen 45-Higgs-Darstellung, die wegen (2.10–2.12) ebenfalls Fermionmassen erzeugen kann, ist es möglich, die Relation zwischen und so zu modifizieren, daß sie zumindest qualitativ korrekte Ergebnisse liefert [36].
2.2.4 Das Hierarchieproblem
Die -GUT enthält zwei verschiedene Symmetriebrechungsskalen und . Während die SM-Teilchen nach wie vor Massen der Größenordnung haben sollen, müssen die zusätzlich eingeführten Teilchen Massen besitzen. Das Verhältnis dieser Skalen ist extrem klein, . Diese Hierarchie überträgt sich zwangsläufig auf die Parameter im Higgs-Potential , welches die VEW und damit die Symmetriebrechung verursacht [37]. Das vollständige Higgs-Potential beinhaltet neben
| (2.13) | |||||
| (2.14) |
auch Mischterme der Form
| (2.15) |
Der erste Brechungsschritt erfolgt, wenn den VEW
| (2.16) |
ausbildet. Die -Bosonen und die physikalischen Higgs-Teilchen in erhalten Massen . Der zweite Schritt verläuft analog zum SM. Berechnet man jedoch die Massen der Teilchen in , so ergibt sich aufgrund der Potentialterme in (2.15):
| (2.17) |
Sowohl als auch enthalten Terme , was im Falle des Tripletts auch notwendig ist, da es ebenso wie die -Bosonen Protonzerfälle vermitteln kann; das SM-Doublett dagegen muß Massen haben. Dies läßt sich wegen nur dann erreichen, wenn ist.
Die nicht sehr natürlich anmutende Feineinstellung der Parameter mit einer Genauigkeit muß schließlich für jede Ordnung der Störungstheorie wiederholt werden, da sonst Strahlungskorrekturen wie zum Beispiel die in Abbildung 2.4 gezeigte Beiträge höherer Ordnung zu liefern, die wieder sind [38].
Dieses Hierarchieproblem taucht grundsätzlich in allen Theorien auf, die zwei oder mehr Massenskalen stark unterschiedlicher Größenordnung aufweisen und läßt sich zumindest im Rahmen nichtsupersymmetrischer GUTs nicht befriedigend lösen. Deswegen geht man im allgemeinen von der Gültigkeit der sogenannten „Extended Survival Hypothesis“ aus [39]. Sie besagt, daß Higgs-Teilchen die größtmögliche Masse erhalten, die mit dem Symmetriebrechungsschema des Modells verträglich ist. Da in der -GUT das Triplett für den Brechungsschritt bei ohne Bedeutung ist, hat es eine Masse .
2.2.5 Zusammenfassung
Obwohl das -Modell aufgrund der experimentellen Fakten mittlerweile ausgeschlossen ist, besitzt es im Vergleich zum SM eine Reihe von attraktiven Eigenschaften:
-
•
Die SM-Wechselwirkungen werden vereinheitlicht; es gibt nur noch eine Kopplungskonstante und eine Vorhersage für .
-
•
Die anomaliefreie Darstellung kann die Fermionen einer Familie aufnehmen. Obwohl nach wie vor reduzibel, hat sie eine einfachere Struktur als (1.5).
-
•
Die Einbettung der in eine einfache Lie-Gruppe führt automatisch zur korrekten Quantisierung der elektrischen Ladung.
-
•
Die Massenmatrizen der Fermionen sind nicht mehr unabhängig voneinander.
Dem stehen folgende Schwierigkeiten gegenüber:
-
•
Die fermionische Darstellung ist reduzibel.
-
•
Der Higgs-Sektor der Theorie ist wesentlich komplexer als im SM.
-
•
Die Existenz zweier stark unterschiedlicher Massenskalen führt zum Hierarchieproblem.
-
•
Die Probleme im Neutrinosektor sind weiterhin ungelöst.
-
•
Auch in der -GUT ist das Wechselwirkungsverhalten rechts- und linkshändiger Fermionen verschieden.
-
•
Es gibt keine Erklärung für die Existenz dreier Fermionfamilien und die Massenhierarchie zwischen ihnen.
Einige dieser Schwächen können im Rahmen von GUTs mit größerer Eichgruppe beseitigt werden.
2.3
2.3.1 Spinordarstellungen der -Gruppen
Die ist die kleinste orthogonale Gruppe, die als Untergruppe enthält und komplexe Darstellungen besitzt. Da eine maximale Untergruppe der ist, sind alle vorteilhaften Eigenschaften der -GUT auch in -Theorien vorhanden.
Die orthogonalen Lie-Gruppen unterscheiden sich in einigen wichtigen Punkten von den unitären Gruppen [25]. Alle irreduziblen Darstellungen der können durch Reduktion von Tensorprodukten der komplexen Fundamentaldarstellung und der zu ihr komplex konjugierten Darstellung erhalten werden. Die orthogonalen Gruppen dagegen besitzen neben den Tensordarstellungen, welche man durch Produktbildung aus der reellen Fundamentaldarstellung konstruieren kann, die sogenannten Spinordarstellungen, für die das nicht gilt. Zu den Spinordarstellungen der gelangt man über die komplexe Clifford-Algebra
| (2.18) |
Aus den Generatoren von kann man eine Darstellung für die Generatoren der -Lie-Algebra konstruieren:
| (2.19) |
Die so definierten erfüllen die Vertauschungsrelation
| (2.20) |
welche die -Algebra definiert (). Die Generatoren in der Fundamentaldarstellung sind durch
| (2.21) |
gegeben. Über die Matrixdarstellungen der komplexen Clifford-Algebra (2.18) und somit der kommt man zu den Spinoren, da diese die Elemente des entsprechenden Darstellungsraumes sind. Die Eigenschaften der irreduziblen Spinordarstellungen der hängen vom Wert von ab:
-
•
Ist ungerade, so existiert eine reelle Spinordarstellung der Dimension .
-
•
Ist gerade, so existieren zwei inäquivalente Spinordarstellungen der Dimension . Wenn gerade ist, so sind die beiden Darstellungen reell, während sie für ungerades komplex sind, wobei dann die eine das komplex Konjugierte der anderen ist.
Aus diesem Grunde verfügen nur die -Gruppen über komplexe Darstellungen; im Falle der sind dies die und die .
2.3.2 Teilcheninhalt und Symmetriebrechung
Die Hauptmotivation für die Konstruktion von -GUTs [40] wird deutlich, wenn man die Verzweigung der 16 bezüglich der Untergruppe betrachtet:
| (2.22) |
In einer 16 können demnach alle Fermionen einer Familie und ein zusätzliches -Singulett untergebracht werden. Dieses Singulett besitzt exakt die Eigenschaften und Quantenzahlen des rechtshändigen Neutrinos (beziehungsweise linkshändigen Antineutrinos), da es zur -Darstellung identisch ist.
Hier wird ein großer Vorteil von -Modellen gegenüber der -GUT deutlich, denn alle Fermionen einer Generation inklusive eines linkshändigen Antineutrinos liegen in einer irreduziblen und komplexen Darstellung der Eichgruppe. Ferner erklärt die Anomaliefreiheit der orthogonalen Gruppen auf natürliche Weise das Verschwinden der Anomalie der -Darstellung .
-Modelle sind überdies zumindest im Eichboson- und Fermionsektor manifest - und -invariant. Da in der 16 die linkshändigen Teilchen und Antiteilchen liegen, wird sie durch Anwendung von auf sich selbst abgebildet. Unter wird die 16 auf die abgebildet, in welcher die rechtshändigen Teilchen und Antiteilchen untergebracht sind. - und -Verletzung kann entweder explizit im Higgs-Sektor oder durch die spontane Symmetriebrechung realisiert werden.
Da der Rang der um eins größer als der von ist, existiert eine Vielzahl von möglichen Symmetriebrechungsschemata. Die direkte Brechung in das SM ist dabei ebenso wie die Brechung nach zwar möglich, aber wegen der in Abbildung 2.1 gezeigten SM-Kopplungsentwicklung phänomenologisch ausgeschlossen. Man benötigt demnach mindestens einen Zwischenschritt, das heißt
| (2.23) |
Es sind Modelle mit bis zu vier aufeinander folgenden intermediären Symmetriegruppen konstruiert und ausführlich untersucht worden [41, 42], jedoch besitzen sie gegenüber Modellen mit nur einer solchen keine besonderen Vorzüge. Tabelle 2.2 gibt die verschiedenen Möglichkeiten für den Brechungsschritt bei und die dafür zu verwendende Higss-Darstellung mit einem -Singulett an.
| Symmetriegruppe | Higgs-Darstellung |
|---|---|
| 210 | |
| 54 | |
| 45 | |
| 45, 210 | |
| 210 | |
| 210 |
Die -Parität [43] ist eine diskrete Symmetrie, welche und vertauscht; sie erfordert ein rechts-links-symmetrisches Teilchenspektrum. Wenn die Theorie also Teilchen in einer -Darstellung enthält, muß auch eine Darstellung vorhanden sein. Dies hat zur Folge, daß die beiden Eichkopplungen und überall zwischen und gleich groß sind und die Parität erhalten ist.
Welche Symmetriegruppe durch die Brechung mittels einer bestimmten Darstellung realisiert wird, hängt von den jeweiligen Werten der Parameter im Higgs-Potential ab [44]. Die Symmetriebrechung bei in das SM erfolgt in allen Fällen über einen VEW des -Singuletts einer -Darstellung 126.
In dieser Arbeit soll ein -Modell mit intermediärer -Symmetrie untersucht werden. Diese Gruppe gehört zu den maximalen Untergruppen der und ist von Pati und Salam für eine Erweiterung des SM durch eine rechts-links-symmetrische Theorie vorgeschlagen worden [45]. Allerdings hat sich gezeigt, daß Modelle mit -Symmetrie für den Wert GeV liefern, welcher auf eine zu kurze Protonlebensdauer führt [42]. -Modelle ohne -Parität besitzen diesen Nachteil nicht. Der -Faktor ist identisch mit dem in , die ist das rechtshändige Gegenstück dazu, und die schließlich ist eine erweiterte Farbgruppe mit der -Quantenzahl als „vierter Farbe“. In -basierten Modellen ist bei Skalen eine lokale -Symmetrie, also Teil der Eichgruppe, und keine globale Symmetrie wie in der -GUT. Das hat zur Folge, daß auch Bosonen nichtverschwindendes besitzen können.
Die Fermiondarstellung 16 verzweigt sich bezüglich und gemäß
| (2.25) |
Der Operator der elektrischen Ladung ist durch gegeben, die SM-Hyperladung durch . Die adjungierte Darstellung 45, in der die Eichbosonen liegen, verzweigt sich bezüglich wie
| (2.26) |
Die ersten drei Faktoren entsprechen den -Eichbosonen. Die (2,2,6) enthält neben den aus der -GUT bekannten - und -Bosonen die ebenfalls baryon- und leptonzahlverletzende Prozesse vermittelnden - und -Bosonen (und deren Antiteilchen); sie haben die Ladungen beziehungsweise und Massen der Größenordnung . Abbildung 2.5 zeigt die zugehörigen Wechselwirkungsvertizes. In der (15,1,1) liegen die acht Gluonen der QCD, ein an koppelndes neutrales Boson und die -Tripletts und mit .
Der vollständige baryonzahlverletzende Teil der -Lagrangedichte für die erste Fermionfamilie und ohne Mischungen lautet [20]:
| h.c. | (2.27) |
Durch direkten -Austausch können keine Nukleonenzerfälle vermittelt werden, was auch notwendig ist, da deren Massen der Größenordnung zu sehr großen Zerfallsraten führen würden. Durch --Mischung entstehen in höheren Ordnungen -verletzende Nukleonzerfälle, die aber gegenüber den Prozessen führender Ordnung durch zusätzliche Faktoren unterdrückt sind [34].
2.3.3 Fermionmassen
Dirac-Massenterme für die geladenen Fermionen und die Neutrinos haben die Struktur und besitzen demnach das -Transformationsverhalten
| (2.28) |
Die Fermionmassen und die Symmetriebrechung kommen also zustande, wenn die farblosen und elektrisch neutralen Komponenten von Higgs-Teilchen in den Darstellungen , oder einen VEW der Größenordnung ausbilden. Diese Darstellungen verzweigen sich folgendermaßen unter (siehe Anhang A.2):
| (2.29) | |||||
| (2.30) | |||||
| (2.31) |
Da die linkshändigen Teilchen in (4,2,1) und die linkshändigen Antiteilchen in liegen, wird die Erzeugung von Dirac-Massen wegen
| (2.32) |
durch die -Doubletts in den -Darstellungen (1,2,2) der 10 und 120 sowie denen in den (15,2,2) der 120 und 126 vermittelt. Ferner können aufgrund von
| (2.33) | |||||
| (2.34) |
über den Term auch Majorana-Massen für die links- und rechtshändigen Neutrinos auftreten. Da der VEW des SM-Singuletts in (10,1,3) den Symmetriebrechungsschritt realisiert, sind die Majorana-Massen der rechtshändigen Neutrinos zwangsläufig von der Größenordnung .
Die verschiedenen Yukawa-Kopplungen und VEW der 10, 120 und 126 sind in Tabelle 2.3 zusammengefaßt (die Indizes numerieren mehrere Darstellungen einer Art, wenn vorhanden).
| Higgs-Darstellung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yukawa-Kopplungsmatrix | ||||
| Vakuumerwartungswerte | , | , | , | , |
Damit die beiden VEW, die zu jeder -Darstellung gehören, verschieden sein können, muß diese komplex sein. Das läßt sich durch Kombination zweier reeller Darstellungen zu erreichen.
Mit den in Tabelle 2.3 festgelegten Bezeichnungen für die Kopplungen und VEW (unter Vernachlässigung der oberen Indizes) ergeben sich für die Fermionmassenmatrizen in einer -GUT folgende Identitäten [46]:
| (2.35) | |||||
| (2.36) | |||||
| (2.37) | |||||
| (2.38) | |||||
| (2.39) | |||||
| (2.40) |
Die Beziehungen (2.35-2.40) sind in -Theorien mit intermediärer -Symmetrie im gesamten Bereich oberhalb von gültig, während sie für die anderen in Tabelle 2.2 nur oberhalb von gelten.
In (2.35-2.40) ist zu berücksichtigen, daß und symmetrisch sind, während antisymmetrisch ist. Um Modelle mit asymmetrischen Massenmatrizen konstruieren zu können, muß also mindestens eine 120 an der Massenerzeugung beteiligt sein. Die Faktoren sind Clebsch-Gordan-Koeffizienten, welche auf der nichttrivialen -Struktur der (15,2,2) beruhen.
Wird im einfachsten Fall lediglich eine (komplexe) 10 verwendet, gilt zwischen den Massenmatrize die Beziehung
| (2.41) |
in der die -Vorhersage enthalten ist. Genauso wie dort führt (2.41) aber zu falschen Werten für die Fermionmassen bei . Verwendet man Modelle mit komplizierterer Higgs-Struktur, kann man Massen und Mischungen der Fermionen korrekt beschreiben.
Die beiden Majorana-Massenmatrizen der Neutrinos sind nur bis auf konstante Vorfaktoren bekannt, die wiederum von der expliziten Form des Higgs-Potentials und den Werten der Parameter in diesem abhängen. Da es für Modelle mit nichtminimalem Higgs-Inhalt praktisch unmöglich ist, das zugehörige Potential im Detail zu analysieren, kann man lediglich plausible Annahmen über die Vorfaktoren machen. Wir werden im folgenden davon ausgehen, daß sie betragsmäßig zwischen und liegen. Majorana-Massenmatrizen sind aufgrund der Spinor-Struktur (1.10-1.11) der entsprechenden Massenterme stets symmetrisch. Im Rahmen von -Modellen können sie nur durch Kopplungen an 126-Darstellungen erzeugt werden.
Die Majorana-Massen der linkshändigen Neutrinos, die durch einen VEW der in (2.33) entstehen können, müssen sehr klein sein, da sie sonst zu beobachtbaren Effekten in durch neutrale schwache Ströme vermittelten Prozessen führen würden. Die Konstruktion eines Potentials, in dem dieser VEW verschwindet, stößt jedoch auf formale Probleme, denn in höheren Ordnungen treten Divergenzen auf, die nur dann absorbiert werden können, wenn der VEW der ungleich Null ist [47]. Es kann allerdings gezeigt werden, daß er von der Größenordnung sein muß [48] und somit gegenüber den Dirac-Massen um einen Faktor unterdrückt ist und vernachlässigt werden kann.
Bei Skalen unterhalb von ist das Teilchenspektrum das des SM. Das Higgs-Doublett im SM ist eine bestimmte Linearkombination aus den -Doubletts in den - und -Darstellungen, welche an der Massenerzeugung mitwirken. Die übrigen Linearkombinationen haben Massen und treten im SM deshalb nicht in Erscheinung [49].
2.3.4 See-Saw-Mechanismus
Die Massen der linkshändigen Neutrinos müssen, wenn sie von Null verschieden sind, sehr viel kleiner als die der geladenen Fermionen sein. Die Obergrenzen aus den Experimenten zur direkten Messung von Neutrinomassen liegen bei eV (Untersuchung des -Spektrums von Tritium), MeV (aus -Zerfällen) und MeV (aus -Zerfällen) [7]. Kosmologische Argumente schränken die Grenzen der Massenwerte weiter ein [50]; damit die kritische Dichte des Universums nicht überschritten wird, muß für die Summe der Massen leichter stabiler Neutrinos eV gelten. Rechtshändige Neutrinos dagegen müssen sehr massiv sein, da sie experimentell nicht beobachtet werden.
Der See-Saw-Mechanismus [51] liefert in Modellen mit rechtshändigen Neutrinos und einer Skala , bei der die Leptonzahlerhaltung verletzt wird, eine natürliche Erklärung für die oben angegebenen Eigenschaften des Neutrinomassenspektrums. Seine Wirkungsweise soll zunächst am einfachen Fall einer Fermiongeneration verdeutlicht werden.
Der allgemeinste Massenterm für das Neutrino lautet:
| (2.42) | |||||
mit
| (2.43) |
In -GUTs mit intermediärer Symmetrie gelten die Relationen
| (2.44) |
da, wie im vorigen Abschnitt erläutert wurde, dieselbe Größenordnung wie die Masse des positiv geladenen Quarks hat und von der Ordnung der -brechenden Skala ist; wiederum ist gegenüber stark unterdrückt.
Die Diagonalisierung von M führt (abgesehen von Korrekturen ) auf die Masseneigenzustände
| (2.45) |
und ihre Massen
| (2.46) | |||||
| (2.47) |
Anstelle eines Dirac-Neutrinos erhält man auf diese Weise zwei Majorana-Neutrinos und (es gilt ) mit Massen , wobei ist. Das leichte Majorana-Neutrino entspricht dem Neutrino des SM; das rechtshändige Antineutrino des SM ist identisch mit . Das schwere Neutrino ist aufgrund seiner Masse nicht beobachtbar.
Die Verallgemeinerung von (2.42) auf den Fall von Fermionfamilien liefert
| (2.49) |
mit -dimensionalen Vektoren und der symmetrischen ()-Matrix
| (2.50) |
Hier sind die nichtverschwindenden Einträge von betragsmäßig sehr viel kleiner als die von , und diese sind wiederum sehr viel kleiner als die von (siehe auch (2.38-2.40)). Indem man M auf blockdiagonale Form bringt, erhält man leichte Majorana-Neutrinos mit der symmetrischen Massenmatrix
| (2.51) |
der sogenannten See-Saw-Matrix, und schwere Majorana-Neutrinos mit der Massenmatrix
| (2.52) |
Die Diagonalisierung von und
| (2.53) |
liefert für die physikalischen Neutrinos , , beziehungsweise , , sowie deren Massen und Mischungen. Letztere haben nun Auswirkungen auf die leptonischen Anteile der geladenen schwachen Ströme im SM, welche sich beim Übergang von Wechselwirkungs- zu Masseneigenzuständen analog zu (1.31) gemäß
| (2.54) | |||||
| (2.55) |
ändern ( und sind Familienindizes). Die unitäre Matrix entspricht der CKM-Matrix im Quarksektor und kann in Neutrino-Oszillationsexperimenten gemessen werden. Die beobachtbaren Effekte der Neutrinomassen und -mischungen werden im nächsten Kapitel erläutert.
2.3.5 Zusammenfassung
Im Vergleich zur -GUT sind -Modelle mit intermediärer Symmetrie phänomenologisch sehr erfolgreich, und es sind bis heute keine experimentellen Resultate bekannt, die sie ausschließen. Zusätzlich zu den positiven Eigenschaften, welche schon die besaß, kommen hier folgende Vorzüge:
-
•
Alle Fermionen einer Generation, einschließlich des rechtshändigen Neutrinos, liegen in einer irreduziblen Darstellung.
-
•
Die Eigenschaften der Neutrinos, insbesondere deren Massen und Mischungen, können durch den See-Saw-Mechanismus befriedigend erklärt werden.
-
•
Die ist automatisch anomaliefrei, enthält als lokale Symmetrie und besitzt rechts-links-symmetrische Untergruppen.
Die Probleme, welche weder in -Modellen noch in anderen GUTs gelöst werden können, sind im letzten Abschnitt zusammengefaßt.
2.4
Die [30, 52] ist die einzige exzeptionelle Lie-Gruppe mit komplexen Darstellungen. Zu den maximalen Untergruppen der gehören die für die Symmetriebrechung nach in Frage kommenden und . Letztere kann man als -Symmetrie interpretieren.
Die Fermionen einer Generation liegen in der komplexen Fundamentaldarstellung 27, welche sich bezüglich der und gemäß
| (2.56) | |||||
| (2.57) |
verzweigt. Im Gegensatz zu den - und -Modellen enthält die -GUT zusätzliche Fermionen, die im SM nicht beobachtet werden und somit superschwer sein müssen. In der 10 liegen ein Quark mit Ladung , ein leptonisches -Doublett sowie die zugehörigen Antiteilchen; das -Singulett wird mit bezeichnet.
Die adjungierte Darstellung 78 der enthält die Eichbosonen der Theorie. Die im Vergleich zur neu hinzukommenden Eichbosonen koppeln sowohl an die superschweren als auch an die SM-Fermionen und liefern zu Nukleonzerfällen keine Beiträge.
Die Fermionmassen besitzen das -Transformationsverhalten
| (2.58) |
wobei die 351 und die inäquivalent sind. Unter verzweigen sich diese beiden Darstellungen wie
| (2.59) | |||||
| (2.60) |
Die 351 kann in die brechen, ohne daß die SM-Fermionen Massen der Größenordnung bekommen; in diesem Brechungsschritt werden nur Massen für die neuen Fermionen erzeugt. Die Brechung und die Erzeugung der SM-Massen werden durch die Higgs-Darstellung realisiert. Um asymmetrische Massenmatrizen erhalten zu können, muß eine vorhanden sein.
Die kleinste Darstellung, welche die Symmetriebrechung realisieren kann, ist die 650. In beiden Brechungsschemata ergeben sich Lebensdauern für das Proton, die weit oberhalb des experimentell zugänglichen Bereichs liegen.
Offensichtlich ist die allgemeine Struktur von -GUTs wesentlich komplizierter als die von -Modellen; insbesondere die Existenz exotischer superschwerer Fermionen kommt neu hinzu. Dem steht als Vorteil die Möglichkeit gegenüber, Fermionmassen und -mischungen durch Strahlungskorrekturen zu erzeugen [53].
2.5 Probleme und Grenzen von GUTs
Wie in diesem Kapitel dargestellt wurde, können GUTs viele Schwächen des SM erfolgreich beheben. Ferner liefern sie eine Reihe von zumindest grundsätzlich überprüfbaren Vorhersagen wie zum Beispiel die Instabilität der Nukleonen oder die Neutrinomassen und -mischungen. Es gibt jedoch auch Probleme, die im Rahmen von nichtsupersymmetrischen GUT-Modellen nicht gelöst werden können. Man kann sie in rein technische und fundamentale Probleme unterteilen.
Zu den ersteren gehören das schon erwähnte Hierarchieproblem und die daraus resultierenden Feineinstellungen verschiedener Parameter. Diese Feineinstellungen sind bezüglich Strahlungskorrekturen instabil, so daß sie für jede Ordnung der Störungstheorie durchgeführt werden müssen. Das -Problem () gehört ebenfalls in diese Kategorie.
Ungelöste fundamentale Fragestellungen sind die Abwesenheit der Gravitationswechselwirkung in GUTs, eine fehlende Erklärung für die Existenz dreier Fermionfamilien und ein hohes Maß an Unbestimmtheit im Higgs-Sektor der Modelle. Auch der Ursprung der Massenhierarchie der Fermionen kann nicht geklärt werden, obwohl es in GUTs im Gegensatz zum SM Beziehungen zwischen den Massenmatrizen der verschiedenen Fermionarten gibt.
Eine wirklich befriedigende Lösung dieser Probleme im Rahmen einer fundamentaleren Theorie als den hier geschilderten GUT-Modellen steht jedoch bis heute aus.
Kapitel 3 Neutrino-Oszillationen
3.1 Theoretische Grundlagen
Neutrino-Oszillationen [16, 54] können auftreten, wenn die Masseneigenzustände der Neutrinos nicht mit den Wechselwirkungseigenzuständen übereinstimmen. Dies ist in -Modellen mit intermediärer Symmetrie im allgemeinen der Fall, da der See-Saw-Mechanismus aus Abschnitt 2.3.4 für die leichten Majorana-Neutrinos () die üblicherweise nichtdiagonale Massenmatrix (2.51) liefert. Wenn die Mischungsmatrix ist, sind die Linearkombinationen der Neutrinos (=1,2,3) mit den Massen , wobei gelten soll:
| (3.1) |
Die schweren Neutrinos entkoppeln bei Skalen und spielen für die in diesem Kapitel geschilderten Phänomene keine Rolle.
3.1.1 Vakuumoszillationen
Zunächst sollen Oszillationen im Vakuum betrachtet werden. Der quantenmechanische Zustand eines zur Zeit in einem elektroschwachen Prozeß erzeugten relativistischen Neutrinos mit Impuls ist durch
| (3.2) |
gegeben. Die Zeitentwicklung der Zustände gemäß der Schrödinger-Gleichung liefert unter Verwendung von
| (3.3) |
für die Beziehung
| (3.4) |
Drückt man als Linearkombination der aus, so ergibt sich
| (3.5) |
Mit sei die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, daß ein Neutrino der Energie , welches bei als erzeugt wurde, in einer Entfernung von der Quelle als detektiert wird. Dann gilt unter Berücksichtigung der Unitarität von U (die in Modellen mit See-Saw-Mechanismus bis auf Korrekturen der Ordnung gegeben ist):
| (3.6) |
Hierbei ist . Aus der -Invarianz folgen ferner die Beziehungen
| (3.7) |
Die Übergangswahrscheinlichkeit für hängt demnach von den Elementen von U, von zwei unabhängigen Differenzen der Massenquadrate und vom Parameter ab. Sie kann dann von Null verschieden sein, wenn ist und für mindestens ein gilt. Ist dies der Fall, so wird ein Neutrinostrahl, welcher bei nur aus besteht, an einem Ort auch Neutrinos der Art beinhalten. Ein nur für den Nachweis von geeignetes Experiment wird dann ein Neutrinodefizit feststellen.
Die Bedeutung von (3.6) wird besonders klar, wenn man den Fall zweier Neutrino-Arten betrachtet. Dann besitzt U die einfache Parametrisierung
| (3.8) |
(U kann zwar -verletzende Phasen enthalten, die aber auf Neutrino-Oszillationen keinen Einfluß haben) und es gilt:
| (3.9) | |||||
| (3.10) |
Die Übergangswahrscheinlichkeit (3.9) ist eine periodische Funktion von ; dieses Phänomen wird als Neutrino-Oszillation bezeichnet. Die Amplitude der Oszillation ist gleich , hängt also allgemein von den Einträgen von U ab, und die Oszillationslänge ist durch gegeben. Oszillationseffekte können demnach beobachtet werden, sofern ist.
Bei der Datenanalyse von Oszillationsexperimenten wird im allgemeinen von nur zwei beteiligten Neutrino-Arten ausgegangen und (3.9-3.10) verwendet. Die graphische Auswertung erfolgt dann in -Diagrammen, wobei die Nichtbeobachtung von Oszillationen abhängig von der Nachweisempfindlichkeit des Experiments bestimmte Bereiche des Parameterraums ausschließt, während positive Resultate zu mehr oder weniger eng begrenzten erlaubten Parameterbereichen führen.
Oszillationsexperimente können lediglich Aussagen über die Größen und machen. Auf diese Weise lassen sich die Verhältnisse je zweier Neutrinomassen bestimmen, nicht aber die Massenwerte selbst.
3.1.2 Oszillationen in Materie
Wenn Neutrinos Materie durchqueren, kann der sogenannte Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein-Effekt (MSW-Effekt) [55, 56] auftreten, welcher das Oszillationsverhalten im Vergleich zum Vakuumfall modifiziert. Ursache des MSW-Effekts ist die Tatsache, daß in Materie für die Teilchendichten der geladenen Leptonen gilt. Während alle Neutrinos die gleiche Wechselwirkung über neutrale schwache Ströme erfahren, wechselwirken nur die Elektron-Neutrinos über geladene schwache Ströme mit der Materie. Das führt zu einer Flavour-Asymmetrie in der Vorwärts-Streuung von Neutrinos, die eine Phasenverschiebung zur Folge hat und sich somit auf die Zeitentwicklung des Gesamtsystems auswirkt [55].
Eine formale Analyse dieses Sachverhalts liefert für zwei Neutrino-Arten wieder die Beziehungen (3.9-3.10), wobei allerdings die Vakuumgrößen und durch die neuen Größen
| (3.11) | |||||
| (3.12) |
mit ersetzt werden müssen. Daraus ergeben sich folgende Spezialfälle:
-
•
(geringe Elektronendichte):
(3.13) Die Materie-Effekte sind vernachlässigbar klein.
-
•
(hohe Elektronendichte):
(3.14) Die Vakuumparameter sind stark unterdrückt; die Amplitude ist verschwindend klein und die Oszillationslänge ergibt sich unabhängig von .
-
•
:
(3.15) Die Oszillationsamplitude ist maximal, auch wenn der entsprechende Vakuumwert sehr klein ist. Besitzt die Materieverteilung eine räumliche Ausdehnung der Größenordnung , so kann die Übergangswahrscheinlichkeit durchaus sein. Dieses Resonanzverhalten von (3.11) wird als MSW-Effekt bezeichnet [56].
Die Materie-Effekte auf das Oszillationsverhalten sind besonders für den Fall der im Inneren der Sonne erzeugten Elektron-Neutrinos von Bedeutung.
3.2 Experimentelle Situation
Die Neutrino-Oszillationsexperimente lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen. Die „Appearence“-Experimente untersuchen das Erscheinen von in einem Neutrinostrahl, welcher bei seiner Entstehung ausschließlich aus -Neutrinos bestand, während „Disappearence“-Experimente nach einer Verringerung des -Flusses in einem solchen Strahl suchen. Weiterhin kann man die Experimente nach den Neutrinoquellen unterscheiden; es finden Neutrinos aus Beschleunigern, Kernreaktoren und natürlichen Quellen Verwendung. Ausführliche Referenzen zu den hier erwähnten Oszillationsexperimenten finden sich in [16]. Bis heute sind drei Indizien bekannt, die auf Neutrino-Oszillationen hindeuten.
3.2.1 Sonnen-Neutrinos
Struktur und Dynamik der Sonne werden durch das Standard-Sonnenmodell (SSM) [57] beschrieben und gelten als gut verstanden. Die Energie wird im Kern der Sonne über die thermonuklearen - und CNO-Reaktionsketten erzeugt; der zugrundeliegende Fusionsprozeß ist in beiden Fällen
| (3.16) |
Das Energiespektrum der Elektron-Neutrinos ist inhomogen und reicht je nach erzeugender Reaktion von 100 keV bis zu 15 MeV. Da die Unsicherheiten in den SSM-Vorhersagen über den Neutrinofluß relativ klein sind, eignet sich dieser gut für die Suche nach Oszillationen . Alle bisher durchgeführten Messungen haben beträchtliche Differenzen zwischen tatsächlich gemessenen Ereignissen und den aufgrund von Monte-Carlo-Simulationen erwarteten Ereignissen festgestellt; die Resultate sind in Tabelle 3.1 dargestellt [16].
| Experiment | Nachweisreaktion | Energiebereich (MeV) | |
|---|---|---|---|
| Homestake | |||
| GALLEX | |||
| SAGE | |||
| Kamiokande | |||
| Super-Kamiokande |
Homestake verwendet zum Nachweis 600 t , GALLEX und SAGE bestehen aus 30 t Galliumchlorid beziehungsweise 60 t metallischem Gallium, Kamiokande und das Nachfolge-Experiment Super-Kamiokande sind Wasser-Čerenkovdetektoren.
Die Analyse der Daten führt zu dem Ergebnis, daß sowohl Vakuumoszillationen auf dem Weg zwischen der Sonne und der Erde als auch der MSW-Effekt im Sonneninneren das Neutrinodefizit erklären können;
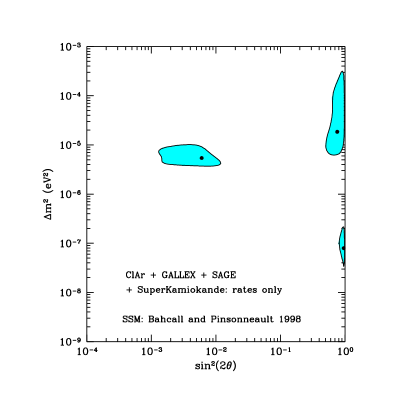
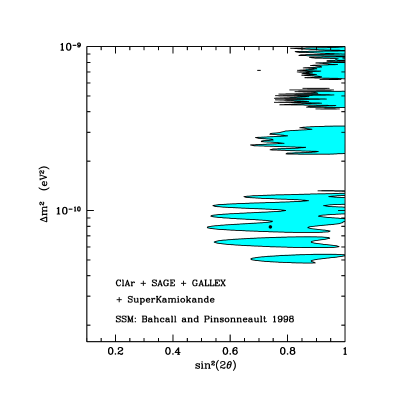
es kommen - und -Übergänge in Frage [58]. Die Abbildungen 3.1(a) und 3.1(b) geben die erlaubten Bereiche (mit einem Confidence Level (CL) von 99%) im -Parameterraum an, wobei die Punkte den statistisch wahrscheinlichsten Lösungen entsprechen:
-
•
eine MSW-Lösung mit großem Mischungswinkel bei und .
-
•
eine MSW-Lösung mit kleinem Mischungswinkel bei und .
-
•
eine MSW-Lösung mit kleinem bei und .
-
•
eine Vakuumoszillations-Lösung bei und .
Die MSW-Lösung mit kleinem ist in ihrer Statistik wesentlich unwahrscheinlicher als die anderen, da sie für 95 % CL nicht mehr akzeptabel ist. Damit die Vakuumoszillations-Lösung das Neutrinodefizit erklären kann, ist eine nicht sehr natürlich wirkende Feineinstellung zwischen der Oszillationslänge und dem Sonne-Erde-Abstand erforderlich. Deswegen werden in dieser Arbeit nur die ersten beiden Lösungen in Betracht gezogen.
Weitere Experimente zur Untersuchung des Sonnen-Neutrinodefizits sind in Vorbereitung. Der Nachfolger von GALLEX ist das unterirdische Gallium Neutrino Observatory (GNO) im Gran Sasso-Labor (Italien) mit angestrebten 100 t Ga im Jahre 2002. Borexino ist ein organischer Flüssig-Szintillator mit einer Empfindlichkeit MeV und wird ebenfalls in Gran Sasso untergebracht. Das Sudbury Neutrino Observatory (SNO) in Kanada wird ein Schwerwasser-Čerenkovdetektor aus 1000 t D2O sein, welcher für MeV sensibel ist.
3.2.2 Atmosphärische Neutrinos
Treffen hochenergetische Protonen der kosmischen Strahlung auf die obere Erdatmosphäre, so kollidieren sie mit den Kernen der Luftmoleküle. In diesen hadronischen Stoßprozessen entstehen zahlreiche Pionen und Kaonen, die gemäß
| (3.17) |
zerfallen; die dabei erzeugten Neutrinos bezeichnet man als atmosphärische Neutrinos. Wegen (3.17) erwartet man für das zahlenmäßige Verhältnis von Myon- zu Elektron-Neutrino-Ereignissen in einem Detektor in guter Näherung
| (3.18) |
Obwohl der exakte Wert von von der Neutrino-Energie abhängt und von 2 abweichen kann, erlauben detaillierte Analysen mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen relativ präzise Vorhersagen. Diese bieten einen weiteren Ansatzpunkt für die Suche nach Neutrino-Oszillationen und wurden vom Kamiokande-Experiment und dem größeren Nachfolger
| Experiment | Energiebereich | |
|---|---|---|
| Kamiokande | GeV | |
| Kamiokande | GeV | |
| Super-Kamiokande | GeV | |
| Super-Kamiokande | GeV |
Super-Kamiokande in Japan überprüft. Beides sind unterirdische Wasser-Čerenkovdetektoren; Kamiokande bestand aus 3 kt und Super-Kamiokande besteht aus 50 kt reinen Wassers in 1000 m Tiefe. Als Nachweisreaktionen dienen
| (3.19) |
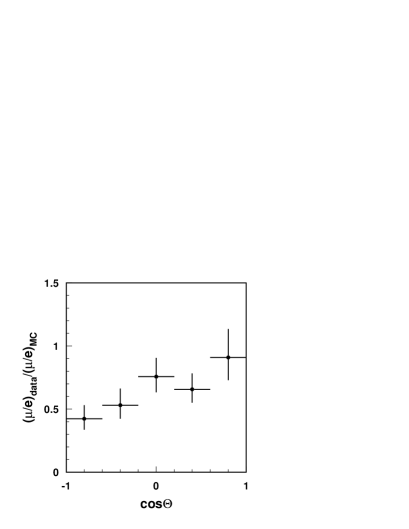
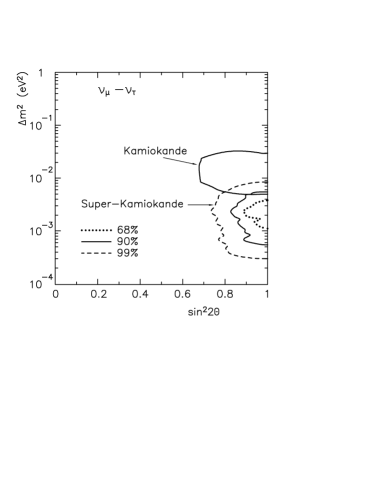
Beide Experimente haben für das Verhältnis von gemessenem zu theoretisch erwartetem erhebliche Abweichungen vom Wert 1 festgestellt, die auf einem Defizit von -Ereignissen beruhen. Tabelle 3.2 faßt die Resultate zusammen, wobei der erste Fehler von statistischen und der zweite systematischen Ursprungs ist.
Eine mögliche Erklärung für diese Anomalie können -Oszillationen liefern. Die Oszillation in Elektron-Neutrinos ist aufgrund der Resulate des Reaktor-Experiments CHOOZ [61] ausgeschlossen, welches nach -Übergängen sucht, im Rahmen seines Meßbereichs ( MeV, km) aber keine solchen gefunden hat.
Die Oszillationslösung wird durch die beobachtete Abhängigkeit des -Defizits vom Zenit-Winkel (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Mischungswinkel) unterstützt (Abbildung 3.2(a)). Während die Neutrinos, welche den Detektor senkrecht von oben erreichen (), eine Strecke von km zurückgelegt haben, müssen die den Detektor von unten erreichenden die gesamte Erde durchqueren, das heißt km für . Je größer und somit auch sind, desto mehr Myon-(Anti-)Neutrinos wandeln sich in Tau-(Anti-)Neutrinos um.
Abbildung 3.2(b) zeigt den erlaubten Parameterbereich für die Oszillationslösung; die wahrscheinlichste Lösung zur Erklärung der Super-Kamiokande-Resultate liegt bei und eV. Die Annahme eines hierarchischen Massenschemas für die Neutrinos führt zu eV, was bedeuten würde, daß Neutrinos zur dunklen Materie keinen nennenswerten Beitrag liefern.
Unter Berücksichtigung der -Oszillationslösung für die Anomalie der atmosphärischen Neutrinos ist das Sonnen-Neutrinoproblem demnach auf -Oszillationen zurückzuführen, da die erlaubten Parameterbereiche in den Abbildungen 3.1 und 3.2(b) sich in keinem Fall überlappen.
Zur Ergänzung von Super-Kamiokande, das weiterhin Daten aufnimmt, sind mehrere sogenannte „Long Baseline“-Experimente geplant. Hierbei sollen Neutrinostrahlen mit wohldefinierten Eigenschaften, die mittels Stoßprozessen an Teilchenbeschleunigern erzeugt werden, in einigen hundert km Entfernung detektiert werden. Erste Resulte sind jedoch nicht vor 2001 zu erwarten.
3.2.3 LSND und KARMEN
Das LSND-Beschleunigerexperiment in Los Alamos verwendet Neutrinos, die durch das Auftreffen eines relativistischen Protonenstrahls auf ein Wasser-Target entstehen. In den Stoßprozessen werden -Mesonen erzeugt, welche anschließend zerfallen; gemäß (3.17) enthält der resultierende Neutrinostrahl keine Elektron-Antineutrinos. Im 30 m entfernten Flüssig-Szintillationsdetektor werden allerdings Photonen nachgewiesen, welche aus der Reaktion und nachfolgendem beziehungsweise stammen. Eine mögliche Erklärung hierfür können -Oszillationen liefern. Der erlaubte Parameterbereich ist in Abbildung 3.3 dargestellt, wobei der dunkelgraue Bereich 90 % CL und der hellgraue 99 % CL kennzeichnet.
Eine Reihe von weiteren Reaktor- und Beschleunigerexperimenten haben -Oszillationen untersucht, aber im Rahmen ihrer Meßbereiche keine entsprechenden Ereignisse gefunden. Dies führt im Raum der Oszillationsparameter zu verbotenen Bereichen, welche sich in Abbildung 3.3 rechts von den verschiedenen Linien befinden (90 % CL). Insbesondere das KARMEN-Experiment und sein Nachfolger KARMEN 2 am Rutherford-Appleton-Laboratorium, welche im wesentlichen den gleichen Aufbau wie LSND haben (mit m), schließen einen großen Teil des LSND-Bereichs aus. Der Grund für diese widersprüchlichen Resultate ist bis heute nicht bekannt. Allerdings wird das für 2001 am Fermilab in Planung befindliche Szintillator-Experiment MiniBooNE [63] aufgrund einer deutlich verbesserten Statistik den gesamten von LSND erlaubten Parameterbereich untersuchen und somit die Frage nach -Oszillationen abschließend beantworten können.
3.2.4 Analyse für drei Neutrino-Arten
In Tabelle 3.3 sind die Wertebereiche von zusammengefaßt, welche eine Oszillationslösung der jeweiligen Neutrino-Anomalie ermöglichen. Da sich die zulässigen Wertebereiche je zweier in keinem Fall überlappen und verschiedene Neutrinomassen unabhängige liefern, können nur dann alle drei Anomalien durch Neutrino-Oszillationen erklärt werden, wenn es vier leichte Neutrinos gibt.
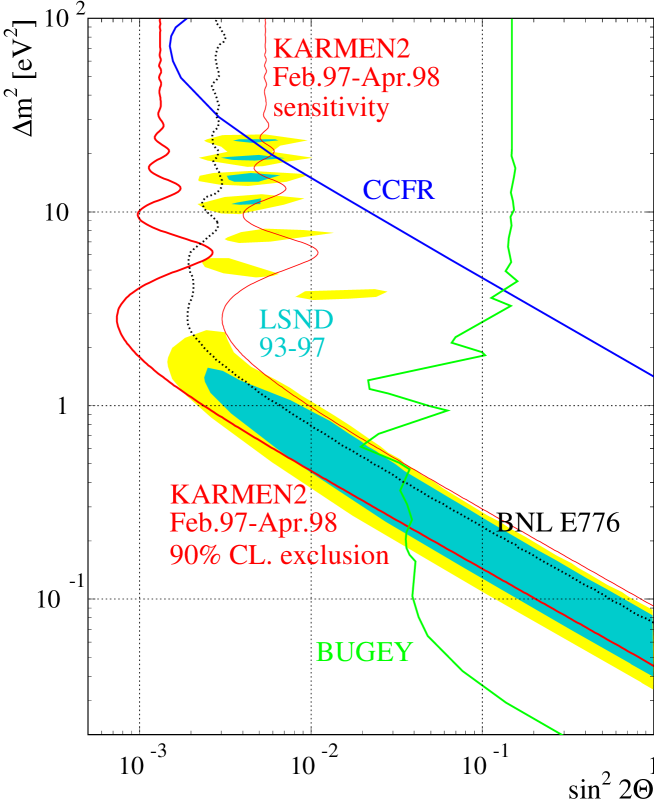
Es sind verschiedene Modelle mit einem vierten, im Rahmen des SM nicht wechselwirkenden, Neutrino untersucht worden (Referenzen in [16]); da aber die Resultate von LSND und KARMEN bisher widersprüchlich sind, wird in der vorliegenden Arbeit die LSND-Anomalie nicht weiter berücksichtigt und von drei leichten Neutrinos ausgegangen.
| Neutrino-Anomalie | (eV2) | Oszillation |
|---|---|---|
| Atmosphärische Neutrinos | ||
| Sonnen-Neutrinos (MSW-Effekt) | ||
| Sonnen-Neutrinos (Vakuum-Osz.) | ||
| LSND |
Analysiert man alle Daten aus den Oszillationslösungen der übrigen beiden Neutrinodefizite und aus den Experimenten, welche keine Hinweise auf Oszillationen liefern, unter der Annahme dreier miteinander mischender leichter Neutrinos, so erhält man je nach Erklärung der Sonnen-Neutrino-Anomalie folgende erlaubten Bereiche für die Massen und Mischungen [16]:
| MSW-Effekt (kleiner Winkel): | |||
| (3.20) | |||
| (3.21) | |||
| (3.22) | |||
| (3.26) |
| MSW-Effekt (großer Winkel): | |||
| (3.27) | |||
| (3.28) | |||
| (3.29) | |||
| (3.33) |
| Vakuumoszillationen: | |||
| (3.34) | |||
| (3.35) | |||
| (3.36) | |||
| (3.40) |
Ein realistisches Massenmodell für die Fermionen muß demnach auf Neutrino-Eigenschaften führen, welche mit einem der drei obigen Fälle innerhalb der Grenzen konsistent sind.
Kapitel 4 Das -Massenmodell
4.1 Bestimmung der Symmetriebrechungsskalen
Gegenstand dieser Arbeit ist die detaillierte Analyse eines Modellansatzes für die fermionischen Massenmatrizen im Rahmen einer nichtsupersymmetrischen -GUT mit dem Brechungsschema
| (4.1) |
Als intermediäre Symmetriegruppe sollen zunächst sowohl als auch in Frage kommen. Deren Vorteil gegenüber Symmetriegruppen, welche enthalten, besteht in der Vereinheitlichung von Quarks und Leptonen bereits bei der Skala . Das hat unter anderem zur Folge, daß die -Relationen (2.35-2.40) zwischen den verschiedenen Massenmatrizen nicht nur oberhalb von , sondern auch im Energiebereich zwischen und gelten. Ferner resultiert aus dem links-rechts-symmetrischen Fermionspektrum (2.3.2) auf natürliche Weise die Existenz rechtshändiger Neutrinos.
Gemäß Tabelle 2.2 wird die Symmetriebrechung bei durch eine 210 beziehungsweise 54 realisiert; die Brechung bei erfolgt in beiden Fällen durch das SM-Singulett einer . Bezüglich der Massen der Higgs-Teilchen wird von der Gültigkeit der „Extended Survival Hypothesis“ [39] ausgegangen, das heißt nur diejenigen Komponenten von -Higgs-Darstellungen besitzen Massen , welche für die Symmetriebrechungen bei und sowie für die Erzeugung der Fermionmassen erforderlich sind. Higgs-Teilchen mit Massen der Größenordnung können demnach in folgenden Darstellungen liegen:
-
•
in der , da sie die Symmetriebrechung bei realisiert.
-
•
in und , da diese für die Massenerzeugung der Fermionen in Frage kommen.
-
•
in Modellen mit -Symmetrie in der , welche aufgrund der -Parität das Gegenstück zur bildet (siehe Abschnitt 2.3.2).
Wie bereits in Abschnitt 2.3.3 erläutert wurde, ist das SM-Higgs-Doublett eine Linearkombination der -Doubletts in den - und -Darstellungen.
Um ein realistisches -Massenmodell konstruieren zu können, ist wegen (2.41) ein Higgs-Spektrum erforderlich, welches über den einfachsten Fall einer komplexen 10 hinausgeht. Während im Bereich unterhalb von der Teilcheninhalt stets der des SM mit einem Higgs-Doublett sein soll, ist die Anzahl der für die Erzeugung der Fermionmassen relevanten -Higgs-Darstellungen und mit Massen zunächst nicht weiter festgelegt und kann an die konkreten Anforderungen des Modells angepaßt werden. Der Umfang des Teilchenspektrums bei hat allerdings direkte Auswirkungen auf die Skalenabhängigkeit der -Eichkopplungen, wie man an den Renormierungsgruppengleichungen (B.21-B.23) erkennt. Bedeutsam wird dieser Einfluß, wenn man die phänomenologischen Eigenschaften des Massenmodells wie zum Beispiel die Zerfallsraten der Nukleonen berechnen will. Dazu müssen nämlich die Werte der Symmetriebrechungsskalen und die der verschiedenen Eichkopplungen bei diesen Skalen bekannt sein, und um diese quantitativ bestimmen zu können, ist eine numerische Integration der Renormierungsgruppengleichungen für die Kopplungen sowohl des SM (B.7-B.9) als auch des -Modells (B.21-B.23) erforderlich.
Im folgenden werden zunächst und die Kopplungswerte für beide intermediären Symmetriegruppen in Abhängigkeit vom Higgs-Spektrum numerisch bestimmt, wobei das verwendete Verfahren dem in [42] entspricht. Dort ist der minimale Fall mit einer 10 untersucht worden; in [39] wurde der Einfluß des Higgs-Spektrums auf die -Funktionen der -Kopplungen analysiert, ohne jedoch die Renormierungsgruppengleichungen numerisch zu lösen.
4.1.1 -Modell
Die Parameter in (B.21-B.23) haben hier die festen Werte und , die Werte von und können frei vorgegeben werden. Unter Berücksichtigung des Prinzips, daß die Anzahl der Higgs-Teilchen bei gegebenem Massenmodell grundsätzlich so klein wie möglich gewählt werden soll, erscheint eine Untersuchung der Fälle und sinnvoll. Die Vorgehensweise sieht dann wie folgt aus:
-
•
Für wird ein Wert vorgegeben, der sinnvollerweise zwischen und GeV liegen kann.
- •
-
•
Aus den nun bekannten SM-Kopplungen bei werden die Kopplungen des -Modells bei dieser Skala berechnet. Die Anschlußbedingungen lauten
(4.2) (4.3) (4.4) Die Faktoren 5/3 und 2/3 in (4.4) stammen aus der korrekten Normierung der -Generatoren im Rahmen der übergeordneten [21], während die Korrekturen und auf Schwelleneffekte zurückzuführen sind [64]. Diese Effekte modifizieren die „naiven“ Anschlußbedingungen in der zweiten Ordnung der Störungsrechnung. Vernachlässigt man logarithmische Korrekturen , wobei für die in der Regel nicht exakt bekannten Massen aller Teilchen steht, welche ihre Massen durch die Symmetriebrechung bei erhalten, können die Anschlußbedingungen allgemein als
(4.5) geschrieben werden [42]. bezeichnet hier den Dynkin-Index der adjungierten Darstellung der Eichgruppe (siehe Anhang A). In Abschnitt 4.2 werden die Ursachen von Schwellenkorrekturen und ihr Einfluß auf die Bestimmung der Symmetriebrechungsskalen ausführlich diskutiert.
-
•
Ausgehend von den -Kopplungen bei integriert man die Renormierungsgruppengleichungen (B.21-B.23) von zu höheren Energien und überprüft, ob eine Skala existiert, bei welcher sich die drei Kopplungen unter Berücksichtigung der ebenfalls durch Schwelleneffekte modifizierten Anschlußbedingungen
(4.6) (4.7) (4.8) in einem Punkt treffen. Ist das der Fall, so sind die Brechungsskalen und sowie die Werte der verschiedenen Kopplungskonstanten bei bekannt.
Auf diese Weise ist für jedes der in Frage kommenden Higgs-Spektren der gesamte erlaubte Parameterbereich für zu untersuchen; dabei besteht durchaus die Möglichkeit, daß keine Vereinheitlichung erreicht werden kann.
Die Ergebnisse sind in Anhang C.2 zusammengefaßt. Man erkennt zunächst, daß für und sowie und keine Vereinheitlichung stattfindet. In den übrigen untersuchten Fällen sind folgende Eigenschaften erkennbar:
-
•
Bei festem sind und umso kleiner und umso größer, je größer ist.
-
•
Bei festem sind und umso größer und umso kleiner, je größer ist.
Eine qualitative Abschätzung der Protonlebensdauer gemäß (2.9) führt unter Berücksichtigung der experimentellen Grenzen mit zu der Einschränkung GeV für die Vereinheitlichungsskala. Deswegen sind die Modelle mit und wegen ihrer relativ kleinen Werte von im Vergleich zu den übrigen vom phänomenologischen Standpunkt her eher ungeeignet.
4.1.2 -Modell
Die Parameter haben in diesem Fall wegen des zwangsläufig links-rechts-symmetrischen Teilcheninhalts beide den Wert 1. Im Vergleich zum -Modell ergibt sich hier ein wesentlicher Unterschied in der Vorgehensweise, der auf den Anschlußbedingungen bei beruht. Zusätzlich zu (4.2-4.4) gilt in Modellen mit -Parität nämlich für alle mit . Das führt auf
| (4.9) | |||||
| (4.10) | |||||
| (4.11) |
Die letzte Gleichung liefert eine Einschränkung für die SM-Kopplungen, welche bei genau einer Skala erfüllt ist. In [65] ist gezeigt worden, daß dieser Wert für von den physikalischen Eigenschaften des Modells bei Skalen völlig unabhängig ist; insbesondere hat das Higgs-Spektrum keinen Einfluß auf und die Kopplungskonstanten bei . In Tabelle C.2 sind die Werte dieser Größen angegeben. Es fällt auf, daß der Wert von um etwa zwei bis drei Größenordnungen über den entsprechenden Werten im -Modell liegt.
Das Problem reduziert sich also auf die Bestimmung von und in Abhängigkeit vom Teilcheninhalt. Von den zwei bekannten Kopplungen bei ausgehend werden (B.21-B.22) bis zu der Skala integriert, bei welcher und die Bedingungen
| (4.12) | |||||
| (4.13) |
erfüllen. Die Resultate sind in Tabelle C.3 zusammengefaßt, es sind folgende Tendenzen in den Lösungen erkennbar:
-
•
Bei festem sind und umso kleiner, je größer ist.
-
•
Bei festem sind und umso größer, je größer ist.
Für alle untersuchten Fälle findet eine Vereinheitlichung der Kopplungen statt, allerdings bei vergleichsweise kleinen -Werten von GeV. Das führt zu Vorhersagen für die Lebensdauern der Nukleonen, die den experimentellen Grenzen widersprechen, weshalb als intermediäre Symmetriegruppe ausscheidet. Im folgenden ist ; der Higgs-Inhalt des Modells wird später aus den Anforderungen des Ansatzes für die Massenmatrizen unter Berücksichtigung der Resultate in Abschnitt 4.1.1 bestimmt.
4.2 Schwellenkorrekturen
In diesem Abschnitt wird auf den Ursprung der Schwellenkorrekturen und deren Effekte auf die Bestimmung von Symmetriebrechungsskalen eingegangen.
Wird eine auf der Gruppe beruhende Eichsymmetrie bei einer Skala spontan in die zur Untergruppe gehörige Symmetrie gebrochen, ist damit formal der Übergang von der vollen Eichtheorie zu einer bei Energien gültigen effektiven Theorie verbunden [66]. Diese effektive Niederenergie-Näherung erhält man durch Ausintegration der schweren Freiheitsgrade aus dem Wirkungsfunktional. Wenn die Felder bezeichnet, die zu Teilchen mit Massen der Größenordnung gehören, und für die auch unterhalb von masselosen Felder steht, erhält man die Wirkung der effektiven Theorie aus der ursprünglichen Wirkung durch Funktionalintegration über die schweren Felder:
| (4.14) |
Hierbei ist die Invarianz von unter -Transformationen zu fordern. Um die Integration in (4.14) ausführen zu können, muß in der Wirkung ein Eichfixierungsterm eingeführt werden. Nach der Ausintegration der schweren Felder verbleibt von jedoch ein Rest, der die -Eichinvarianz der neuen Wirkung verletzt. Dieses Problem kann durch eine Redefinition der Kopplungskonstanten und der Eichfelder in behoben werden. Als Konsequenz ändert sich die naive Anschlußbedingung in
| (4.15) |
wobei in erster Ordnung der Störungsrechung durch
| (4.16) | |||||
gegeben ist [64]. Hierbei ist die Darstellung von , nach welcher die im Rahmen der Symmetriebrechung massiv gewordenen Eichbosonen von transformieren. Weiterhin steht für die -Darstellungen, in denen die Fermionen beziehungsweise Higgs-Teilchen mit Massen liegen; ist der Dynkin-Index dieser Darstellungen (siehe Tabelle A.1). Der Operator projeziert die Goldstone-Bosonen aus dem Higgs-Spektrum heraus. hat seinen physikalischen Ursprung in den Strahlungskorrekturen zum Propagator der Eichbosonen der effektiven Theorie durch die schweren Teilchen.
In der Analyse des letzten Abschnitts wurde bei den Anschlußbedingungen lediglich der erste, nicht von den Massen abhängige, Term von in abgewandelter Form benutzt. Das entspricht der üblicherweise gemachten Annahme, daß die durch Symmetriebrechung bei einer Skala erzeugten Teilchenmassen sich nur minimal von unterscheiden und die logarithmischen Terme vernachlässigt werden können.
Hier soll nun der Einfluß der zu den Skalaren gehörigen logarithmischen Terme auf die Bestimmung der Werte der Symmetriebrechungsskalen und untersucht werden, wenn man für die Argumente der Logarithmen einen Wertebereich von 0.1 bis 10 zuläßt. Das ist angesichts der Komplexität des Higgs-Potentials in Modellen mit nichtminimalem Higgs-Inhalt und der damit verbundenen großen Anzahl unbekannter Koeffizienten der Größenordnung 1 durchaus plausibel. Das Verfahren lehnt sich an [67] an, wo dies für -Modelle mit minimalem Higgs-Inhalt durchgeführt wurde. Beiträge durch Fermionen gibt es bei nicht, da die rechtshändigen Neutrinos als einzige schwere Teilchen SM-Singuletts sind. Die Eichbosonbeiträge werden vernachlässigt, da der Higgs-Inhalt der Theorie deutlich umfangreicher als der Eichboson-Inhalt ist.
Die für die Berechnung der -Koeffizienten erforderlichen Dynkin-Indizes der einzelnen Higgs-Darstellungen sind in Tabelle A.1 angegeben. Mit ihrer Hilfe lassen sich die für das hier diskutierte Modell bestimmen; Anhang A.4 enthält alle relevanten Resultate. Der Einfluß der Schwellenkorrekturen auf die Vorhersagen von wird durch folgende Beziehungen beschrieben [65]:
| (4.17) | |||||
| (4.18) |
Die Größen und sind Linearkombinationen der führenden Koeffizienten der Eichkopplungs--Funktionen
| (4.19) | |||||
| (4.20) | |||||
| (4.21) | |||||
| (4.22) |
und können Anhang B entnommen werden, und sind als
| (4.23) | |||||
| (4.24) |
definiert. Dabei ist als Summe der Beiträge der einzelnen Higgs-Darstellungen zu verstehen.
Um daraus quantitative Resultate zu erhalten, sei an dieser Stelle das Higgs-Spektrum des noch zu konstruierenden Massenmodells vorweggenommen. Es wird sich abgesehen von und zu ergeben, woraus sich für die durch Schwelleneffekte verursachten Unsicherheiten in den Vorhersagen für
| (4.25) | |||||
| (4.26) | |||||
ergibt. steht für () beziehungsweise (), wobei vereinfachend davon ausgegangen wird, daß alle Teilchen in einer Darstellung , welche ihre Massen durch den Symmetriebrechungsschritt bei erhalten, dieselbe Masse haben. Läßt man nun, wie oben angekündigt, für die Werte zwischen und zu, erhält man folgende Maximalbeträge für :
| (4.27) | |||||
| (4.28) |
Demnach können die Schwellenkorrekturen im vorliegenden Fall aufgrund ihres Einflusses auf die Anschlußbedingungen gemäß (4.15) den Wert von um einen Faktor und den von um einen Faktor modifizieren.
Obwohl hier lediglich eine Abschätzung des Maximaleffekts durchgeführt wurde, sollte bei den Angaben über die Werte von Symmetriebrechungsskalen der mögliche Einfluß der unbekannten Higgs-Massen nicht vergessen werden.
4.3 Der Ansatz für die Massenmatrizen
Im Rahmen des SM ist die Form der fermionischen Massenmatrizen in keiner Weise eingeschränkt. Es besteht aber allgemein die Überzeugung, daß eine fundamentalere Theorie als das SM existiert, welche auch den Fermionsektor einschließlich der Struktur der Massenmatrizen erklären kann. In Ermangelung einer solchen Theorie ist bis heute eine Vielzahl von phänomenologisch motivierten Ansätzen für die Massenmatrizen vorgeschlagen worden. Sie zeichnen sich durch bestimmte Symmetrieeigenschaften wie zum Beispiel Hermitezität und sogenannte Texturen, das heißt Nullen als Matrixeinträge an bestimmten Stellen, aus. Der Grundgedanke besteht darin, die Anzahl der freien Parameter in den Matrizen kleiner als die Zahl der zu reproduzierenden observablen Massen und Mischungen zu machen, um Vorhersagen über Beziehungen zwischen diesen Größen zu erhalten und somit möglicherweise etwas über die Eigenschaften der zugrundeliegenden Theorie zu erfahren.
Der wohl populärste dieser Ansätze geht auf Fritzsch zurück [68] und basiert auf zwei Annahmen: Die Quark-Massenmatrizen sind hermitesch und haben die „Nearest Neighbour Interaction“ (NNI)-Form. Letzteres bedeutet, daß nur das schwerste Fermion einer Art seine Masse direkt über die Yukawakopplung erhält; die Massen der leichten Teilchen kommen durch Wechselwirkungen respektive Mischungen mit ihren nächsten Nachbarn in der Massenmatrix zustande. Für zwei und drei Generationen haben die Matrizen demnach folgende Gestalt:
| (4.29) |
Wendet man den Fritzsch-Ansatz auf die Quark-Massenmatrizen im Falle zweier Generationen an, erhält man für den Cabibbo-Winkel die mit sehr gute Vorhersage
| (4.30) |
Ferner läßt sich mit auch die Massenhierarchie erklären.
Problematisch ist der Ansatz jedoch für drei Fermiongenerationen, da es keine Lösungen gibt, welche gleichzeitig die große -Quarkmasse und den kleinen Wert für das CKM-Matrixelement realisieren können [69]. Daran ändert sich auch nichts, wenn man den Fritzsch-Ansatz in eine -GUT ohne [70] oder mit Supersymmetrie [71] einbettet.
Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, könnte darin bestehen, hermitesche Massenmatrizen mit einer anderen Struktur als (4.29) zu verwenden. In [72] ist eine systematische Analyse aller Kombinationen von hermiteschen Quark-Massenmatrizen mit insgesamt unabhängigen Null-Einträgen durchgeführt worden, aber auch dort sind keine wirklich überzeugenden Lösungen gefunden worden.
Es deutet also einiges darauf hin, daß ein phänomenologisch erfolgreiches Massenmodell nichthermitesche Matrizen enthalten muß. Hier hat sich das Interesse auf supersymmetrische GUTs konzentriert, wobei zur Massenerzeugung häufig von nichtrenormierbaren Operatoren Gebrauch gemacht wird, welche aus einer noch fundamentaleren Theorie stammen sollen; [73] bietet einen Überblick über solche Ansätze in SUSY-GUTs.
Modelle mit nichthermiteschen Massenmatrizen, welche die NNI-Form besitzen, haben im Rahmen supersymmetrischer - [74] und -Theorien [75] vergleichsweise gute Resultate auch im Neutrinosektor geliefert. Daß ein solcher Ansatz auch in einem -Modell ohne Supersymmetrie erfolgreich sein kann, wird in dieser Arbeit gezeigt werden. Ein früherer Versuch in dieser Richtung war aufgrund der zu einfachen Struktur des verwendeten Higgs-Spektrums (eine und eine ) gescheitert [76].
Ein weiteres Argument zugunsten nichthermitescher NNI-Matrizen liefert [77]. Dort ist gezeigt worden, daß ein NNI-Ansatz für die Quark-Massenmatrizen im SM keine physikalischen Konsequenzen beinhaltet, sofern die Zahl der Fermiongenerationen nicht größer als vier ist. Im SM kann man beide Matrizen unabhängig von deren Ausgangsgestalt durch Transformationen auf NNI-Form bringen, ohne daß sich observable Größen ändern. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, daß von den vier Mischungsmatrizen im Quarksektor und aus (1.29) nur die Kombination physikalisch relevant ist; insbesondere die rechtshändigen Mischungen sind experimentell nicht beobachtbar. Es handelt sich beim NNI-Ansatz im SM also streng genommen nicht um einen Ansatz, sondern um eine spezielle Wahl der Basis im Raum der schwachen Eigenzustände. Wird der NNI-Ansatz jedoch in Theorien jenseits des SM eingebettet, ergeben sich daraus direkte Konsequenzen, die zumindest prinzipiell im Experiment überprüft werden können. So beeinflussen alle Mischungsmatrizen in (1.29) die Verzweigungsraten der Nukleonenzerfälle, und Beziehungen wie (2.35-2.40) liefern Eigenschaften des Neutrinosektors aus den Massenmatrizen der geladenen Fermionen.
Ausgangspunkt der nun folgenden Überlegungen wird die Annahme sein, daß die NNI-Form der Dirac-Massenmatrizen aus den Symmetrieeigenschaften einer wirklich grundlegenden Theorie der Elementarteilchen folgt. Diese nicht näher bekannte Theorie soll als Niederenergie-Näherung eine nichtsupersymmetrische -GUT besitzen, welche wiederum über eine intermediäre -Symmetrie in das SM gebrochen wird. Für die fermionischen Massenmatrizen wird bei Skalen der Ansatz
| (4.31) |
gemacht, wobei der Einfachheit halber nur reelle Einträge betrachtet werden. Das hat auf die Nukleonenzerfälle und Neutrinoeigenschaften, welche die zentralen Gegenstände der Untersuchung darstellen, keine nennenswerten Auswirkungen; lediglich auf das Problem der -Verletzung kann nicht eingegangen werden. Es sollte jedoch keine Schwierigkeiten bereiten, mit Hilfe komplexer Yukawa-Kopplungen die beobachtete -Verletzung zu reproduzieren.
Eine gängige Methode, bestimmte Texturen in den Massenmatrizen zu realisieren, besteht darin, eine globale -Familiensymmetrie zusätzlich zur Eichsymmetrie zu verwenden [78]. Die drei -Fermiondarstellungen transformieren sich dann gemäß , wobei der Generationsindex ist und die paarweise verschiedenen Ladungen bezüglich der bezeichnet. Besitzt nun eine Higgs-Darstellung oder das -Transformationsverhalten , so sind nur solche Yukawa-Terme -invariant, welche die Bedingung erfüllen. Da die Einträge der Massenmatrizen gemäß
| (4.32) |
bestimmte -Ladungen besitzen, kann man die NNI-Form realisieren, indem nur Higgs-Darstellungen mit den Ladungen und verwendet werden. Dabei ist es möglich, zu wählen, was die Anzahl der benötigten Darstellungen weiter reduziert. Die -Familiensymmetrie wird bei spontan gebrochen, da dort die massenerzeugenden Higgs-Darstellungen und selbst massiv werden. Unterhalb von werden aufgrund von Renormierungseffekten im allgemeinen auch die Einträge ungleich Null sein, welche gemäß (4.31) verschwinden.
Für die Yukawa-Kopplungsmatrizen kommen dann bei Skalen unter Verwendung der Bezeichnungsweisen in Tabelle 2.3 folgende Möglichkeiten in Frage:
| (4.33) |
Das Higgs-Spektrum des Modells soll genau eine 126 enthalten, welche die Symmetriebrechung bei realisiert. Mehr als eine 126 zu verwenden ist nicht verboten, aber unnötig und würde die Vorhersagekraft insbesondere im Neutrinosektor beträchtlich reduzieren. Damit der See-Saw-Mechanismus gemäß (2.51) anwendbar ist, muß die Majorana-Massenmatrix der rechtshändigen Neutrinos (2.39) invertierbar sein. Aus diesem Grunde ist die Kopplung der 126 durch aus (4.33) bestimmt.
Um die Asymmetrie gemäß (4.31) erzeugen zu können, sind beide 120-Darstellungen mit den Kopplungsmatrizen und erforderlich. Übernimmt man auch beide möglichen 10-Darstellungen aus (4.33) in den Higgs-Inhalt des Modells und beteiligt sämtliche - und -Komponenten an der Massenerzeugung der Fermionen bei , das heißt gibt ihnen Massen , so erhält man . Für diesen Fall findet gemäß der Analyse in Abschnitt 4.1.1 keine Vereinheitlichung statt, so daß eine der Massen der Größenordnung besitzen muß. Die Werte der Skalen und Kopplungen für den Fall und kann man Tabelle C.4 entnehmen; dabei erscheint GeV bezüglich der Konsequenz für die Lebensdauer des Protons sinnvoll zu sein. Um entscheiden zu können, welche der für die Massenerzeugung die geringste Bedeutung hat, werden zunächst die Massenmatrizen unter Verwendung der vier und drei konstruiert. Deren allgemeine Gestalt sieht analog zu (2.35-2.40) bei Energien dann folgendermaßen aus:
| (4.34) | |||||
| (4.35) | |||||
| (4.36) | |||||
| (4.37) | |||||
| (4.38) | |||||
| (4.39) |
Für die einzelnen nichtverschwindenden Matrixelemente gilt unter Verwendung von (4.33) dann:
| (4.40) | |||||
| (4.41) | |||||
| (4.42) | |||||
| (4.43) | |||||
| (4.44) | |||||
| (4.45) | |||||
| (4.46) | |||||
| (4.47) | |||||
| (4.48) | |||||
| (4.49) | |||||
| (4.50) | |||||
| (4.51) | |||||
| (4.52) | |||||
| (4.53) | |||||
| (4.54) | |||||
| (4.55) | |||||
| (4.56) | |||||
| (4.57) | |||||
| (4.58) | |||||
| (4.59) | |||||
Eine der nicht an der Massenerzeugung teilnehmen zu lassen ist gleichbedeutend mit der Tatsache, daß entweder , oder Null sein müssen. Wenn man bei fester Parameterzahl zunächst die größtmögliche Freiheit bezüglich der Gestalt der einzelnen Matrizen haben möchte, nämlich für alle und wählen zu können, führt das wegen der Gleichungen (4.45-4.49) und (4.55-4.59) zwangsläufig zu der Wahl .
Damit ist der Ansatz für die Massenmatrizen der Fermionen vollständig festgelegt. Alle Matrixeinträge setzen sich aus 14 voneinander unabhängigen freien -Higgs-Parametern in Form von Produkten aus Vakuumerwartungswerten und Yukawa-Kopplungen zusammen. Dazu kommt noch die Massenskala der schweren Neutrinos, welche über den See-Saw-Mechanismus (2.51) auch als Vorfaktor in der See-Saw-Matrix erscheint und somit die Beträge der leichten Neutrinomassen festlegt.
Dem stehen 18 zu reproduzierende observable Größen gegenüber, nämlich die 12 Quark- und Leptonmassen sowie jeweils drei Mischungswinkel in V und U. Meßbar sind, zumindest bisher, nicht die eigentlichen Massen der leichten Neutrinos, sondern über die Oszillationsexperimente nur die beiden Parameter und (siehe Kapitel 3). Dem entspricht in gewisser Weise die Tatsache, daß der Wert von im Rahmen von GUT-Massenmodellen mit See-Saw-Mechanismus aufgrund des zu komplizierten vollständigen Higgs-Potentials nicht exakt berechenbar ist. Wie schon in Abschnitt 2.3.3 erläutert wurde, läßt sich lediglich die qualitative Relation angeben, der genaue Wert von muß an die experimentellen Resultate angepaßt werden.
Es können demnach drei Vorhersagen gemacht werden, die im vorliegenden Fall alle im Neutrinosektor liegen. Allein aufgrund der Parameterzahl ist eine mögliche Erklärung der Anomalien von Sonnen- und atmosphärischen Neutrinos gemäß Abschnitt 3.2.4 als absolut nichttrivial zu betrachten. Die Zahl der freien Higgs-Parameter mag im Vergleich zu älteren Massenmodellen groß erscheinen; dafür werden in dem hier vorgeschlagenen Modell aber auch alle Massen der geladenen Fermionen sowie die CKM-Mischungswinkel bis auf Rundungsfehler korrekt wiedergegeben, während bisher Resultate vom tatsächlichen Wert schon als erfolgreich galten. Ferner wird zur Massenerzeugung auf keine Mechanismen zurückgegriffen, die, wie zum Beispiel nichtrenormierbare Operatoren, außerhalb der zugrundegelegten -Theorie liegen.
4.4 Numerische Lösung des Massenmodells
Ausgangspunkt für den ersten Schritt in der numerischen Bestimmung der Massenmatrizen und Mischungen ist das Gleichungssystem
| (4.60) |
welches, um die -Beziehungen (4.34-4.39) ausnutzen zu können, bei gelöst werden muß. Auf den rechten Seiten der Gleichungen stehen dann die physikalischen Fermionmassen und die CKM-Matrix bei . Bekannt sind deren Werte zunächst nur bei (siehe (1.33) und Tabelle 1.6). Um mit Hilfe der Renormierungsgruppengleichungen des SM aus Anhang B.1 trotz Unkenntnis der Massenmatrizen bei die entsprechenden Werte bei zu erhalten, werden zwei vereinfachende Annahmen gemacht:
-
•
Die Skalenabhängigkeit der CKM-Matrix V ist sehr klein. Das ist in [79] bestätigt worden.
-
•
Die Teilchenmassen bei sind in guter Näherung unabhängig von der expliziten Form der Massenmatrizen bei . Das ist zumindest dann korrekt, wenn sehr viel größer als alle anderen Einträge in ist.
Inwieweit obige Annahmen im vorliegenden Fall berechtigt sind, wird sich später zeigen, wenn die Renormierungsgruppengleichungen der dann bekannten Yukawa-Matrizen von nach integriert und diese bei diagonalisiert werden.
Nun kann man die Yukawa-Matrizen bei diagonal ansetzen und die Gleichungen (B.7-B.17) nach GeV integrieren; die Resultate sind in Tabelle 4.1 zusammengefaßt.
| Größe: | |||
|---|---|---|---|
| Wert: | MeV | MeV | MeV |
| Größe: | |||
| Wert: | MeV | MeV | GeV |
| Größe: | |||
| Wert: | keV | MeV | MeV |
In die Berechnungen geht auch die experimentell nicht bekannte Higgs-Selbstkopplung ein, welche in niedrigster Ordnung über
| (4.61) |
mit der Masse des SM-Higgs-Bosons zusammenhängt. Es muß also eine Annahme für gemacht werden, wobei sich zeigt, daß ein sinnvoller Wert zu sein scheint. Für führt die Integration von (B.7-B.17) nämlich auf , während für der Wert von größer als 1 wird, was die Anwendbarkeit der Störungsrechnung gefährdet; dieses Phänomen ist in [13] erwähnt worden. würde in führender Ordnung einer Higgs-Masse von GeV entsprechen, was mit den experimentellen Grenzen in [12] vereinbar ist.
Damit sind die Matrizen auf den rechten Seiten von (4.60) bestimmt. Auf den linken Seiten stehen 31 unbekannte Größen:
-
•
In den drei Massenmatrizen () die 14 -Higgs-Parameter aus (4.40-4.54). Es sind jedoch nur 13 voneinander unabhängig, da zwei lediglich in der Kombination vorkommen; um und separat bestimmen zu können, muß die Dirac-Massenmatrix der Neutrinos bekannt sein. Dies wird aber erst nach dem nächsten Schritt der Fall sein.
-
•
Gemäß der Parametrisierung (1.34) jeweils drei Winkel () in den sechs Mischungsmatrizen, also insgesamt 18 Mischungswinkel.
Dem stehen 30 nichtlineare Bestimmungsgleichungen gegenüber, jeweils neun aus den ersten drei Beziehungen von (4.60) und drei unabhängige Gleichungen aus der letzten. Um das Problem numerisch behandeln zu können, muß also einer der freien Parameter vorgegeben werden. Hierfür wird der Quotient ausgewählt, welcher die Form der Majorana-Matrix (4.38) bis auf einen Vorfaktor eindeutig festlegt:
| (4.62) |
Als möglicher Wertebereich für erscheint aufgrund der Massenhierarchie der Fermionen plausibel. Bevor jedoch die Lösungen und ihre Eigenschaften behandelt werden, sei an dieser Stelle auf die Bedeutung der -spezifischen Beziehungen (4.34-4.37) hingewiesen.
Wie man an (4.40-4.49) erkennt, sind bei bekanntem in noch drei Freiheitsgrade enthalten, nämlich , und . Da die Leptonmassen sich auch bei deutlich von den Massen der -Quarks unterscheiden, müssen diese Parameter derart festgelegt werden, daß die korrekten Teilchenmassen liefert. Dann sind die -Higgs-Parameter im --Sektor eindeutig bestimmt:
| (4.63) | |||||
| (4.64) | |||||
| (4.65) | |||||
| (4.66) | |||||
| (4.67) | |||||
| (4.68) | |||||
| (4.69) | |||||
| (4.70) | |||||
| (4.71) | |||||
| (4.72) | |||||
| (4.73) | |||||
| (4.74) |
Ist nun auch bekannt, enthält die Dirac-Massenmatrix der Neutrinos gemäß (4.50-4.59) relativ zu nur noch den Freiheitsgrad , da aus dem --Sektor bestimmt ist. Auch ist durch die Kenntnis von bereits eindeutig festgelegt, wie die zweite der folgenden Gleichungen zeigt:
| (4.75) | |||||
| (4.76) | |||||
| (4.77) | |||||
| (4.78) | |||||
| (4.79) | |||||
| (4.80) |
| (4.81) | |||||
| (4.82) |
Anders ausgedrückt, wenn man einen Wert für vorgibt und Lösungen für die Massenmatrizen der geladenen Fermionen findet, welche (4.60) erfüllen, so ist der Neutrinosektor der Theorie bis auf die beiden Parameter und eindeutig festgelegt. Das wiederum deutet schon den zweiten Schritt der Analyse an, nämlich die Suche nach Werten für und , welche eine Oszillationslösung für die Anomalien der Sonnen- und atmosphärischen Neutrinos gemäß 3.2.4 ermöglichen.
Die Suche nach Lösungen von (4.60) für vorgegebene Werte von mit liefert folgende Resultate:
-
•
Für und können keine Lösungen gefunden werden.
-
•
Für existieren Lösungen. Es gibt bei gegebenem bis zu sechs (bei ) verschiedene Sätze von Quark-Massenmatrizen und zu jedem dieser Paare jeweils zwei Möglichkeiten für die Massenmatrix der geladenen Leptonen, welche (4.60) erfüllen. Letzteres resultiert aus der Tatsache, daß es zu jeder Matrix zwei Werte des Parameters gibt, welche die korrekten Leptonmassen liefern; der Parameter dagegen ist in beiden Fällen gleich groß.
Es werden nur ganzzahlige Werte für untersucht, da die Lösungen, sofern sie existieren, stetig von abhängen. Man erhält mit dem Ansatz (4.34-4.39) für die Massenmatrizen demnach eine Vielzahl von Lösungen für die Matrizen der geladenen Fermionen, welche die beobachteten Massen und CKM-Mischungen liefern. Nun muß der Neutrinosektor in die Analyse mit einbezogen werden.
Es verbleiben zwei Parameter, welche aus den nun bekannten Massenmatrizen der geladenen Fermionen gemäß den Beziehungen (4.63-4.82) nicht berechnet werden können, nämlich und . Ersterer kann im Rahmen des Massenmodells nicht exakt vorhergesagt werden, sondern muß am Ende an die Resultate der Oszillationsexperimente angepaßt werden, wobei gelten sollte. Bei vorgegebenem ist demnach der einzige noch freie Parameter in der Dirac-Massenmatrix der Neutrinos; die Majorana-Matrix ist bis auf den globalen Vorfaktor festgelegt. Die Aufgabe besteht also darin, zu untersuchen, ob für diejenigen Werte von , welche Lösungen von (4.60) liefern, der Parameter so gewählt werden kann, daß die Massen und Mischungen der leichten Neutrinos phänomenologisch sinnvoll sind, das heißt den experimentellen Grenzen in (3.20-3.33) genügen. Da das Fermionspektrum des Modells drei Neutrino-Arten enthält, können durch Oszillationslösungen zwei der drei in Kapitel 3 diskutierten Neutrinoprobleme erklärt werden; das sollen aufgrund der im Vergleich zu den LSND-Resultaten deutlich stärkeren Evidenz die Anomalien der Sonnen- und atmosphärischen Neutrinos sein. Wegen der Argumentation in Abschnitt 3.2.1 wird für das Sonnen-Neutrinodefizit nur der MSW-Effekt berücksichtigt.
Konkret sieht die Vorgehensweise wie folgt aus:
-
•
Für festes wird der gesamte plausibel erscheinende Wertebereich für untersucht. Im folgenden wird gewählt.
-
•
Bei gegebenem -Wert werden die Dirac-, Majorana- und See-Saw-Massenmatrizen der Neutrinos bestimmt; letztere wird gemäß (2.53) diagonalisiert.
-
•
Auf diese Weise erhält man die Massen der leichten Neutrinos bis auf den Vorfaktor , es wird sowie und angenommen. Die leptonische Mischungsmatrix ist damit ebenfalls bekannt.
- •
Es zeigt sich, daß drei Bereiche im --Parameterraum existieren, in denen Lösungen von (4.60) liegen, welche zudem im Neutrinosektor die Forderungen (4.83-4.86) erfüllen. Die Abbildungen 4.1, 4.2 und 4.3 zeigen die Lage der entsprechenden Parameterbereiche, wobei zu jedem untersuchten ganzzahligen -Wert die Minimal- und Maximalwerte von angegeben sind, die zu Neutrinoeigenschaften führen, welche den Einschränkungen (4.83-4.86) genügen. Ein Bereich liefert MSW-Lösungen für das Sonnen-Neutrinodefizit mit großem Mischungswinkel, die anderen beiden Bereiche liefern MSW-Lösungen mit kleiner Mischung.
Aus jedem der drei Bereiche wird nun eine repräsentative Lösung ausgewählt, die genauer untersucht werden soll. Deren Werte für und werden so gewählt, daß die zugehörigen Punkte ungefähr in der Mitte der erlaubten Parameterbereiche liegen, da sowohl die bestehenden als auch die neu hinzukommenden Neutrinoexperimente die Grenzen in (3.20-3.33) weiter einschränken werden. Tabelle 4.2 faßt die Parameterwerte für die drei Beispielmodelle zusammen.
| Lösung | MSW-Effekt | (MeV) | |
|---|---|---|---|
| Modell 1 | große Mischung | ||
| Modell 2a | kleine Mischung | ||
| Modell 2b | kleine Mischung |
Die numerischen Resultate für die untersuchten Beispielmodelle sind in Anhang D zusammengefaßt. Zunächst gibt Abschnitt D.1 Auskunft über die nichtverschwindenden Einträge aller Massenmatrizen sowie die Fermionmassen und -mischungen bei . Daraus lassen sich mit Hilfe von (4.63-4.82) die Werte der -Higgs-Parameter berechnen; die Resultate enthält Abschnitt D.2. Um die Werte dieser Größen bei zu erhalten, müssen die Renormierungsgruppengleichungen (B.7-B.20) des SM einschließlich derjenigen für die See-Saw-Massenmatrix von nach integriert werden. Dabei werden auch die Matrixeinträge ungleich Null, die bei wegen des Ansatzes (4.31) verschwinden. Die Elemente der Massenmatrizen der geladenen Fermionen und leichten Neutrinos sowie deren Massen und Mischungen bei sind in Abschnitt D.3 aufgelistet. Insbesondere die Mischungswinkel werden bei der Berechnung der Nukleonzerfallsraten im nächsten Kapitel von großer Bedeutung sein. Aus ihnen lassen sich auch die CKM-Matrix V und die leptonische Mischungsmatrix U bestimmen; die Ergebnisse für die drei betrachteten Modelle enthält Abschnitt D.4.
Obwohl die Massenmatrizen in den einzelnen Fällen durchaus verschieden sind, lassen sich folgende gemeinsame Eigenschaften der Lösungen feststellen:
-
•
Die Winkel der CKM-Matrix in der hier für alle Mischungsmatrizen verwendeten Parametrisierung (1.34) sind mit , und angesetzt worden, was innerhalb der experimentellen Grenzen liegt. Es zeigt sich, daß die linkshändigen Mischungswinkel der Quarks und betragsmäßig zum Teil deutlich größer als die CKM-Winkel sind. Besonders auffällig ist das im Fall von . Demnach kann man von der Größe der observablen CKM-Winkel nicht zwangsläufig auf die der linkshändigen Quarkmischungen schließen, wie es häufig getan wird.
-
•
Alle Modelle enthalten betragsmäßig große Mischungswinkel mit Beträgen zwischen und ; so ist zum Beispiel in allen Fällen sehr groß. Große rechtshändige Mischungen sind insofern von besonderem Interesse, als sie im Rahmen des SM keine experimentell beobachtbaren Auswirkungen haben, in GUT-Modellen wie dem vorliegenden aber durchaus relevant sind. Unter anderem hängen die Verzweigungsraten der Nukleonenzerfälle stark von den Fermionmischungen ab, wie man im nächsten Kapitel sehen wird.
-
•
In den Lösungen ist und somit betragsmäßig deutlich größer als alle übrigen Matrixeinträge, und dagegen sind in beziehungsweise nicht allein dominant. Die -- und --Asymmetrien in den Massenmatrizen sind in allen Fällen stark ausgeprägt.
-
•
Die zu Beginn des Abschnitts gemachten Annahmen über die Skalenabhängigkeit der Fermionmassen und CKM-Mischungen sind gerechtfertigt. Alle Werte für die Massen bei , welche die drei Modelle durch Integration der Renormierungsgruppengleichungen liefern, ergeben sich abgesehen von Rundungsfehlern in sehr guter Übereinstimmung mit den ursprünglich angesetzten experimentellen Größen. Auch die aus den Lösungen numerisch bestimmten CKM-Matrizen genügen den experimentellen Grenzen. Lediglich die Skalenabhängigkeit von und ist nicht völlig zu vernachlässigen; es gilt und . Das wiederum führt innerhalb der Grenzen zu vergleichsweise großen Werten für , während und betragsmäßig am unteren Ende des erlaubten Bereichs liegen. Man könnte diese Schwäche jedoch ohne weiteres beheben, indem man die nun bekannte Skalenabhängigkeit auf den rechten Seiten von (4.60) berücksichtigt. Da die Effekte aber sehr klein sind, wird hier darauf verzichtet.
Die drei untersuchten Beispiellösungen beschreiben den Sektor der geladenen Fermionen in sehr guter Übereinstimmung mit den experimentellen Resultaten für die Massen und Mischungen. Das ist jedoch lediglich ein notwendiges Kriterium dafür, daß der Ansatz (4.31) als sinnvoll zu betrachten ist. Auf die Neutrinoeigenschaften der einzelnen Lösungen, welche die eigentlichen Vorhersagen des Massenmodells darstellen, wird im nächsten Abschnitt eingegangen.
Die in diesem Kapitel verwendeten numerischen Algorithmen sind im wesentlichen [80] entnommen. Zur Integration der Renormierungsgruppengleichungen wurde eine auf der Runge-Kutta-Methode vierter Ordnung basierende Routine mit adaptiver Schrittweitensteuerung benutzt. Dabei wird der durch die endliche Schrittweite erzeugte Fehler abgeschätzt und unterhalb einer vorzugebenden Schranke gehalten. Diese Schranke wurde so festgelegt, daß die Fehler aufgrund der Integration deutlich kleiner als die experimentellen Unsicherheiten sind. In den -Funktionskoeffizienten zweiter Ordnung der Yukawa-Matrizen und der Higgs-Kopplung wurde die Näherung benutzt, nur die betragsmäßig größten Einträge der Yukawa-Matrizen zu verwenden und alle übrigen auf Null zu setzen.
Die Diagonalisierung der Massenmatrizen gemäß (1.29) entspricht der numerischen Lösung eines nichtlinearen Gleichungssystems und wurde mit Hilfe der multidimensionalen Newton-Raphson-Methode durchgeführt.
4.5 Eigenschaften der leichten Neutrinos
Die Massen und Mischungen der leichten Neutrinos bei sind in Tabelle 4.3 zusammengefaßt, welche einen Ausschnitt aus Tabelle D.4 darstellt.
| Parameter | Wert in Modell 1 | Wert in Modell 2a | Wert in Modell 2b |
|---|---|---|---|
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
Da sich die Massen der geladenen Leptonen zwischen und kaum ändern, kann man das in noch stärkerem Maße von den Neutrinomassen erwarten, da die Neutrinos nur schwach wechselwirken. Vergleicht man die Tabellen D.4 einerseits und D.1 sowie D.2 andererseits, so erkennt man, daß die Mischungswinkel aller Fermionen zwischen und nur minimal skalenabhängig sind. Im folgenden wird deshalb von ausgegangen.
In Tabelle 4.3 erkennt man zunächst die starke Ähnlichkeit der Eigenschaften von Modell 2a und 2b. Beide realisieren eine Oszillationslösung des Sonnen-Neutrinodefizits über den MSW-Effekt mit kleinen Mischungen, während Modell 1 auf den MSW-Effekt mit großer Mischung führt. Von den linkshändigen Mischungen der geladenen Leptonen ist lediglich in Modell 1 betragsmäßig deutlich größer als Null. In den anderen beiden Fällen kommt die große (23)-Mischung in U, welche die Anomalie der atmosphärischen Neutrinos erklärt, allein durch die reine Neutrinomischung zustande.
Für waren aufgrund der experimentellen Grenzen Werte zwischen 50 und 1000 zugelassen worden. Hier fällt auf, daß der Wert in Modell 1 nahe an der oberen Schranke ist, während die Resultate in den Modellen 2a,b deutlich im unteren Teil des erlaubten Bereichs liegen. Dem steht die durch Abbildung 3.1(a) begründete Erwartung gegenüber, bei festem für den MSW-Effekt mit großer Mischung den im Vergleich zum MSW-Effekt mit kleiner Mischung kleineren Wert für zu finden.
Tabelle 4.4 gibt die Werte von und an, welche benötigt werden, um die erhaltenen Vorhersagen für und an die experimentellen Grenzen für und aus (3.20-3.33) anzupassen.
| Größe | Wert in Modell 1 | Wert in Modell 2a | Wert in Modell 2b |
|---|---|---|---|
| (GeV) | |||
| (GeV) | |||
| (eV) | |||
| (eV) | |||
| (eV) | |||
| (eV2) | |||
| (eV2) |
Sie sind angesichts der erwarteten Relation vergleichsweise groß, da als Yukawa-Kopplung sein sollte. Andererseits ist auch keineswegs ausgeschlossen, da der exakte Wert von von zahlreichen Parametern im nicht explizit bekannten Higgs-Potential abhängt. Diese sollten zwar von der Größenordnung 1 sein, aber es ist durchaus möglich, daß der Proportionalitätskoeffizient in aus einer nichttrivialen Kombination der Parameter besteht und im Bereich bis liegt. Überdies ist in Abschnitt 4.2 eine Unsicherheit in aufgrund von Schwelleneffekten berechnet worden. Die Vernachlässigung der massenabhängigen Schwellenkorrekturen bei der Bestimmung von in Abschnitt 4.1 könnte somit theoretisch zu einem um zwei Größenordnungen zu kleinen Wert geführt haben. Eine Kombination dieser beiden Möglichkeiten ist demnach definitiv in der Lage, zu realisieren.
Wie schon weiter oben erwähnt wurde, liegen im Modell 1 die Werte für im unteren Teil des für zulässigen Bereichs, während jene für im Rahmen der experimentellen Grenzen von relativ groß sind. In den Modellen 2a,b beobachtet man ein gegenteiliges Verhalten dieser Größen.
Vergleicht man die Modellvorhersagen für die leptonische Mischungsmatrix U (siehe Anhang D.4) mit den Grenzen aus (3.20-3.33), so erkennt man eine gute Übereinstimmung zwischen beiden; alle Einträge von U liegen innerhalb der erlaubten Bereiche. Auffällig ist bei allen drei Modellen die Tatsache, daß die (23)-Mischung in U vergleichsweise klein ist. Insbesondere in Modell 1 ist nahe an der unteren Schranke 0.49, während die -Werte in den Modellen 2a,b ( beziehungsweise ) etwas größer sind. Da die existierenden ebenso wie die neu hinzukommenden Neutrinoexperimente die Grenzen in (3.20-3.33) weiter einschränken werden, ist Modell 1 in diesem Sinne weniger überzeugend als die anderen beiden. Das hier vorgeschlagene -Massenmodell deutet also auf eine MSW-Lösung mit kleiner Mischung hin. Sollte der MSW-Effekt mit kleiner Mischung durch Experimente eindeutig als Ursache für das Defizit der Sonnen-Neutrinos bestätigt werden, wird es schwierig sein, eines der Modelle 2a und 2b anhand der Eigenschaften im Neutrinosektor als in der Natur realisiert zu identifizieren. Dazu muß man auf die Vorhersagen bezüglich der Nukleonzerfallsraten zurückgreifen, welche im nächsten Kapitel berechnet werden.
Die Existenz von leichten Majorana-Neutrinos hat eine weitere überprüfbare Konsequenz, nämlich die sogenannten neutrinolosen doppelten -Zerfälle. Sie kommen durch den Austausch eines Majorana-Neutrinos zwischen zwei zerfallenden Neutronen zustande, was zu Kernreaktionen der Form führt. Die experimentelle Nichtbeobachtung solcher Prozesse liefert die Einschränkung [81]:
| (4.87) |
Alle hier untersuchten Lösungen erfüllen diese Bedingung.
4.6 Baryonasymmetrie durch Neutrinozerfälle
Obwohl nicht Gegenstand dieser Arbeit, soll hier kurz auf die Möglichkeit hingewiesen werden, die Baryonasymmetrie des Universums im Rahmen einer -GUT mit See-Saw-Mechanismus durch den Zerfall der schweren Majorana-Neutrinos zu erklären. Einen aktuellen Überblick zu diesem Thema liefert [15].
Das beobachtete Universum scheint wesentlich mehr Materie als Antimaterie zu enthalten. Wenn , und die mittleren Teilchenzahldichten der Baryonen, Antibaryonen und Photonen im Universum bezeichnen, ergibt sich für die Größe aus kosmologischen Überlegungen der Wert [15, 82]. Wenn man davon ausgeht, daß bei der Entstehung des Universums Null war, so kann die Kosmologie die heute beobachtete Baryonasymmetrie nicht erklären. Dazu muß auf die Physik der Elementarteilchen zurückgegriffen werden.
Wie in [83] gezeigt wurde, sind für die Entstehung der Baryonasymmetrie in einem ursprünglich symmetrischen Universum drei notwendige Kriterien zu erfüllen, nämlich die Existenz baryonzahlverletzender Wechselwirkungen, die Verletzung von und sowie das Vorhandensein eines thermischen Ungleichgewichts. Die Baryonzahlverletzung ist naheliegenderweise notwendig, um zu ermöglichen, und ist sowohl in - als auch -Modellen enthalten; lediglich die Kombination ist Teil der Eichsymmetrie und somit eine Erhaltungsgröße. - und -Verletzung sind erforderlich, da sich zeigen läßt, daß andernfalls die Rate der Prozesse, welche Baryonen erzeugen, genauso groß wie die der antibaryonerzeugenden Prozesse ist. Während die Eichboson- und Fermionsektoren von -GUTs - und -invariant sind, lassen sich diese Symmetrien durch Einführung komplexer Higgs-Kopplungen explizit brechen. Schließlich ist ein thermisches Ungleichgewicht erforderlich, da der Baryonzahloperator bei einer Temperatur im Gleichgewicht den Erwartungswert
| (4.88) | |||||
besitzt, vorausgesetzt, die Theorie ist -invariant. Ob sich ein System im thermischen Gleichgewicht befindet, läßt sich nur durch Lösung seiner Boltzmann-Gleichungen feststellen. In erster Näherung kann man aber sagen, daß ein Ungleichgewicht vorliegt, wenn die Expansionsrate des Universums größer als die Raten der baryon- und leptonzahlverletzenden Wechselwirkungen ist. Das sollte bei Temperaturen der Fall sein.
Somit ist im vorliegenden -Modell die Entstehung einer -Asymmetrie bei Energien möglich. Allerdings existieren auch im SM baryon- und leptonzahlverletzende Prozesse, welche erhalten und auf nichtperturbativen Effekten beruhen. Während nämlich die klassische Lagrangedichte des SM invariant unter globalen -Symmetrien ist, besitzen die zu diesen Symmetrien gehörenden Ströme in der quantisierten Theorie Anomalien [84]. Das führt zu -verletzenden Prozessen, welche bei durch einen Faktor unterdrückt sind und vernachlässigt werden können. Bei Temperaturen GeV GeV jedoch sind sie in Gegenwart von statischen topologischen Feldkonfigurationen, den sogenannten Sphaleronen, stark genug, um eine vorhandene -Asymmetrie vollständig auszuwaschen [85]. Andererseits sind sie in der Lage, eine bereits vorhandene -Asymmetrie teilweise in eine -Asymmetrie gemäß
| (4.89) |
umzuwandeln.
Nun erhalten im Rahmen der -Symmetriebrechung bei die schweren Neutrinos ihre Massen. Aufgrund ihrer Majorana-Natur können sie über leptonzahlverletzende Prozesse
| (4.90) |
sowohl in Leptonen als auch in Antileptonen zerfallen; bezeichnet ein Higgs-Teilchen. Die notwendige -Verletzung wird durch komplexe Kopplungen zwischen , und realisiert. Auf diese Weise erhält man eine reine Lepton- und somit eine -Asymmetrie, die gemäß (4.89) in die beobachtete Baryonasymmetrie des Universums konvertiert werden kann [86]. Damit die leptonzahlverletzenden Zerfälle der schweren Neutrinos im erforderlichen thermischen Ungleichgewicht stattfinden, muß die zugehörige Zerfallsrate kleiner als die Expansionsrate des Universums bei dieser Temperatur sein. Das läßt sich qualitativ als Bedingung
| (4.91) |
für die Massen der leichten Neutrinos schreiben, wobei Min GeV ist [87]. Im hier untersuchten Massenmodell ist (4.91) offensichtlich erfüllt.
Kapitel 5 Zerfallsraten der Nukleonen
Wie in Kapitel 2 dargestellt wurde, gehört die Instabilität der Nukleonen zu den bemerkenswertesten Vorhersagen von GUTs. Die Bestimmung der partiellen und totalen Zerfallsraten im Rahmen des hier untersuchten -Massenmodells wird Gegenstand dieses Kapitels sein. Dazu sind zwei wesentliche Schritte notwendig:
-
•
Zunächst muß die vollständige effektive Lagrangedichte der durch Eichbosonaustausch vermittelten Nukleonenzerfälle in der Basis der Masseneigenzustände bestimmt werden. Das geschieht analog zur Herleitung der Lagrangedichte der Fermi-Theorie aus jener der elektroschwachen Wechselwirkung.
-
•
Weiterhin muß man die hadronischen Übergangsmatrixelemente berechnen. Hierzu sind in der Vergangenheit das nichtrelativistische Quark-Modell [88, 89, 90], das Bag-Modell [91] und die chirale Störungsrechnung [92] verwendet worden. Ursprüngliche Diskrepanzen zwischen den Resultaten der chiralen Störungsrechnung und denen der Quark-Modelle sind in [93] beseitigt worden; [94] gibt eine Übersicht über die mit den verschiedenen Verfahren erzielten Ergebnisse. In dieser Arbeit wird analog zu [89] und [90] vorgegangen.
Prinzipiell existieren auch Nukleonzerfallsprozesse aufgrund von Higgs-Austausch. Diese sind aber selbst dann vernachlässigbar, wenn das Higgs-Teilchen eine Masse der Größenordnung hat, da die Übergangswahrscheinlichkeit proportional zur vierten Potenz der sehr kleinen Yukawa-Kopplungen an die drei leichten Quarks ist.
5.1 Die effektive Lagrangedichte
Ausgangspunkt ist der baryonzahlverletzende Anteil der -Lagrangedichte (2.27). Verallgemeinert man ihn auf drei Fermiongenerationen und ersetzt die Wechselwirkungs- durch die Masseneigenzustände analog zu (1.30), kann man die vollständige effektive Lagrangedichte der Vier-Fermion-Wechselwirkungen berechnen, welche die eichbosonvermittelten Nukleonenzerfälle beschreibt. Für den Fall zweier Generationen ist das in [95] durchgeführt worden. Unter Benutzung der Fierz-Identitäten
| (5.1) | |||||
| (5.2) |
erhält man als Resultat:
| (5.3) | |||||
| ( Terme mit zwei -Quarks ) | |||||
| ( Terme mit - ,- und -Quarks ) | |||||
| ( Terme mit und ) | |||||
| ( h.c. ) |
Die -Koeffizienten sind in Anhang E.1 aufgeführt und hängen außer von den Eichbosonmassen und , für welche angenommen wird, von und den Elementen der fermionischen Mischungsmatrizen , , und ab. Diese Größen sind bereits im vorigen Kapitel bestimmt worden, so daß alle bekannt sind. hat keinen Einfluß auf die , da sie die Massenmatrix der schweren Neutrinos diagonalisiert, welche als Zerfallsprodukte der Nukleonen nicht vorkommen. An dieser Stelle wird klar, warum die Fermionmischungen für die Verzweigungsraten der Nukleonenzerfälle von großer Bedeutung sind.
5.2 Hadronische Übergangsmatrixelemente
Die hier verwendete Methode zur Berechnung der Übergangsmatrixelemente entspricht dem sogenannten „recoil“-Modell in [89]. Grundlage ist ein Quark-Modell mit -Spin-Flavour-Symmetrie; die Quarks treten in drei Flavours , und sowie zwei Spinzuständen und auf. Alle sechs unabhängigen Quarkzustände haben dieselbe Masse , was eine einheitliche Masse für die Mesonen zur Folge hat. Die -Symmetrie wird später bei der Berechnung der Zerfallsraten durch einen Phasenraumfaktor explizit gebrochen.
Es wird in einem Bezugssystem gearbeitet, in dem das Nukleon, bevor es zerfällt, im Ursprung des Systems in Ruhe ist. Die Spineinstellungen beziehungsweise werden relativ zur -Achse angegeben. Der Zerfall führt stets auf ein Antilepton, welches sich in positive -Richtung bewegt, während das Meson einen Rückstoß in Richtung der negativen -Achse erhält. Das entstehende Antilepton wird als relativistisch angenommen und es gilt und .
Die Vorgehensweise zur Berechnung der Matrixelemente soll kurz am Beispiel von erläutert werden, für Details sei auf [89] verwiesen. Aufgrund der Drehimpulserhaltung läßt sich die Übergangswahrscheinlichkeit zunächst gemäß
| (5.4) |
zerlegen. Eine weitere Zerlegung ist möglich, indem der Zustand durch den Spin-, Flavour- und Farbanteil seiner Wellenfunktion ausgedrückt wird:
| (5.5) |
Dadurch ergeben sich die Matrixelemente der für den Zerfall relevanten Elementarprozesse:
| , | |||||
| , | (5.6) |
Die Matrixelemente mit im Endzustand erhält man analog. Auch das Proton kann gemäß
| (5.7) |
in seine Spin-, Flavour- und Farbanteile zerlegt werden. Die Ortsanteile der Wellenfunktionen werden später berücksichtigt, da sie in guter Näherung für alle Zerfallsprozesse gleich groß sind. Die Spin-Flavour-Anteile der Mesonwellenfunktionen können in Anhang E.2 gefunden werden.
Weiterhin identifiziert man die für die Bestimmung von (5.4) relevanten Terme in als
-
•
für
-
•
für
Im nächsten Schritt werden nun alle Quark- und Antiquarkfelder sowohl in den Zustandsfunktionen und als auch in den Lagrangedichtetermen in Form von Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren sowie Dirac-Spinoren u und v ausgedrückt. Für ein Quark beziehungsweise Antiquark erhält man auf diese Weise
| (5.8) |
wobei der Operator ein -Quark vernichtet und der Operator ein -Antiquark erzeugt; die Spinoren u und v mit
| (5.9) |
sind in [96] definiert. Man erhält auf diese Weise umfangreiche Ausdrücke für die Größen in (5.6), welche sich jedoch beträchtlich vereinfachen, wenn man unter Ausnutzung der Antikommutator-Eigenschaften
| (5.10) | |||
| (5.11) | |||
| (5.12) |
die Vernichtungsoperatoren auf den Vakuumzustand und die Erzeugungsoperatoren auf den Zustand wirken läßt und dadurch für die meisten Terme Null erhält. In den nichtverschwindenden Beiträgen verbleiben die Spinor-Amplituden, welche noch berechnet werden müssen.
Im „recoil“-Modell wird vom Übergang zweier statischer Quarks derselben Masse in ein relativistisches Antilepton und ein Antiquark, welches einen Rückstoßimpuls mit besitzt, ausgegangen. Die Spinoren der Antileptonen sind demnach durch
| , | (5.13) |
und die der statischen Quarks durch
| (5.14) |
gegeben. Die nichtstatischen Antiquarks im Endzustand werden durch die Spinoren
| , | |||||
| , | (5.15) |
beschrieben. Nun lassen sich die Spinor-Amplituden bestimmen; Tabelle 5.1 enthält alle nichtverschwindenden Amplituden und deren Werte.
| Amplitude | |||
|---|---|---|---|
| Wert | |||
| Amplitude | |||
| Wert |
Die Amplituden zu den Zerfällen mit linkshändigen Antileptonen im Endzustand erhält man durch Ersetzen von mit und Vertauschen von und .
Damit kann man die Matrixelemente (5.6) berechnen, und aus diesen lassen sich unter Berücksichtigung der Spin-Flavour-Struktur (5.5) des Mesons wiederum die Übergangswahrscheinlichkeiten in (5.4) bestimmen. Analog verfährt man für alle relevanten Zerfallskanäle; die Tabelle E.4 gibt die Resultate für die Amplituden der elementaren Zerfallsprozesse an, während Tabelle E.5 die Übergangswahrscheinlichkeiten für die Zerfälle mit physikalischen Endzuständen beinhaltet. Zu beachten ist die Tatsache, daß die Amplituden der einzelnen Elementarprozesse von unterschiedlichen -Koeffizienten gemäß (5.3) begleitet werden.
5.3 Berechnung der Zerfallsraten
Für die partielle Zerfallsrate eines bestimmten Prozesses gilt die Beziehung
| (5.16) |
welche man aus der allgemeinen Bestimmungsgleichung für in Zwei-Teilchen-Zerfällen unter Berücksichtigung der spezifischen Annahmen des „recoil“-Modells erhält. (5.16) ist äquivalent zu der in [90] gegebenen Gleichung für und unterscheidet sich von dieser lediglich darin, daß der Phasenraumfaktor und die Übergangsmatrixelemente aus [89] verwendet wurden, welche direkt proportional zu den in [90] benutzten sind. Weiterhin ist in (5.16) die Abhängigkeit von und den Eichbosonmassen in den Koeffizienten aus (5.3) enthalten. Die verschiedenen Größen in (5.16) sind wie folgt definiert:
-
•
und sind die für den jeweiligen Zerfallsprozeß relevanten hadronischen Übergangsmatrixelemente, wobei sich die Indizes und auf die Chiralität des Antileptons im Endzustand beziehen. Die Summation berücksichtigt die Tatsache, daß für einige Zerfälle zwei Lagrangedichteterme verantwortlich sind. Die Bestimmung der Matrixelemente war Gegenstand des letzten Abschnitts.
-
•
und sind die zu beziehungsweise gehörenden Koeffizienten aus der effektiven Lagrangedichte. Gemäß (5.3) treten alle Matrixelemente der elementaren Zerfallsprozesse in Kombination mit einem bestimmten -Koeffizient auf. Tabelle E.5 gibt die Werte für die unabhängigen an; alle dort nicht explizit aufgeführten Größen lassen sich durch Symmetrieüberlegungen aus diesen herleiten.
-
•
und sind Faktoren, welche aus der Renormierung der Vier-Fermion-Operatoren in der effektiven Lagrangedichte resultieren. Während nämlich die Berechnung der hadronischen Matrixelemente für Energieskalen durchgeführt wird, ist die eigentliche baryonzahlverletzende Wechselwirkung bei Skalen wirksam. Das führt zu Renormierungseffekten, welche auf Strahlungskorrekturen zu den Vier-Fermion-Operatoren durch die - und SM-Eichbosonen beruhen. Eine formale Analyse dieses Phänomens im Rahmen einer -GUT ist in [97] zu finden, während [98] die Renormierungseffekte für den Fall einer -Theorie untersucht. Für das in dieser Arbeit untersuchte Modell sind die Faktoren durch
(5.17) (5.18) (5.19) gegeben. In die Exponenten gehen die anomalen Dimensionen der Vier-Fermion-Operatoren und die führenden Koeffizienten der jeweiligen Eichkopplungs--Funktionen ein. Die Eichkopplungen bei sind in Tabelle C.1 zu finden, diejenigen bei und wurden im vorigen Kapitel bestimmt; Anhang C.2 enthält die numerischen Resultate. Die Werte von bei Energien sind [99] entnommen:
(5.20) Der Einfluß der Skalenabhängigkeit von wird vernachlässigt, da er viel kleiner als der von ist (, ). Unter Verwendung aller Kopplungswerte erhält man
(5.21) -
•
steht für die Wahrscheinlichkeit, zwei Valenzquarks des Nukleons in einem Raumpunkt zu finden. Das ist erforderlich, damit der Elementarprozeß stattfinden kann, da die zugrundeliegende Wechselwirkung extrem kurzreichweitig ist. ist der Raumanteil der Wellenfunktion des Nukleons. Der räumliche Anteil der Mesonwellenfunktion wird wie in [90] vernachlässigt; die Spin-, Flavour- und Farbanteile der Wellenfunktionen sind bereits in die Berechnung von eingegangen. Für wird der Wert 0.012 GeV3 verwendet [100].
-
•
mit ist ein Phasenraumfaktor, welcher die -Spin-Flavour-Symmetrie des im letzten Abschnitt verwendeten Quarkmodells explizit bricht. Er berücksichtigt die in der Natur existierenden unterschiedlichen Massen der Mesonen in den Endzuständen der Zerfallsprozesse und ihren Einfluß auf die Raten. Tabelle E.3 enthält die relevanten Werte von und .
Damit sind alle Größen in (5.16) bekannt und die partiellen sowie totalen Zerfallsraten der Nukleonen können berechnet werden. Sämtliche Resultate sowohl für die untersuchten Modelle als auch für den Fall verschwindender Fermionmischungen sind in den Tabellen E.7-E.10 im Anhang zusammengefaßt.
Man erkennt die generelle Tendenz, daß der Einfluß der Mischungen zu einer deutlichen Unterdrückung des Zerfallskanals führt, während die Kanäle und im Vergleich zum Fall verschwindender Mischungen bevorzugt werden. Besonders auffällig ist das bei den Zerfällen , und . Insofern unterscheiden sich die Verzweigungsraten zum Teil beträchtlich von denen nichtsupersymmetrischer GUT-Modelle mit kleinen Mischungen, welche eine deutliche Dominanz von -Zerfällen vorhersagen. SUSY-GUTs dagegen bevorzugen Zerfälle mit -Mesonen im Endzustand [94].
Zwischen den Verzweigungsraten der drei analysierten Modelle bestehen teilweise deutlich ausgeprägte Unterschiede, was man auch an den in Tabelle 5.2 dargestellten Verhältnissen partieller Raten erkennen kann.
| Größe | ohne Mischungen | Modell 1 | Modell 2a | Modell 2b |
| 0 | 0.145 | 0.104 | 0.162 | |
| 0 | 3.27 | 6.33 | 3.11 | |
| 0.003 | 0.098 | 0.064 | 0.157 | |
| 1.040 | 0.618 | 0.693 | 0.993 | |
| 0 | 0.394 | 0.225 | 0.200 | |
| 0 | 0.387 | 0.225 | 0.195 | |
| 0.113 | 0.469 | 0.347 | 0.722 | |
| 4.16 | 2.48 | 2.78 | 3.96 |
Während die Modelle 2a und 2b anhand ihrer Eigenschaften im Neutrinosektor praktisch nicht unterscheidbar waren, zeigen sich in ihren Verzweigungsraten Differenzen, welche durchaus experimentell zugänglich sein sollten, sofern in Zukunft Nukleonenzerfälle beobachtet werden. Die totalen Zerfallsraten der einzelnen Modelle sind nahezu gleich und führen zu Lebensdauern im Bereich von Jahren.
Die in den Tabellen E.7-E.10 dargelegten Resultate dieser Untersuchung sind echte Vorhersagen des verwendeten -Massenmodells und verdeutlichen auf eindrucksvolle Weise den Einfluß der Fermionmischungen auf die Verzweigungsraten der Nukleonenzerfälle.
Bei allen Rechnungen ist stets mit den Mittelwerten der verwendeten Größen gearbeitet worden, ohne deren Fehler explizit zu berücksichtigen. Das ist insofern begründet, als die Hauptquellen der auftretenden Unsicherheiten in den Einflüssen der Schwellenkorrekturen und den modellspezifischen Näherungen bei der Bestimmung der hadronischen Matrixelemente zu sehen sind. Gerade diese sind aber im Gegensatz zu den bekannten Meßungenauigkeiten in den SM-Kopplungen und den Fermionmassen und -mischungen nur schwer abzuschätzen. Für die Schwelleneffekte und deren Einluß auf die Werte der Symmetriebrechungsskalen ist das in Abschnitt 4.2 versucht worden, während [101] die Auswirkung der Unsicherheit in den Übergangsmatrixelementen auf die Lebensdauer des Protons mit einem Faktor ansetzt. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, daß die Effekte dieser Unsicherheiten in erster Linie die totalen Zerfallsraten beeinflussen, die Verzweigungsraten dagegen deutlich weniger betreffen. Letztere stellen aber die wirklich relevanten Vorhersagen des Massenmodells dar.
5.4 Experimenteller Status
Es bleibt zu prüfen, ob die im letzten Abschnitt gemachten Vorhersagen bezüglich der partiellen und totalen Zerfallsraten der Nukleonen mit den experimentellen Grenzen für diese Größen verträglich sind.
Die Experimente, welche nach Nukleonenzerfällen suchen, lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Wasser-Čerenkovdetektoren wie IMB 3 [102] und Kamiokande beziehungsweise Super-Kamiokande [103] sind besonders zum Nachweis von geeignet, während die Eisenkalorimeter-Spurdetektoren wie Fréjus [104] und Soudan 2 [105] für Zerfälle mit -Mesonen und im Endzustand sensitiv sind. Keines der Experimente hat bis heute eindeutige Hinweise auf die Instabilität der Nukleonen liefern können, so daß lediglich obere Grenzen für die Zerfallsraten existieren.
| Zerfallsprozeß | Super-Kamiokande [35] | Part. Data Group 1998 [7] |
|---|---|---|
| 29 | 5.5 | |
| 11 | 1.4 | |
| 23 | 2.7 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 7.8 | 0.69 | |
| 6.8 | 1.0 | |
| 5.6 | 0.54 |
Die in [7] angegebenen Werte für diese Grenzen sind in Tabelle E.6 aufgeführt, seitdem veröffentlichte Resultate von Super-Kamiokande zeigt Tabelle 5.3. Der Vergleich mit den Modellvorhersagen in den Tabellen E.7-E.10 führt zu dem Schluß, daß diese mit allen experimentellen Grenzen verträglich sind.
Die Grenzwerte für die Lebensdauern bezüglich bestimmter Zerfallsprozesse wie zum Beispiel erreichen gemäß Tabelle 5.3 bereits den Bereich einiger Jahre, was lediglich eine Größenordnung unter den in dieser Arbeit gemachten Vorhersagen liegt. Letztere werden also in absehbarer Zeit direkt überprüfbar sein, da Super-Kamiokande weiterhin Daten aufnimmt und Experimente wie das auf einem Detektor aus flüssigem Argon basierende ICARUS [106] neu hinzukommen werden.
Zusammenfassung und Ausblick
Gegenstand dieser Untersuchung war ein Modell für die fermionischen Massenmatrizen auf der Grundlage einer -Theorie, welche über eine intermediäre Pati-Salam-Symmetrie in das Standardmodell gebrochen wird. Der gewählte Ansatz bestand in einer asymmetrischen „Nearest Neighbour Interaction“-Form der Matrizen, die durch eine globale -Familiensymmetrie realisiert wird. Dieser beinhaltet im Rahmen des Standardmodells keine physikalischen Konsequenzen, da die rechtshändigen Mischungen dort nicht beobachtbar sind. In Theorien jenseits des Standardmodells jedoch haben alle Fermionmischungen beträchtlichen Einfluß auf observable Größen wie die Zerfallsraten der Nukleonen.
Nach der systematischen Bestimmung der Symmetriebrechungsskalen und Eichkopplungen in Abhängigkeit vom Teilcheninhalt des Modells sowie einer Abschätzung der Schwelleneffekte wurden die Massenmatrizen unter Berücksichtigung der -spezifischen Beziehungen zwischen diesen konstruiert. Anschließend sind alle Lösungen des Modells numerisch bestimmt worden, welche neben den bekannten Parametern im Sektor der geladenen Fermionen auch phänomenologisch sinnvolle Neutrinoeigenschaften liefern. Es wurden insgesamt drei Lösungen des Modells gefunden, welche in der Lage sind, die Anomalien der Sonnen- und atmosphärischen Neutrinos durch Oszillationen zu erklären. Zwei davon deuten auf eine Lösung des Sonnen-Neutrinoproblems durch den MSW-Effekt mit kleiner Mischung hin, während die dritte den MSW-Effekt mit großer Mischung beinhaltet. Bemerkenswert ist, daß alle Lösungen auf leptonische (23)-Mischungen führen, die im Rahmen des zur Erklärung der Anomalie atmosphärischer Neutrinos erlaubten Parameterbereichs vergleichsweise klein sind. Da die (23)-Mischung desjenigen Modells, welches den MSW-Effekt mit großer Mischung realisiert, nahe an der unteren Grenze des zulässigen Bereichs liegt und letzterer durch die Oszillationsexperimente in naher Zukunft weiter eingeschränkt werden wird, sind die anderen beiden Lösungen als realistischer zu betrachten. Im Rahmen des hier analysierten Massenmodells erscheint eine Lösung des Sonnen-Neutrinoproblems durch den MSW-Effekt mit kleiner Mischung als wahrscheinlich.
Alle gefundenen Lösungen besitzen mehrere betragsmäßig große Mischungen im Sektor der geladenen Fermionen. Dabei handelt es sich sowohl um im Standardmodell nicht observable rechtshändige als auch um linkshändige Mischungswinkel. Demnach kann man von der Größe der CKM-Winkel nicht zwangsläufig auf die der linkshändigen Fermionmischungen schließen, wie es häufig getan wird. Die teilweise großen Mischungen führen zu charakteristischen Verzweigungsraten der Nukleonenzerfälle, welche von denen bei verschwindenden Mischungen deutlich abweichen. Generell läßt sich eine Unterdrückung der Kanäle mit im Endzustand feststellen, während Kanäle mit und bevorzugt werden. Die drei Lösungen sind aufgrund ihrer Vorhersagen für die Verzweigungsraten auch untereinander unterscheidbar. Die berechneten Lebensdauern der Nukleonen betragen Jahre, was je nach Zerfallskanal lediglich ein bis zwei Größenordnungen über den experimentellen Grenzen liegt. Damit sind die Modellvorhersagen in absehbarer Zeit direkt überprüfbar.
Der Einfachheit halber sind alle Massenmatrizen als reell angenommen worden, da das Problem der -Verletzung nicht Gegenstand der Arbeit war. Abgesehen von der Standardmethode, die -Verletzung über komplexe Yukawa-Kopplungen zu realisieren, bieten Grand Unified-Theorien aufgrund ihres erweiterten Eichboson- und Higgs-Sektors dafür verschiedene weitere Möglichkeiten [107].
Weiterhin wurde auf die Verwendung von Supersymmetrie verzichtet, da supersymmetrische Theorien wegen des wesentlich umfangreicheren Teilchenspektrums zahlreiche zusätzliche Parameter enthalten, deren Werte weitgehend unbestimmt sind. Das hat naturgemäß negative Auswirkungen auf die Vorhersagekraft der Modelle. Auch eine für die Anwendbarkeit des See-Saw-Mechanismus vorteilhafte intermediäre Skala im Bereich GeV ist in supersymmetrischen Theorien nicht auf natürliche Weise realisierbar, da sich die Eichkopplungen des supersymmetrischen Standardmodells im Gegensatz zum nichtsupersymmetrischen Fall genau in einem Punkt treffen. Die Abwesenheit jeglicher experimenteller Hinweise auf eine bei Energien im TeV-Bereich gebrochene Supersymmetrie in der Natur [108] ist ein weiterer Schwachpunkt, mit dem supersymmetrische Theorien bisher behaftet sind. Schließlich deutet auch die Existenz nichtsupersymmetrischer Niederenergie-Vakua in der M-Theorie [109] darauf hin, daß Supersymmetrie keine zwingende Eigenschaft von Theorien jenseits des Standardmodells ist.
Trotz dieser Schwächen im phänomenologischen Bereich ist die Supersymmetrie ein formal überaus ansprechendes Konzept, und es wäre interessant, das hier diskutierte Massenmodell in eine supersymmetrische Grand Unified-Theorie einzubetten und die daraus resultierenden Konsequenzen zu untersuchen. Auch eine Analyse des Modells hinsichtlich seiner Möglichkeiten zur Erklärung der -Verletzung und der Baryonasymmetrie des Universums wäre sicherlich sinnvoll.
Auf die generellen Probleme von nichtsupersymmetrischen Grand Unified-Theorien wurde in Kapitel 2 eingegangen. Das Hierarchieproblem und die Nichtberücksichtigung der Gravitation sind wohl die fundamentalsten Schwachpunkte dieser Modelle. Das Hierarchieproblem kann ebenso wie das Problem der Divergenzen zumindest prinzipiell durch eine bei Energien von etwa 1 TeV gebrochene globale Supersymmetrie gelöst werden. Bei solchen Modellen stellt sich aber die Frage, auf welche Weise die Supersymmetrie gebrochen wird. Sowohl die spontane Brechung als auch die explizite Brechung durch Lagrangedichteterme deuten letztendlich auf eine noch fundamentalere Theorie hin. Ein Kandidat für eine solche ist die Supergravitationstheorie, welche auf einer lokalen Supersymmetrie basiert und die Gravitationswechselwirkung mit einschließt. Auf Supergravitation basierende Modelle sind allerdings nicht renormierbar und können wiederum nur effektive Näherungen einer grundlegenden Theorie sein. Den zur Zeit zweifellos populärsten und vielleicht sogar einzigen ernstzunehmenden Ansatz dafür stellen die Superstringtheorien und das übergeordnete Modell der M-Theorie dar. Sie werden in zehn beziehungsweise elf Raumzeitdimensionen formuliert, was eine Kompaktifizierung der überzähligen Dimensionen notwendig macht, um vierdimensionale effektive Theorien und möglicherweise überprüfbare Voraussagen erhalten zu können. In der äußerst eingeschränkten Vorhersagekraft für den Bereich experimentell zugänglicher Energien besteht die Schwäche dieser Modelle.
Es ist bis heute keine wirklich fundamentale Theorie bekannt, welche die Eigenschaften der Fermionen erklärt. Aus diesem Grunde kommt der Untersuchung effektiver Massenmodelle nach wie vor große Bedeutung zu, da sie vielleicht einen Hinweis auf die zugrundeliegende Symmetrie der Natur liefern.
Anhang A Gruppentheoretischer Anhang
Die in diesem Anhang zusammengefaßten Eigenschaften ausgewählter irreduzibler Darstellungen sind den Tabellen in [26] entnommen; dort wird ferner eine detaillierte Beschreibung des für Anwendungen in der Elementarteilchenphysik relevanten gruppentheoretischen Formalismus gegeben.
A.1 Casimir-Operator und Dynkin-Index
Die Generatoren einer Lie-Algebra erfüllen unabhängig von der expliziten Darstellung die Vertauschungsrelationen
| (A.1) |
wobei die die Strukturkonstanten der Algebra sind. Der quadratische Casimir-Operator kommutiert mit allen Generatoren und ist somit bezüglich jeder irreduziblen Darstellung der Liegruppe ein Vielfaches der Einheitsmatrix; der zugehörige Eigenwert wird mit bezeichnet:
| (A.2) |
Der Dynkin-Index einer irreduziblen Darstellung ist über
| (A.3) |
definiert. Zwischen und gilt die Beziehung
| (A.4) |
wobei die Dimension von bezeichnet; steht für die adjungierte Darstellung von . Für die -Gruppen gelten die Normierungen und , während für die und ist.
In der folgenden Tabelle sind und einiger irreduzibler Darstellungen verschiedener Lie-Gruppen aufgelistet.
| 10 | 1 | 9/2 | 4 | 1/2 | 15/8 | 3 | 1/2 | 4/3 |
| 16 | 2 | 45/8 | 6 | 1 | 5/2 | 6 | 5/2 | 10/3 |
| 45 | 8 | 8 | 10 | 3 | 9/2 | 8 | 3 | 3 |
| 54 | 12 | 10 | 15 | 4 | 4 | 10 | 15/2 | 6 |
| 120 | 28 | 21/2 | 20 | 13/2 | 39/8 | 15 | 10 | 16/3 |
| 126 | 35 | 25/2 | 20’ | 8 | 6 | |||
| 144 | 34 | 85/8 | ||||||
| 210 | 56 | 12 | ||||||
| 210’ | 77 | 33/2 |
A.2 Verzweigungsregeln für -Darstellungen
| (A.5) | |||||
| (A.6) | |||||
| (A.7) | |||||
| (A.8) | |||||
| (A.9) | |||||
| (A.10) | |||||
| (A.11) | |||||
A.3 Verzweigungsregeln für -Darstellungen
| (A.12) | |||||
| (A.13) | |||||
| (A.14) | |||||
| (A.15) | |||||
| (A.16) |
A.4 Schwellenkorrektur-Koeffizienten
Hier ist zu berücksichtigen, daß die -Darstellungen 210 und 54 als reell, die an der Massenerzeugung beteiligten Darstellungen 10, 120 und 126 dagegen als komplex angenommen werden. Hat die Darstellung einer Produktgruppe die Gestalt , so sind die zugehörigen Schwellenkorrektur-Koeffizienten durch
| (A.17) |
gegeben. Bei komplexen Darstellungen kommt noch ein Faktor 2 hinzu.
Für die Berechnung der ist die korrekte GUT-Normierung der Hyperladung verwendet worden, was die -Faktoren erklärt.
| -Darstellung | -Darstellung | |
|---|---|---|
| 210 | (1,1,1) | (0,0,0) |
| (15,1,1) | (4,0,0) | |
| (6,2,2) | (4,6,6) | |
| (15,3,1) | (12,30,0) | |
| (15,1,3) | (12,0,30) | |
| (10,2,2) | (12,10,10) | |
| (,2,2) | (12,10,10) | |
| 54 | (1,1,1) | (0,0,0) |
| (1,3,3) | (0,6,6) | |
| (20’,1,1) | (8,0,0) | |
| (6,2,2) | (4,6,6) | |
| 126 | (6,1,1) | (2,0,0) |
| (,3,1) | (18,40,0) | |
| (10,1,3) | (18,0,40) | |
| (15,2,2) | (32,30,30) | |
| 120 | (1,2,2) | (0,2,2) |
| (10,1,1) | (6,0,0) | |
| (,1,1) | (6,0,0) | |
| (6,3,1) | (6,24,0) | |
| (6,1,3) | (6,0,24) | |
| (15,2,2) | (32,30,30) | |
| 10 | (1,2,2) | (0,2,2) |
| (6,1,1) | (2,0,0) |
| -Darstellung | -Darstellung | |
|---|---|---|
| (1,2,2) | (1,2,) | (0,1,3/5) |
| (1,2,) | (0,1,3/5) | |
| (15,2,2) | (1,2,) | (0,1,3/5) |
| (1,2,) | (0,1,3/5) | |
| (3,2,) | (2,3,49/5) | |
| (3,2,) | (2,3,1/5) | |
| (3̄,2,) | (2,3,1/5) | |
| (3̄,2,) | (2,3,49/5) | |
| (8,2,) | (12,8,24/5) | |
| (8,2,) | (12,8,24/5) | |
| (,3,1) | (1,3,) | (0,4,18/5) |
| (3̄,3,) | (3,12,6/5) | |
| (6̄,3,) | (15,24,12/5) | |
| (10,1,3) | (1,1,0) | (0,0,0) |
| (1,1,) | (0,0,6/5) | |
| (1,1,) | (0,0,24/5) | |
| (3,1,) | (1,0,8/5) | |
| (3,1,) | (1,0,2/5) | |
| (3,1,) | (1,0,32/5) | |
| (6,1,) | (5,0,64/5) | |
| (6,1,) | (5,0,4/5) | |
| (6,1,) | (5,0,16/5) |
Anhang B Renormierungsgruppengleichungen
In [110] sind allgemeine Ausdrücke für die Renormierungsgruppengleichungen von Quantenfeldtheorien in Zweischleifenordnung entwickelt worden, aus denen sich auch die hier verwendeten Gleichungen herleiten lassen. Die Renormierungsgruppengleichungen für das Standardmodell sind in [23] und die der See-Saw-Massenmatrix der Neutrinos in [111] ausführlich analysiert worden.
B.1 Standardmodell
Alle Gleichungen bis auf die der See-Saw-Massenmatrix sind in Zweischleifenordnung angegeben. Als Variable wird im folgenden verwendet, gibt die Anzahl der komplexen Higgs-Doubletts an (in dieser Arbeit wird stets angenommen). Die Definition der Yukawa-Kopplungsmatrizen lautet
| (B.1) |
wobei die skalenabhängigen fermionischen Massenmatrizen bezeichnet; ist der Vakuumerwartungswert des Higgs-Feldes. Desweiteren werden die nachfolgend aufgeführten Definitionen benutzt:
| (B.2) | |||||
| (B.3) | |||||
| (B.4) | |||||
| (B.5) | |||||
| (B.6) |
B.1.1 Renormierungsgruppengleichungen für die Eichkopplungen
| (B.7) | |||||
| (B.8) | |||||
| (B.9) | |||||
B.1.2 Renormierungsgruppengleichungen für die Yukawa-Matrizen
| (B.10) | |||||
| (B.11) | |||||
| (B.12) | |||||
| (B.13) | |||||
| (B.14) | |||||
| (B.15) | |||||
| (B.16) | |||||
B.1.3 Renormierungsgruppengleichung für die Higgs-Selbstkopplung
| (B.17) | |||||
| (B.18) | |||||
| (B.19) | |||||
B.1.4 Renormierungsgruppengleichung für die See-Saw-Massenmatrix
| (B.20) |
B.2 -Modell
Die Renormierungsgruppengleichungen für die Eichkopplungen hängen vom Higgs-Teilcheninhalt des betrachteten Modells ab, das heißt von Anzahl und Art der Darstellungen, in welchen Higgs-Teilchen mit Massen der Größenordnung liegen. Folgende Variablen spezifizieren diesen Teilcheninhalt:
Dann haben die Renormierungsgruppengleichungen für die Eichkopplungen in Zweischleifenordnung die folgende Gestalt, wobei Beiträge durch die Yukawakopplungen der Fermionen vernachlässigt werden:
| (B.21) | |||||
| (B.22) | |||||
| (B.23) | |||||
Anhang C Symmetriebrechungsskalen und Eichkopplungen
Die verwendeten Startwerte für die Integration der Renormierungsgruppengleichungen der Eichkopplungen sind in Tabelle C.1 zusammengefaßt.
| Größe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wert | 91.187 GeV |
C.1 -Modell
Wie in Abschnitt 4.1.2 erläutert wurde, hängen der Wert von und somit die Eichkopplungen bei nicht vom Teilcheninhalt des Modells zwischen und ab; Tabelle C.2 gibt die Werte dieser Größen an.
| Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | GeV |
Die vom Teilchenspektrum abhängigen Werte für und sind für die untersuchten Fälle in Tabelle C.3 aufgelistet.
| Größe | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| [GeV] | |||||
| Größe | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| [GeV] | |||||
| Größe | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| [GeV] | |||||
C.2 -Modell
Im Gegensatz zum -Modell hängen in Theorien mit als Symmetriegruppe auch und die Eichkopplungen bei der Skala vom Higgs-Spektrum ab. In Modellen mit und sowie und findet keine Vereinheitlichung statt, für die übrigen Fälle finden sich in Tabelle C.4 die Werte der relevanten Größen:
| Größe | Wert | Wert | Wert | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GeV | GeV | GeV | GeV | |
| GeV | GeV | GeV | GeV | |
| Größe | Wert | Wert | Wert |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | |
| GeV | GeV | GeV | |
| GeV | GeV | GeV | |
Anhang D Eigenschaften der untersuchten Lösungen
D.1 Massenmatrizen, Massen und Mischungswinkel bei
Tabelle D.1 gibt für die drei Beispielmodelle aus Abschnitt 4.4 die nichtverschwindenden Einträge der Massenmatrizen der geladenen Fermionen sowie deren Massen und Mischungswinkel bei an, wobei für die Mischungsmatrizen die Parametrisierung (1.34) benutzt wird. In Tabelle D.2 sind die nichtverschwindenden Elemente der Dirac-, Majorana- und See-Saw-Massenmatrizen sowie Massen und Mischungen der leichten Neutrinos zusammengefaßt.
| Parameter | Wert in Modell 1 | Wert in Modell 2a | Wert in Modell 2b |
|---|---|---|---|
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| Parameter | Wert in Modell 1 | Wert in Modell 2a | Wert in Modell 2b |
|---|---|---|---|
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| Parameter | Wert in Modell 1 | Wert in Modell 2a | Wert in Modell 2b |
|---|---|---|---|
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
D.2 -Higgs-Parameter bei
Tabelle D.3 faßt für die betrachteten Lösungen die numerischen Werte der -Higgs-Parameter aus (4.63-4.82) zusammen.
| Parameter | Wert in Modell 1 | Wert in Modell 2a | Wert in Modell 2b |
|---|---|---|---|
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
D.3 Massenmatrizen, Massen und Mischungswinkel bei
Tabelle D.4 gibt für die drei untersuchten Modelle die Einträge der Massenmatrizen der geladenen Fermionen und der leichten Neutrinos sowie deren Massen und Mischungswinkel bei an.
| Parameter | Wert in Modell 1 | Wert in Modell 2a | Wert in Modell 2b |
|---|---|---|---|
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| Parameter | Wert in Modell 1 | Wert in Modell 2a | Wert in Modell 2b |
|---|---|---|---|
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| MeV | MeV | MeV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
| eV | eV | eV | |
D.4 CKM-Matrix und leptonische Mischungsmatrix bei
Im folgenden werden die CKM-Matrix V und die leptonische Mischungsmatrix U für die in Abschnitt 4.4 analysierten Modelle angegeben.
Modell 1:
| (D.1) |
Modell 2a:
| (D.2) |
Modell 2b:
| (D.3) |
Anhang E Berechnung der Nukleonzerfallsraten
E.1 -Koeffizienten
In diesem Abschnitt wird die explizite Form der -Koeffizienten dargestellt, welche in der effektiven Lagrangedichte (5.3) für die Nukleonenzerfälle auftreten. Hierbei sind und , wobei angenommen wird.
E.2 Meson-Wellenfunktionen
Die Tabellen E.1 und E.2 geben die Spin-Flavour-Anteile der Wellenfunktionen für die pseudoskalaren beziehungsweise Vektormesonen an.
| Meson | Masse (MeV) | Spin | Wellenfunktion |
|---|---|---|---|
| 139.570 | 0 | ||
| 134.976 | 0 | ||
| 139.570 | 0 | ||
| 493.677 | 0 | ||
| 497.672 | 0 | ||
| 547.30 | 0 | ||
| Meson | Masse (MeV) | Spin | Wellenfunktion | |
|---|---|---|---|---|
| 770.0 | 1 | |||
| 770.0 | 1 | |||
| 770.0 | 1 | |||
| 770.0 | 1 | |||
| 770.0 | 1 | |||
| 770.0 | 1 | |||
| 770.0 | 1 | |||
| 770.0 | 1 | |||
| 770.0 | 1 | |||
| 781.94 | 1 | |||
| 781.94 | 1 | |||
| 781.94 | 1 | |||
| 891.66 | 1 | |||
| 891.66 | 1 | |||
| 891.66 | 1 | |||
| 896.1 | 1 | |||
| 896.1 | 1 | |||
| 896.1 | 1 |
E.3 Phasenraumfaktoren
Die Phasenraumfaktoren, welche die -Spin-Flavour-Symmetrie des in Abschnitt 5.2 verwendeten nichtrelativistischen Quark-Modells brechen, sind durch
| (E.1) |
gegeben, wobei der Quotient aus Mesonmasse und Masse des Protons beziehungsweise Neutrons ist ( MeV, MeV [7]). Tabelle E.3 gibt die entsprechenden Werte für die relevanten Mesonen an.
| Meson | Meson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.97889 | 0.97895 | 0.17842 | 0.18025 | ||
| 0.97739 | 0.97746 | 0.17842 | 0.18025 | ||
| 0.66774 | 0.66875 | 0.15812 | 0.15993 | ||
| 0.66178 | 0.66280 | 0.01787 | 0.01877 | ||
| 0.58338 | 0.58462 | 0.01476 | 0.01560 |
E.4 Übergangsamplituden
In diesem Abschnitt sind die Resultate für die hadronischen Übergangsamplituden und -wahrscheinlichkeiten der Nukleonenzerfälle zusammengefaßt. Tabelle E.4 zeigt die Amplituden der elementaren Zefallsprozesse des Protons und des Neutrons. Alle dort nicht aufgelisteten Amplituden lassen sich durch Symmetrieüberlegungen herleiten. So unterscheiden sich die Amplituden mit Antileptonen der zweiten und dritten Familie im Endzustand von denen mit und lediglich durch die Vorfaktoren ; diese lassen sich (5.3) entnehmen. Die Übergangsamplituden mit linkshändigen Antileptonen erhält man aus denjenigen mit rechtshändigen Antileptonen, indem man durch ersetzt und die Spineinstellungen und der Quarks vertauscht. Auch hier ändern sich lediglich die Vorfaktoren gemäß (5.3), die numerischen Werte der Amplituden in der dritten Spalte bleiben gleich. Tabelle E.5 listet die Übergangswahrscheinlichkeiten für Zerfallsprozesse mit physikalischen Teilchen in den Endzuständen auf.
| Zerfallsprozeß | Lagrangedichte-Term | Amplitude () | Vorfaktor |
|---|---|---|---|
| Zerfallsprozeß | Lagrangedichte-Term | Amplitude () | Vorfaktor |
|---|---|---|---|
| Zerfallsprozeß | Zerfallsprozeß | ||
|---|---|---|---|
E.5 Experimentelle Grenzen für die Nukleonzerfallsraten
Tabelle E.6 zeigt die in [7] angegebenen Untergrenzen für die inversen partiellen Zerfallsraten der Nukleonen aufgrund der experimentellen Nichtbeobachtung dieser Prozesse. Die aktuellsten Resultate des Super-Kamiokande-Experiments Nukleonenzerfälle betreffend sind in Tabelle 5.3 zu finden.
| Zerfallskanal | Zerfallskanal | ||
|---|---|---|---|
| 550 | 130 | ||
| 150 | 100 | ||
| 140 | 58 | ||
| 270 | 23 | ||
| 120 | 100 | ||
| 69 | 86 | ||
| 75 | 54 | ||
| 45 | 19 | ||
| 52 | 43 | ||
| 110 | 22 | ||
| 57 | |||
| 25 | |||
| 100 | |||
| 27 | |||
| 20 |
E.6 Zerfallsraten der Nukleonen
In diesem Abschnitt sind in den Tabellen E.7-E.10 die numerischen Resultate für die partiellen und totalen Nukleonzerfallsraten zusammengefaßt. Neben den Ergebnissen für die drei untersuchten Modelle ist zum Vergleich auch der Fall verschwindender Fermionmischungen berücksichtigt worden. Während die Einträge 0.0 für partielle Raten stehen, sind Zerfälle in die mit „—“ gekennzeichneten Kanäle in führender Ordnung nicht erlaubt. Es gilt sowie und weiterhin in natürlichen Einheiten () 1 GeV yr-1.
| Zerfallskanal | Raten in % | Raten in % | Raten in % | Raten in % |
|---|---|---|---|---|
| des Protons | (keine Mischungen) | in Modell 1 | in Modell 2a | in Modell 2b |
| 33.6 | 21.4 | 25.1 | 27.8 | |
| — | 3.1 | 2.6 | 4.5 | |
| 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| — | 8.5 | 5.7 | 5.6 | |
| 5.8 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | |
| — | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 5.1 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | |
| 16.9 | 10.8 | 12.7 | 14.0 | |
| — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| — | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |
| — | 4.3 | 2.9 | 2.8 | |
| 32.3 | 25.6 | 35.6 | 27.7 | |
| — | 2.0 | 2.0 | 4.1 | |
| — | 8.9 | 0.5 | 0.3 | |
| 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 4.9 | 3.9 | 5.4 | 4.2 | |
| — | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| — | 1.4 | 0.1 | 0.0 | |
| 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| — | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| — | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56.8 | 39.4 | 45.1 | 51.5 | |
| 5.8 | 17.0 | 10.6 | 11.2 | |
| 37.4 | 43.7 | 44.3 | 37.2 |
| Größe | Wert in Modell 1 | Wert in Modell 2a | Wert in Modell 2b |
|---|---|---|---|
| Zerfallskanal | Raten in % | Raten in % | Raten in % | Raten in % |
|---|---|---|---|---|
| des Neutrons | (keine Mischungen) | in Modell 1 | in Modell 2a | in Modell 2b |
| 62.9 | 40.1 | 46.2 | 49.9 | |
| — | 15.8 | 10.4 | 10.0 | |
| 9.7 | 6.2 | 7.1 | 7.7 | |
| — | 2.4 | 1.6 | 1.5 | |
| 15.1 | 12.0 | 16.4 | 12.5 | |
| — | 6.8 | 4.9 | 8.2 | |
| 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| — | 4.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 1.7 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | |
| — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | |
| 7.7 | 6.1 | 8.4 | 6.4 | |
| — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| — | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| — | 2.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| — | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |
| — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 72.6 | 46.3 | 53.3 | 57.6 | |
| — | 18.2 | 12.0 | 11.5 | |
| 27.4 | 35.3 | 34.7 | 31.0 |
| Größe | Wert in Modell 1 | Wert in Modell 2a | Wert in Modell 2b |
|---|---|---|---|
Literatur
- [1] S. Dimopoulos, L. J. Hall und S. Raby, Phys. Rev. Lett. 68 (1992) 1984.
- [2] W. N. Cottingham und D. A. Greenwood, An Introduction to the Standard Model of Particle Physics, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
- [3] D. Gross und F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. 30 (1973) 1343, Phys. Rev. D 8 (1973) 3633, Phys. Rev. D 9 (1974) 980; H. D. Politzer, Phys. Rev. Lett. 30 (1973) 1346, Phys. Rep. 14 C (1974) 129; H. Fritzsch, M. Gell-Mann und H. Leutwyler, Phys. Lett. 47 B (1973) 365.
- [4] S. L. Glashow, Nucl. Phys. 22 (1961) 579; A. Salam und J. C. Ward, Phys. Lett. 13 (1964) 168; S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. 19 (1967) 1264; A. Salam in Elementary Particle Theory, Hrsg. N. Svartholm, Almquist & Forlag, Stockholm 1968.
- [5] G. ’t Hooft und M. Veltman, Nucl. Phys. B 44 (1972) 189; G. ’t Hooft, Nucl. Phys. B 61 (1973) 455.
- [6] E. C. G. Stückelberg und A. Peterman, Helv. Phys. Acta 26 (1953) 499; M. Gell-Mann und F. E. Low, Phys. Rev. 95 (1954) 1300.
- [7] C. Caso et. al. (Particle Data Group), Eur. Phys. J. C 3 (1998) 1.
- [8] S. L. Adler, Phys. Rev. 177 (1969) 2426; J. S. Bell und R. Jackiw, Nuovo Cim. 60 A (1969) 47.
- [9] H. Georgi und S. L. Glashow, Phys. Rev. D 6 (1972) 429.
- [10] D. Gross und R. Jackiw, Phys. Rev. D 6 (1972) 477; C. Bouchiat, J. Iliopoulos und P. Meyer, Phys. Rev. Lett. 38 B (1972) 519.
- [11] P. W. Higgs, Phys. Rev. Lett. 12 (1964) 132, Phys. Rev. 145 (1966) 1156.
- [12] ALEPH-, DELPHI-, L3- und OPAL-Kollaborationen, CERN-EP-99-060 (1999).
- [13] H. Fusaoka und Y. Koide, Phys. Rev. D 57 (1998) 3986.
- [14] N. Cabibbo, Phys. Rev. Lett. 10 (1963) 531; M. Kobayashi und M. Maskawa, Progr. Theor. Phys. 49 (1973) 652.
- [15] A. Riotto, CERN-TH-98-204 und hep-ph/9807454 (1998).
- [16] S. M. Bilenky, C. Giunti und W. Grimus, Prog. Part. Nucl. Phys. 43 (1999) 1.
- [17] P. Langacker (Hrsg.), Precision Tests of the Standard Electroweak Model, World Scientific, Singapur 1995.
- [18] R. D. Peccei und H. R. Quinn, Phys. Rev. Lett. 38 (1977) 1440, Phys. Rev. D 16 (1977) 1791.
- [19] C. D. Froggatt und H. B. Nielsen, Nucl. Phys. B 147 (1979) 277.
- [20] P. Langacker, Phys. Rep. 72 C (1981) 185.
- [21] A. Masiero in Grand Unification with and without Supersymmetry and Cosmological Implications, World Scientific, Singapur 1984; G. G. Ross, Grand Unified Theories, Benjamin/Cummings, Menlo Park 1985.
- [22] H. Georgi, H. R. Quinn und S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. 33 (1974) 451.
- [23] H. Arason, D. J. Castaño, B. Kesthelyi, S. Mikaelian, E. J. Piard, P. Ramond und B. D. Wright, Phys. Rev. D 46 (1992) 3945.
- [24] U. Amaldi, W. de Boer und H. Fürstenau, Phys. Lett. B 260 (1991) 447.
- [25] H. Georgi, Lie Algebras in Particle Physics, Benjamin/Cummings, Reading 1982.
- [26] R. Slansky, Phys. Rep. 79 B (1981) 1.
- [27] F. Wilczek, Nucl. Phys. Proc. Suppl. 77 (1999) 511.
- [28] M. Gell-Mann, P. Ramond und R. Slansky, Rev. Mod. Phys. 50 (1978) 721.
- [29] M. L. Mehta, J. Math. Phys. 7 (1966) 1824; M. L. Mehta und P. K. Srivastava, J. Math. Phys. 7 (1966) 1833.
- [30] F. Gürsey, P. Ramond und P. Sikivie, Phys. Lett. 60 B (1976) 177.
- [31] J. Banks und H. Georgi, Phys. Rev. D 14 (1976) 1159; S. Okubo, Phys. Rev. D 16 (1977) 3528.
- [32] H. Georgi, Nucl. Phys. B 156 (1979) 126.
- [33] H. Georgi und S. L. Glashow, Phys. Rev. Lett. 32 (1974) 438; A. J. Buras, J. Ellis, M. K. Gaillard und D. V. Nanopoulos, Nucl. Phys. B 135 (1978) 66.
- [34] M. Machacek, Nucl. Phys. B 159 (1979) 37; J. Ellis, M. K. Gaillard und D. V. Nanopoulos, Phys. Lett. 88 B (1979) 320.
- [35] B. Viren für die Super-Kamiokande-Kollaboration, SBHEP-99-1 und hep-ex/9903029 (1999).
- [36] H. Georgi und C. Jarlskog, Phys. Lett. 86 B (1979) 297.
- [37] L.-F. Li, Phys. Rev. D 9 (1974) 1723.
- [38] E. Gildener, Phys. Rev. D 14 (1976) 1667.
- [39] F. del Aguila und L. E. Ibañez, Nucl. Phys. B 177 (1981) 60.
- [40] H. Georgi in Particles and Fields, Hrsg. C. E. Carlson, AIP Press, New York 1975; H. Fritzsch und P. Minkowski, Ann. Phys. 93 (1975) 193.
- [41] S. Rajpoot, Phys. Rev. D 22 (1980) 2244; R. W. Robinett und J. L. Rosner, Phys. Rev. D 26 (1982) 2396; Y. Tosa, G. C. Branco und R. E. Marshak, Phys. Rev. D 28 (1983) 1731; D. Chang, R. N. Mohapatra und M. K. Parida, Phys. Rev. D 30 (1984) 1052; J. M. Gipson und R. E. Marshak, Phys. Rev. D 31 (1985) 1705; D. Chang, R. N. Mohapatra, J. M. Gipson, R. E. Marshak und M. K. Parida, Phys. Rev. D 31 (1985) 1718.
- [42] N. G. Deshpande, E. Keith und P. B. Pal, Phys. Rev. D 46 (1992) 2261, Phys. Rev. D 47 (1993) 2892.
- [43] V. A. Kuzmin und M. E. Shaposhnikov, Phys. Lett. 92 B (1980) 115.
- [44] F. Acampora, G. Amelino-Camelia, F. Buccella, O. Pisanti, L. Rosa und T. Tuzi, Nuovo Cim. 108 A (1995) 375.
- [45] J. Pati und A. Salam, Phys. Rev. D 10 (1974) 275.
- [46] M. S. Chanowitz, J. Ellis und M. K. Gaillard, Nucl. Phys. B 128 (1977) 506; R. Barbieri, D. V. Nanopoulos, G. Morchio und F. Strocchi, Phys. Lett. 90 B (1980) 91.
- [47] H. Georgi und S. L. Glashow, Phys. Rev. D 7 (1973) 245; G. C. Branco und G. Senjanovic, Phys. Rev. D 18 (1978) 162.
- [48] M. Magg und C. Wetterich, Phys. Lett. 94 B (1980) 61.
- [49] H. Georgi und D. V. Nanopoulos, Phys. Lett. 82 B (1978) 95.
- [50] M. S. Turner, astro-ph/9901109 (1999); D. O. Caldwell, UCSB-HEP-99-01 und hep-ph/9902219 (1999); M. Fukugita, G.-C. Liu und N. Sugiyama, KUNS-1596 und hep-ph/9908450 (1999).
- [51] M. Gell-Mann, P. Ramond und R. Slansky in Supergravity, Hrsg. P. van Nieuwenhuizen und D. Z. Friedman, North Holland, Amsterdam 1979; T. Yanagida, Prog. Theor. Phys. 64 (1980) 1103.
- [52] Y. Achiman und B. Stech, Phys. Lett. 77 B (1978) 389; R. Barbieri und D. V. Nanopoulos, Phys. Lett. 91 B (1980) 369.
- [53] Y. Achiman und A. Lukas, Nucl. Phys. B 384 (1992) 78.
- [54] B. Pontecorvo, Sov. Phys. JETP 6 (1958) 429, Sov. Phys. JETP 7 (1958) 172.
- [55] L. Wolfenstein, Phys. Rev. D 17 (1978) 2369.
- [56] S. P. Mikheyev und A. Y. Smirnov, Sov. J. Nucl. Phys. 42 (1985) 441, Nuovo Cim. 9 C (1986) 17.
- [57] J. N. Bahcall und R. K. Ulrich, Rev. Mod. Phys. 60 (1988) 297; J. N. Bahcall und M. H. Pinsonneault, Rev. Mod. Phys. 67 (1995) 781.
- [58] J. N. Bahcall, P. I. Krastev und A. Y. Smirnov, Phys. Rev. D 58 (1998) 096016.
- [59] Y. Fukuda et. al. (Kamiokande-Kollaboration), Phys. Lett. B335 (1994) 237.
- [60] Y. Fukuda et. al. (Super-Kamiokande-Kollaboration), Phys. Lett. B436 (1998) 33, Phys. Rev. Lett. 81 (1998) 1562.
- [61] C. Bemporad et. al. (CHOOZ-Kollaboration), Nucl. Phys. Proc. Suppl. 77 (1999) 159.
- [62] K. Eitel et. al. (KARMEN-Kollaboration), Nucl. Phys. Proc. Suppl. 77 (1999) 212.
- [63] A. Bazarko, hep-ex/9906003 (1999).
- [64] L. J. Hall, Nucl. Phys. B 178 (1981) 75.
- [65] M. K. Parida, Phys. Rev. D 57 (1998) 2736.
- [66] S. Weinberg, Phys. Lett. 91 B (1980) 51.
- [67] D. Lee, R. N. Mohapatra, M. K. Parida und M. Rani, Phys. Rev. D 51 (1995) 229; R. N. Mohapatra und M. K. Parida, Phys. Rev. D 47 (1993) 264.
- [68] H. Fritzsch, Phys. Lett. 70 B (1977) 436, Phys. Lett. 73 B (1978) 317, Nucl. Phys. B 155 (1979) 189.
- [69] K. Kang, J. Flanz und E. Paschos, Z. Phys. C 55 (1992) 75.
- [70] H. Georgi und D. V. Nanopoulos, Phys. Lett. 82 B (1979) 392, Nucl. Phys. B 155 (1979) 52.
- [71] K. S. Babu und Q. Shafi, Phys. Rev. D 47 (1993) 5004, Phys. Lett. B 311 (1993) 172.
- [72] P. Ramond, R. G. Roberts und G. G. Ross, Nucl. Phys. B 406 (1993) 19.
- [73] Z. Berezhiani, INFN-FE-21-95 und hep-ph/9602325 (1996).
- [74] Z. Berezhiani und A. Rossi, JHEP 03 (1999) 002.
- [75] K. S. Babu und Q. Shafi, Phys. Lett. B 357 (1995) 365; K. S. Babu, J. C. Pati und F. Wilczek, OSU-HEP-98-11 und hep-ph/9812538 (1998).
- [76] H. Georgi und D. V. Nanopoulos, Nucl. Phys. B 159 (1979) 16.
- [77] G. C. Branco, L. Lavoura und F. Mota, Phys. Rev. D 39 (1989) 3443.
- [78] A. Davidson, V. P. Nair und K. C. Wali, Phys. Rev. D 29 (1984) 1504 , Phys. Rev. D 29 (1984) 1513; Y. Achiman und T. Greiner, Nucl. Phys. B 443 (1995) 3.
- [79] M. Olechowski und S. Pokorski, Phys. Lett. B 257 (1991) 388.
- [80] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling und B. P. Flannery, Numerical Recipes in Fortran 77, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
- [81] L. Baudis et. al. (Heidelberg-Moskau-Kollaboration), Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 41.
- [82] E. W. Kolb und M. S. Turner, The early Universe, Addison-Wesley, Redwood City 1990.
- [83] A. D. Sakharov, JETP Lett. 91 B (1967) 24.
- [84] G. ’t Hooft, Phys. Rev. Lett. 37 (1976) 8.
- [85] V. A. Kuzmin, V. A. Rubakov und M. E. Shaposhnikov, Phys. Lett. B 155 (1985) 36.
- [86] M. Fukugita und T. Yanagida, Phys. Lett. 174 (1986) 45.
- [87] A. Riotto und M. Trodden, CERN-TH-99-04 und hep-ph/9901362 (1999).
- [88] C. Jarlskog und F. Ynduráin, Nucl. Phys. B 144 (1979) 29; J. F. Donoghue und G. Karl, Phys. Rev. D 24 (1981) 230.
- [89] G. Kane und G. Karl, Phys. Rev. D 22 (1980) 2808.
- [90] M. B. Gavela, A. Le Yaouanc, L. Oliver, O. Pène und J. C. Raynal, Phys. Rev. D 23 (1981) 1580.
- [91] H. Din, G. Girardi und P. Sorba, Phys. Lett. 91 B (1980) 77; J. F. Donoghue, Phys. Lett. 92 B (1980) 99; E. Golowich, Phys. Rev. D 22 (1980) 1148, Phys. Rev. D 24 (1981) 2899.
- [92] Y. Tomozawa, Phys. Rev. Lett. 46 (1981) 463; V. S. Berezinsky B. L. Ioffe und Y. I. Kogan, Phys. Lett. 105 B (1981) 33; L. F. Abbott, R. Blankenbecler und M. B. Wise, Phys. Rev. D 23 (1981) 1591.
- [93] M. Isgur und M. B. Wise, Phys. Lett. 117 B (1982) 179.
- [94] W. Lucha, Fortschr. Phys. 33 (1985) 547.
- [95] Y. Hara, Nucl. Phys. B 214 (1983) 167.
- [96] J. D. Bjorken und S. D. Drell, Relativistic Quantum Mechanics, McGraw-Hill, New York 1964.
- [97] L. F. Abbott und M. B. Wise, Phys. Rev. D 22 (1980) 2208; M. Daniel und J. A. Peñarrocha, Nucl. Phys. B 236 (1984) 467.
- [98] F. Buccella, G. Miele, L. Rosa, P. Santorelli und T. Tuzi, Phys. Lett. B 233 (1989) 178.
- [99] A. J. Buras, TUM-HEP-316-98 und hep-ph/9806471 (1998).
- [100] J. Bolz und P. Kroll, Z. Phys. A 356 (1996) 327.
- [101] P. Langacker in Inner Space, Outer Space, Hrsg. E. W. Kolb, University of Chicago Press, Chicago 1986.
- [102] C. McGrew et. al. (IMB 3-Kollaboration), Phys. Rev. D 59 (1999) 052004.
- [103] M. Shiozawa et. al. (Super-Kamiokande-Kollaboration), Phys. Rev. Lett. 81 (1998) 3319; Y. Hayato et. al. (Super-Kamiokande-Kollaboration), Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 1529.
- [104] C. Berger et. al. (Fréjus-Kollaboration), Z. Phys. C 50 (1991) 385, Phys. Lett. B 269 (1991) 227.
- [105] W. W. M. Allison et. al. (Soudan 2-Kollaboration), Phys. Lett. B 427 (1998) 217; D. Wall et. al. (Soudan 2-Kollaboration), hep-ex/9910026 (1999).
- [106] F. Arneodo et. al. (ICARUS-Kollaboration), Nucl. Phys. Proc. Suppl. 70 (1999) 453.
- [107] Y. Nir, IASSNS-HEP-99-96 und hep-ph/9911321 (1999).
- [108] G. F. Giudice, hep-ph/9912279 (1999).
- [109] L. E. Ibañez, FTUAM-99-37 und hep-ph/9911499 (1999).
- [110] M. E. Machacek und M. T. Vaughn, Nucl. Phys. B 222 (1983) 83, Nucl. Phys. B 236 (1984) 221, Nucl. Phys. B 249 (1985) 70.
- [111] P. H. Chankowski und Z. Płuciennik, Phys. Lett. B 316 (1993) 312; K. S. Babu, C. N. Leung und J. Pantaleone, Phys. Lett. B 319 (1993) 191.
Schlußwort
An dieser Stelle möchte ich mich bei all denen bedanken, die mich während der letzten drei Jahre auf die eine oder andere Weise unterstützt haben.
Zunächst gilt mein Dank Prof. Dr. Yoav Achiman, der dieses Projekt angeregt und betreut hat. Er hat durch sein ständiges Interesse, die stete Bereitschaft zu ausgiebigen Diskussionen und zahlreiche physikalische Ideen wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen. Dank auch den übrigen Mitgliedern des Prüfungsausschusses, Prof. Dr. Peter Kroll als Zweitgutachter der Dissertation sowie Prof. Dr. Jürgen Drees und Dr. Peer Ueberholz.
Dr. Mina Parida war mir während seines Forschungsaufenthaltes in Wuppertal mit seinem Fachwissen eine sehr große Hilfe und stets bereit, sich mit meinem Fragen zu beschäftigen. Ebenso danke ich Prof. Dr. Franco Buccella, Dr. Ofelia Pisanti und Dr. Pietro Santorelli für die aufschlußreichen Diskussionen währen der Sommerschule auf Capri.
Dank auch allen Kollegen am Institut, insbesondere aber meinen Mitstreitern aus F 10.09. Marcus Richter, Dr. Armin Seyfried, Thorsten Struckmann und Dr. Jochen Viehoff verdanke ich eine überaus angenehme Arbeitsatmosphäre während der vergangenen drei Jahre. Auch die Hilfe von Norbert Eicker in EDV-Dingen sowie von Sabine Hoffmann und Anita Wied aus dem Sekretariat in allen organisatorischen Fragen ist nicht zu unterschätzen.
Meiner Familie und meinem Freundeskreis gebührt ebenfalls großer Dank. Meine Eltern haben mich während meines gesamten Studiums in jeder Weise tatkräftig unterstützt. Den Freunden, allen voran aber Christine Rompel, sei für ihre große Geduld und Aufmunterung vor allem in der Endphase meiner Promotion gedankt.
Der Deutschen Forschungsgemeinschaft schließlich bin ich für die finanzielle Unterstützung in Form eines Stipendiums im Rahmen des Graduiertenkollegs „Feldtheoretische und numerische Methoden der Elementarteilchen- und Statistischen Physik“ überaus dankbar.
Carsten Merten
Wuppertal, Dezember 1999