RHEINISCH WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
hep-ex/9709011
PITHA 96/31
Februar 1996
Untersuchungen zur
Jet–Parton–Korrelation
in der tief-inelastischen Streuung
Thomas Hadig
I.Physikalisches Institut der Technischen Hochschule Aachen
PHYSIKALISCHE INSTITUTE
RWTH AACHEN
52056 AACHEN, GERMANY
Abstract
The jet parton correlation has been studied for different cut scenarios and various jet algorithms. These migrations are getting important for measuring the strong coupling constant and the NLO gluon density from jet rates in DIS at HERA.
Untersuchungen zur
Jet–Parton–Korrelation
in der tief-inelastischen Streuung
Kapitel 1 Einleitung
Ein wesentlicher Charakterzug der Menschen ist die Neugierde. Immer schon haben wir uns nicht mit der bloßen Existenz eines Phänomens zufriedengegeben, sondern haben versucht die Ursache dafür zu ergründen.
Die älteste Frage ist die nach dem Woher der Welt und ihrer Zusammensetzung. Eine entscheidende Idee hatte hierbei schon der griechische Philosoph Demokrit, für den die Welt aus elementaren, unteilbaren Bausteinen (“atomos“) aufgebaut war.
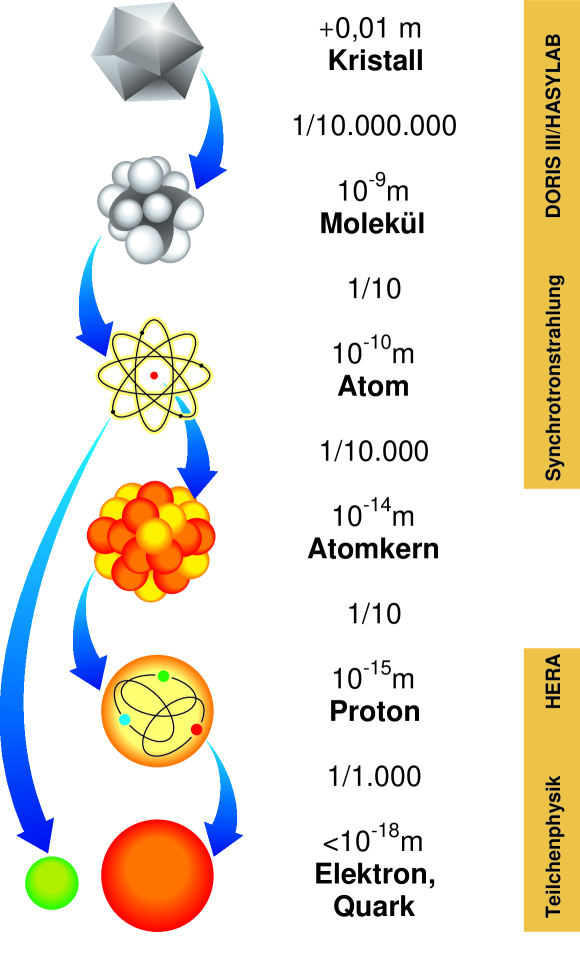
Heute ist diese Frage immer noch nicht beantwortet, auch wenn die moderne Naturwissenschaft Schritt für Schritt zu immer kleineren Strukturen vordringt (siehe Abbildung 1.1).
Eine Voraussetzung dafür war die Entwicklung des Modellbegriffes. Unter einem Modell verstehen wir in der Physik eine Theorie, die einen bestimmten Teil der Natur beschreibt, ohne daß Messungen den Vorhersagen des Modells widersprechen. Aus den meisten Theorien können wir zusätzliche Aussagen über bisher nicht beobachtbare Bereiche und neue Phänomene treffen. Die Aufgabe des Experimentalphysikers ist es, dieses zu überprüfen. Stimmen die Messungen nicht mit der Theorie überein, so sind die bestehenden Modelle in diesem Bereich nicht mehr gültig und die Theoretiker sind dazu aufgerufen, diese zu erweitern oder neue Modelle zu entwickeln. Dieses gegenseitige Wechselspiel ist sicher ein wesentlicher Grund für den Erfolg der heutigen Naturwissenschaft.
Auch wenn die heute so häufig beschrieene Anwendbarkeit der Forschungsergebnisse bei der Grundlagenforschung nicht direkt erkennbar ist, so befriedigt sie dennoch die Neugier der Menschen und leistet einen Beitrag zum technischen und philosophischen Fortschritt. Als Beispiele seien hier nur die Relativitätstheorie oder das Heisenbergsche Unschärfeprinzip erwähnt, die das Weltbild und die Philosophie dieses Jahrhunderts wie kaum eine andere Entwicklung geprägt haben.
| Austauschteilchen (Spin 1) | |
|---|---|
| elektromagnetisch | |
| schwach | |
| stark | |
| Skalare (Spin 0) | |
| Higgsfeld | |
Das zur Zeit gültige Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist in der Lage alle heute bekannten Effekte der Hochenergiephysik durch drei Quark- und drei Lepton-Familien zu beschreiben, deren Mitglieder über Austauschteilchen miteinander wechselwirken. Die Partikel sind in Tabelle 1.1 aufgeführt. Es wird zwischen links- (L) und rechtshändigen (R) Teilchen unterschieden, da Neutrinos nur linkshändig in der Natur vorkommen. Die Quarks sind alle bereits experimentell beobachtet worden, wobei die Existenz des Top-Quarks nach ersten Hinweisen 1994 nun experimentell bestätigt wurde [CDF95], [DZe95]. Bei den Leptonen ist nur das Tau-Neutrino bisher unbeobachtet.
Die ebenfalls in Tabelle 1.1 gezeigten Austauschteilchen übertragen die Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Diese Partikel sind alle experimentell bestätigt. Ein wichtiges Ziel in der Hochenergiephysik ist, die verschiedenen Wechselwirkungen durch den gleichen Mechanismus mit einer einzigen Kopplungskonstante zu beschreiben. Diese sogenannte Vereinheitlichung ist bei der elektromagnetischen und der schwachen Kraft bereits gelungen. Um dies durch die Modelle der Großen Vereinheitlichung (GUT, grand unified theory) ebenfalls für die starke Kraft zu erreichen, ist eine genaue Kenntnis der starken Kopplungskonstante wesentlich. Die Vereinigung der Kopplungskonstanten wird bei einer heute nicht erreichbaren Energie erwartet.
Ein Problem des Standardmodells ist die Masse der Teilchen zu erklären. Der Higgs-Mechanismus erreicht dies durch ein zusätzliches Teilchen, das Higgs-Boson Es besteht die Hoffnung, daß die Existenz dieses Teilchens bei den geplanten Beschleunigern LEP 200 oder LHC nachgewiesen werden kann.
Das Standardmodell ist sicher nicht die letzte Theorie. Neben der großen vereinheitlichten Theorie ist die hohe Anzahl an Eingabeparametern unbefriedigend. Ein Zusammenhang zwischen diesen Parametern wird in neueren Modellen wie der Supersymmetrie und der String-Theorie gesucht. Gleichzeitig stellen diese neue Vorhersagen auf, so daß sich in den nächsten Jahren die Möglichkeit weiterer Experimente und Messungen ergeben wird.
Es bleiben somit noch viele Fragen offen, deren Beantwortung wir jedoch mit den heute bestehenden und zukünftigen Beschleunigern sowie durch engere Kooperation mit anderen Bereichen physikalischer Forschung (z.B. der Kosmologie) immer näherkommen werden. So werden wir hoffentlich irgendwann die Frage nach dem Woher und dem Woraus der Welt beantworten können.
Kapitel 2 Experimentelle Grundlagen
2.1 Teilchenbeschleuniger
In der Teilchenphysik werden Beschleuniger zur Bestimmung der Eigenschaften von Elementarteilchen eingesetzt.
Zwei Teilchenreaktionen ermöglichen es, Daten zu gewinnen, Streuungen und Annihilationen.
Zum einen kann man über Streuungen durch Beschuß des zu untersuchenden Teilchens dessen innere Struktur vermessen. Die erreichbare Auflösung wird vom Viererimpulsübertrag des Austauschteilchens über die Beziehung
| (2.1) |
bestimmt. Der Viererimpulsübertrag ist durch die zur Verfügung stehende Schwerpunktsenergie begrenzt.
Zum anderen wird durch Annihilation von Teilchen und Antiteilchen eine definierte Schwerpunktsenergie erreicht, mit der neue Teilchen durch Resonanzen im Wirkungsquerschnitt nachgewiesen und untersucht werden können bzw. deren Masse und Lebensdauer bestimmt wird. Dazu muß jedoch die Stoßenergie in der Größenordnung der Masse des zu erzeugenden Teilchens sein.
Beim Bau eines Beschleunigers, mit dem Teilchenreaktionen mit hoher Genauigkeit vermessen werden sollen, müssen verschiedene Designparameter beachtet werden. Von großer Bedeutung sind hier die Teilchensorte der Stoßpartner, die maximale Energie und die Luminosität.
Eine möglichst hohe Schwerpunktsenergie erreicht man, indem zwei bewegte Partikel aneinander streuen bzw. annihilieren. Aus diesem Grunde sind sogenannte Fixed-Target-Experimente, d.h. Beschleuniger bei denen ein beschleunigtes Teilchen auf ein feststehendes, ruhendes Ziel geschossen wird, nur noch selten anzutreffen. Die Berechnung der Schwerpunktsenergie erfolgt unter Vernachlässigung der Teilchenmassen bewegter Teilchen durch111Formel für Collider gilt nur für Kollisionen von Teilchen aus entgegengesetzten Richtungen.
| (2.2) | |||||
| (2.3) | |||||
| (2.4) |
Die verbreitetste Bauart von Beschleunigern ist die eines Ringes, in dem die beiden Stoßpartner gegenläufig in einem Kreis umlaufen und nach und nach auf die Maximalenergie beschleunigt werden. Die Nachteile dieses Verfahrens liegen in der nötigen Synchronisation der Beschleunigungsvorgänge und dem Energieverlust durch Synchrotronstrahlung aufgrund der gekrümmten Bahn. Für die Zukunft sind jedoch auch einige Experimente geplant, bei denen die Stoßpartner durch zwei Linearbeschleuniger, die die Teilchen in einer geraden Röhre beschleunigen, aufeinander geschossen werden. Dazu muß jedoch die Stärke der beschleunigenden elektromagnetischen Felder vergrößert werden, da sonst die Beschleunigungsstrecken zu lang sind. Auch hier ist die Synchronisation der beiden Teilchenstrahlen kompliziert. Ein weiterer Nachteil ist, daß sich die Teilchenstrahlen nur einmal kreuzen und danach das Beschleunigersystem verlassen.
Neben der Schwerpunktsenergie ist die spezifische Luminosität einer der grundlegenden Parameter. Zusammen mit der Maschinenlaufzeit läßt sich die integrierte Luminosität
berechnen. Die zu erwartetende Ereigniszahl für einen Prozeß mit gegebenen Wirkungsquerschnitt ergibt sich aus
Eine hohe Luminosität erreicht man durch kleine Strahlquerschnitte und hohe Teilchenströme.
| maximale | spezifische | |||
| Name | Ort | Teilchensorte | Strahlenergie | Luminosität |
| PETRA222Datennahme 1986 beendet | Hamburg | 23.4 | 24 bei | |
| PEP333Datennahme 1990 beendet | Stanford | 15 | 60 | |
| TRISTAN | Tsukuba | 32 | 37 | |
| SLC | Stanford | 50 | 0.35 | |
| LEP | Genf | 55 | 11 | |
| LEP 200 | Genf | 70444stufenweise Erhöhung der Energie von LEP auf eine Schwerpunktenergie von max. | 11 | |
| Genf | 315 | 6 | ||
| Tevatron I | Chicago | 1000 | 10 | |
| HERA | Hamburg | 30/820 | 16 | |
| LHC555geplant, Fertigstellung voraussichtlich 2004 | CERN | 7000 | 10000 |
Alle Colliderexperimente sind in eine der drei folgenden Kategorien nach Art der Stoßpartner einzuordnen. Die Vorteile bei der Beschleunigung von Elektronen entstehen aufgrund der geringen Masse. Schon bei einer Energie von erreichen die Elektronen eine Geschwindigkeit von 99.99% der Lichtgeschwindigkeit. Dadurch müssen bei der Beschleunigung im Ring nur kleine zeitliche Synchronisationen berücksichtigt werden. Die Probleme bei der Verwendung von Elektronen bestehen in den hohen Energieverlusten pro Umlauf durch Synchrotronstrahlung, die die maximale Strahlenergie begrenzen oder den Durchmesser des Ringes ansteigen lassen. Bei den schwereren Protonen hingegen ist ein Geschwindigkeitsbruchteil von 99.99% der Lichtgeschwindigkeit erst bei einer Teilchenenergie von erreicht, dadurch wird der Beschleunigungsvorgang komplizierter. Die erreichbaren Energien liegen höher, wobei berücksichtigt werden muß, daß bei tief-inelastischen Stößen nur ein Bruchteil des Protonimpules im harten Prozeß zur Verfügung steht.
Bei Beschleunigern werden Elektronen mit Positronen mit entgegengesetzt gleichem Impuls zur Kollision gebracht. Die dabei freiwerdende Energie kann zur Erzeugung von Teilchen verwendet werden, die die Quantenzahlen des Vakuums haben. Die Vorteile liegen in der einfachen Reaktionskinematik, da das Laborsystem gleichzeitig Schwerpunktsystem ist und bei Annihilation eine immer konstante, durch die Strahlenergie gegebene Schwerpunktsenergie vorliegt.
Bei Maschinen streuen Protonen an deren Antiteilchen. Der Vorteil dieser Beschleuniger liegt in der höheren Energie der Strahlteilchen. Die Nachteile entstehen durch die innere Substruktur der Protonen, so daß nur ein Teil des Protonimpules in der Reaktion zur Verfügung steht und die Reste der Protonen zusätzliche Energie im Detektor hinterlassen. Dadurch entstehen hohe Jetmultiplizitäten. Ein weiteres Problem entsteht dadurch, daß die Strahlteilchen durch die starke Wechselwirkung im Anfangszustand zusätzliche Hintergrundereignisse hervorrufen können. Für Collider, wie z.B. der inzwischen genehmigt LHC, gelten die gleichen Vor- und Nachteile, hinzu kommt jedoch, daß eine Annihilation der Protonen oder deren Konstituenten hier nicht möglich ist.
Schließlich existiert noch die Möglichkeit Partikel unterschiedlicher Teilchensorte kollidieren zu lassen. Bei Beschleunigern werden hochenergetische Protonen auf Elektronen oder Positronen geschossen. Die Vorteile liegen in der inneren Substruktur nur eines der Strahlteilchen, des Protons. Diese kann durch Beobachtung des gestreuten Elektrons und des hadronischen Endzustandes vermessen werden. Da der Energieübertrag von Ereignis zu Ereignis unterschiedlich ist, können die Untersuchungen mit verschiedenen Schwerpunktsenergien ohne Veränderung der Strahlenergien durchgeführt werden. Die Nachteile entstehen durch die Verschiedenheit von Labor- und Schwerpunktsystem.
In der Tabelle 2.1 sind die wichtigsten Beschleuniger aufgeführt.
2.2 HERA
Der Beschleuniger HERA (Hadron Elektron Ring Anlage) ist der einzige Beschleuniger und wurde nach siebenjähriger Bauzeit 1991 in Betrieb genommen.
Die Beschleuniger, die auf dem DESY-Gelände ( Deutsches Elektronen Synchrotron) bereits vorhanden waren, werden hierbei als Vorbeschleuniger benutzt. Eine Übersicht über die einzelnen Geräte gibt die Abbildung 2.1.
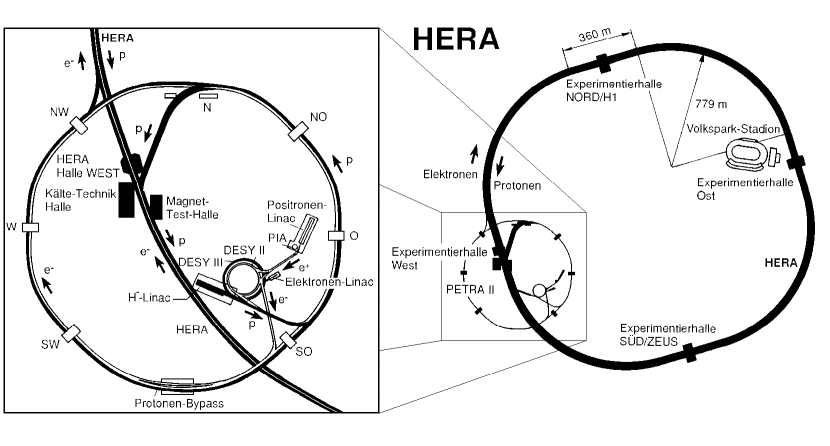
Der Protonenring ist mit supraleitenden Magneten versehen. Bei der Injektion in HERA sind die Protonen bereits auf vorbeschleunigt. Die entgegengesetzt umlaufenden Elektronen666In diesem Ring können sowohl Elektronen als auch deren Antiteilchen, die Positronen, beschleunigt werden. Nachdem bis Mitte 1994 Elektronen verwendet wurden, werden nun Positronen als Stoßpartner der Protonen benutzt. Im folgenden wird trotzdem meist ausschließlich der Begriff Elektronen verwendet, da die Betrachtungen hier unabhängig von der Art der Strahlleptonen sind. Unterschiede ergeben sich aber z.B. in der Berechnung der Wirkungsquerschnitte elektroschwacher Prozesse. haben eine Einschußenergie in HERA von Dort werden herkömmliche Magnete verwendet, da die Energie und Masse der Elektronen wesentlich niedriger ist und so kleinere Magnetfelder benötigt werden.
Die Strahlteilchen kollidieren in den Wechselwirkungspunkten unter einem Winkel von . Die Protonen und Elektronen werden zu sogenannten Bunches zusammengefaßt, d.h. zu Paketen aus Teilchen, die aufgrund der Beschleunigung durch elektrische Wechselfelder in Strahlrichtung eine begrenzte Ausdehnung haben.
Es existieren vier Hallen, in denen Experimente aufgebaut werden können. Neben den beiden Vielzweckdetektoren H1 und ZEUS existiert seit 1995 mit HERMES ein drittes Experiment, das über ein Gastarget die Streuung an polarisierten Elektronen bzw. Positronen untersucht. Zur Zeit ist ein viertes Experiment HERA-B in Planung.
Die technischen Daten von HERA sind in Tabelle 2.2 zusammengefaßt.
| Designparameter | 1994 | |||
| -Ring | -Ring | -Ring | -Ring | |
| Maximalenergie | 820 | 30 | 820 | 27.55 |
| Anzahl Teilchenpakete | 210 | 210 | 153+17777Die zweite Zahl gibt die Anzahl der Pilotbunche an, das sind die Strahlpakete, die nicht auf ein Paket des anderen Strahls treffen und so zur Messung des Strahl–Wand und Strahl–Gas Untergrundes dienen. | 153+15 |
| Strahlstrom/Paket | 760 | 290 | 241 | 101 |
| Einschußenergie in HERA | 40 | 14 | ||
| magnetisches Ablenkfeld | 4.65 | 0.165 | ||
| Temperatur der Magnete | 4.4 K | 294 K | ||
| Strahlungsverlust pro Umlauf | ||||
| Schwerpunktenergie | 314 | 300.6 | ||
| spez. Luminosität | 15 | 1.4888Der Wert von 1994 entspricht der bei H1 gemessenen durchschnittlichen spezifischen Luminosität. Der höchste Wert war | ||
| Umfang | 6336 | |||
| Kollisionsrate | 10.4 | |||
2.3 Der H1 Detektor
Der H1 Detektor ist einer der beiden Vielzweck Detektoren am HERA Speicherring. Seine Aufgaben sind die Detektierung und Bestimmung von Reaktionsprodukten bei Stößen von Protonen und Elektronen.
Dazu ist der nahezu komplette Raumbereich um den Wechselwirkungspunkt mit Spurkammern und Kalorimetern ausgestattet. Spurkammern dienen zur Bestimmung der Bahn geladener Teilchen. An der Krümmung dieser Bahnen in einem externen Magnetfeld läßt sich das Ladungsvorzeichen und in Verbindung mit der Stärke der Ionisation die Art des Teilchens bestimmen. Kalorimeter dienen zur Energiemessung, indem sie die Menge der Ionisationsladungen in den einzelnen Zellen bestimmen.
Aus diesen Informationen kann man die Flugbahnen der Reaktionsprodukte und die Vertexposition, d.i. der Ort der Kollision, rekonstruieren. Außerdem sind noch Informationen über die Zeitpunkte der Ereignisse hilfreich.
Da die Protonen eine höhere Strahlenergie haben und bei tief-inelastischen Streuungen nicht intakt bleiben, entspricht das Laborsystem nicht dem Schwerpunktsystem der Reaktion. Aus diesem Grunde sind die Anforderungen an die Meßgeräte in Proton- und in Elektronrichtung unterschiedlich und der Detektor selber nicht symmetrisch aufgebaut.
Die Abbildung 2.2 zeigt den H1 Detektor in einer Rißzeichnung. Das H1 Koordinatensystem ist rechthändig und liegt so, daß die -Achse entlang des Strahlrohres in Richtung der Protonen weist. Die -Achse zeigt zum Speicherringmittelpunkt und die -Achse somit nach oben. Der Nullpunkt liegt im nominalen Wechselwirkungspunkt. Meist erfolgt die Beschreibung jedoch in Polarkoordinaten, wobei den Polarwinkel zur -Achse darstellt. Die ungestreuten Protonen laufen unter dem Winkel aus. Der Azimutalwinkel beschreibt die Lage in der -Ebene.
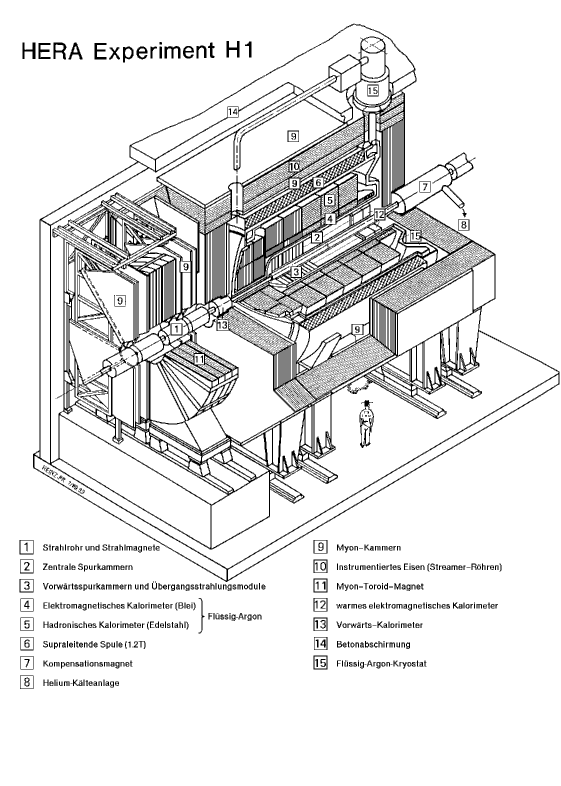
Die für diese Arbeit wichtigsten Komponenten werden hier nun näher erläutert, die Zahlen beziehen sich dabei auf Abbildung 2.2 [H1 93b] :
- Spule (6) :
-
Die supraleitende Spule erzeugt ein Magnetfeld, das eine Krümmung der Flugbahnen geladener Teilchen bewirkt. Dadurch kann das Ladungvorzeichen und der Impuls eines Teilchen bestimmt werden. Die Spule ist lang und hat einen Radius von Bei den Spurkammern in der Mitte des Detektors erzeugt sie ein nahezu homogenes Magnetfeld von
- Flüssig-Argon-Kalorimeter (LAr, 4 und 5) :
-
Das mit flüssigem Argon gefüllte Kalorimeter deckt den Winkelbereich von vier bis 153 Grad ab. Durch seine Zweiteilung in einen hadronischen äußeren Teil und ein elektromagnetisches inneres Kalorimeter ist es in der Lage, nicht nur die Energie der Teilchen zu messen, sondern auf Grund des Verhältnisses der Ladungsdepositionen in den beiden Komponenten einen Hinweis auf die Art des Teilchens zu geben. Dies ist für die Berechnung der Energie wesentlich, da der Energieverlust pro Weglänge bei Hadronen und Leptonen unterschiedlich ist. Die charakterischen Größen zu den beiden Bereichen sind in Tabelle 2.3 zusammengefaßt. Die Energieauflösung ist dabei über die Formel
mit den Anteilen durch die Samplingfrequenz (A), das elektronische Rauschen (B) und die Kalibrationsunsicherheit (C) gegeben.
hadronisch el.mag. Absorbermaterial Stahl Blei Dicke der Absorberplatten 19 2.4 Dicke der flüssigen Argonschichten 2.35 Tiefe in charakteristischen Einheiten 4.5 - 8999in hadronischen Wechselwirkungslängen inklusive elektromagnetischem Kalorimeter 20 - 30101010in Stahlungslängen A B C bei Energie 3.7 - 170 3.7 - 80 Tabelle 2.3: Daten des Flüssig-Argon-Kalorimeters. Daten aus [H1 93a] - Rückwärtiges elektromagnetisches Kalorimeter (BEMC, 12) :
-
Das BEMC ist in Rückwärtsrichtung montiert und überdeckt den Winkelbereich von bis Da man dort nur bei sehr kleinen Protonimpulsbruchteilen hadronische Aktivität erwartet und das gestreute Elektron bei geringen Viererimpulsüberträgen genau in diesen Bereich fällt, ist das BEMC nur als elektromagnetisches Kalorimeter ausgelegt. Es besteht aus dicken Bleiabsorberplatten und starken Szintillatorplatten, deren Licht über Photodioden ausgelesen wird. Die Energieauflösung für Elektronen beträgt
für Hadronen jedoch nur
- Instrumentiertes Eisen (Iron, 10) :
-
Zur Rückführung des magnetischen Flusses befindet sich außerhalb der Spule ein Eisenjoch. Zwischen den zehn Eisenplatten der Dicke sind Streamerrohrkammern eingeschoben. Diese sind mit Pads bestückt, mit denen eine Energiemessung der nicht in den Kalorimetern absorbierten Teilchen möglich ist.
Die anderen Detektorkomponenten werden bei dieser Analyse nicht direkt benutzt. Die Informationen sind jedoch in der Ereignisvorselektion meist über Veto- und Triggersignale bzw. in der Rekonstruktion als Zeit- oder Spurmessungen verwendet worden. Nähere Informationen zum Detektor oder zum Beschleuniger kann in der angegebenen Literatur gefunden werden ([H1 93b], [Itt93],[Kö95],[Ros95]).
Kapitel 3 Theoretische Grundlagen
3.1 Tief-inelastische Lepton-Nukleon-Streuung
Protonen haben im Gegensatz zu Elektronen eine innere Struktur, weshalb man zwischen elastischer und inelastischer Streuung unterscheiden muß.
Bei der Lepton-Nukleon-Streuung wird zwischen elastischer Streuung, d.h. das Proton bleibt intakt, und inelastischer unterschieden, d.h. das Proton zerbricht und die Streuung findet an einem Parton des Protons statt.
Bei den in dieser Arbeit untersuchten tief-inelastischen Stößen wird ein virtuelles Photon ausgetauscht, d.h. ein Photon dessen Viererimpulsquadrat negativ ist.
Dieser Prozeß kann mit bezeichnet werden, wobei den gesamten hadronischen Endzustand beschreibt.
3.1.1 Kinematik
Üblicherweise wird in der Hochenergiephysik ein Teilchen durch Vierervektoren beschrieben. Ein wichtiger Vektor ist der Impulsvierervektor, der definiert ist durch :
Das Skalarprodukt eines Impulsvierervektors mit sich selbst ergibt die invariante Masse (mit Einsteinscher Summenkonvention) aus :
| (3.1) | |||||
Im folgenden werden die Ruhemassen vernachlässigt, da diese bei HERA für die einlaufenden Teilchen klein im Vergleich zu den jeweiligen Gesamtenergien sind. Für die Impulse der Strahlteilchen ergibt sich dann
für die Protonen und für die Elektronen
In Abbildung 3.1 wird die tief-inelastische Streuung verdeutlicht.
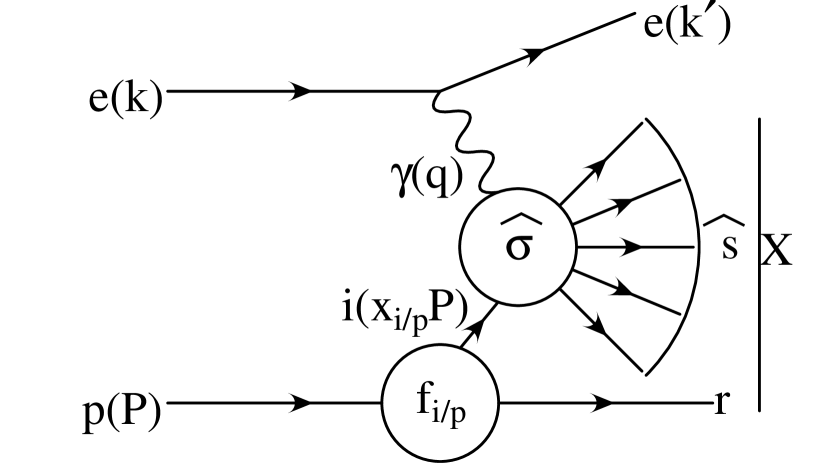
Das unter dem Winkel gestreute Elektron hat den Vierervektor Das Austauschteilchen oder trägt den Impuls
In den nächsten Abschnitten betrachten wir die Mandelstam-Variablen und für diesen Prozeß.
| (3.3) |
Dies entspricht dem Quadrat der Schwerpunktsenergie Diese ist aufgrund der festen Strahlenergien konstant
Für den Viererimpulsübertrag gilt
| (3.4) |
Da jedoch negativ ist, wird meist
benutzt.
Betrachten wir nur den harten Prozeß, der in der Abbildung 3.1 durch ein gekennzeichnet ist, so erhalten wir nun als einlaufende Teilchen das Photon q und ein Parton d.h. ein Teil des Protons, mit dem Impuls
Dann ergibt sich die Mandelstam-Variable zu
| (3.5) |
Bei der Bestimmung muß der Protonrest von den Produkten des harten Streuprozesses getrennt werden. Rechnen wir mit dem gesamten hadronischen Endzustand so erhalten wir
| (3.6) | |||||
Führen wir die beiden Bjorken Skalenvariabeln
| (3.7) |
und
| (3.8) |
ein, so ergeben sich die folgenden Beziehungen
| (3.9) | |||||
| (3.10) | |||||
| (3.11) |
Ist Null oder wesentlich kleiner als so entspricht und kann als der Impulsbruchteil des Protons betrachtet werden, den das Parton trägt.
Analog ist der Anteil der Elektronenenergie, der am harten Streuprozeß teilnimmt.
Es gilt für beide Skalenvariablen
3.1.2 Berechnung der kinematischen Größen
Die Reaktionskinematik kann unter Berücksichtigung der Symmetrie bezüglich des Azimutalwinkels nach Formel 3.9 bei konstanter Schwerpunktsenergie über zwei Größen beschrieben werden. Die Messung dieser Größen kann dabei über die Daten des gestreuten Elektrons und den hadronischen Endzustand erfolgen. Nun werden einige Methoden vorgestellt.
Benutzt man nur das gestreute Elektronen zur Bestimmung der Daten, erhält man die Größen und über
| (3.12) | |||||
| (3.13) |
Die Berechnung mit den Kalorimeterinformationen über den hadronischen Endzustand (had) erfolgt durch
| (3.14) | |||||
| (3.15) |
Die Doppelwinkelmethode DA benutzt nur die Winkel des gestreuten Elektrons und den Winkel der Impulssumme über den hadronischen Endzustand und ist somit von der Energiekalibration weitgehend unabhängig.
| (3.16) | |||||
| (3.17) |
3.1.3 Quark Parton Modell
Schreiben wir den Wirkungsquerschnitt der tief-inelastischen Streuung in Abhängigkeit der Lorentz Tensoren so ergibt sich
| (3.18) |
mit dem Lorentz Tensor für punktförmige Teilchen gemittelt über alle Spineinstellungen [HM84]
| (3.19) |
Wäre das Proton ebenfalls elementar, d.i. punktförmig, dann könnten wir für das Proton einen analogen Lorentz Tensor angeben. Da wir in der tief-inelastischen Streuung diese Annahme jedoch nicht machen können, setzen wir den allgemeinsten symmetrischen Lorentz Tensor an [HM84]
| (3.20) |
Eine Beziehung zwischen den Funktionen ergibt sich durch Betrachtung der Stromerhaltung am Protonvertex.
| (3.21) | |||||
| (3.22) |
Daraus folgt für 3.20
| (3.23) |
Für die Lorentz Skalenvariablen gilt bei punktförmigen Teilchen, d.i. wenn 3.23 in 3.19 übergeht,
| (3.25) | |||||
Bei kleinem gilt, d.h. wenn wir das Proton als Teilchen mit Formfaktor ausfassen :
| (3.26) |
Ein wesentlicher Unterschied ist, daß bei punktförmigen Teilchen der Wirkungsquerschnitt nur vom Verhältnis bei strukturbehafteten jedoch sowohl von als auch von abhängt.
Zerbricht nun das Proton in punktförmige Partonen, so können wir die Lepton Parton Wechselwirkung durch einen punktförmigen Lorentz Tensor beschreiben, wenn wir die Masse und den Impuls durch den jeweiligen Bruchteil ersetzen.
Dadurch können wir den Prozeß zweiteilen. Zum einen benötigen wir Partondichtefunktionen (particle density function, PDF), die die Wahrscheinlichkeit ein Parton des Typs im Proton anzutreffen in Abhängigkeit der kinematischen Variablen beschreiben. Zum anderen bleibt dann noch die Streuung des Leptons am Parton übrig, welche, wie wir oben gesehen haben, einfach zu beschreiben ist (siehe auch Abbildung 3.1).
Für die Partondichtefunktionen muß die Normierungsbedingung
| (3.27) |
gelten, da das ganze Proton aus Partonen aufgebaut ist.
Mit der oben definierten Variable gilt dann aus 3.25
| (3.28) |
und daraus bei Summation über alle Partonen eines Protons
| (3.29) |
ist die Ladung des Partons in Einheiten der Elementarladung.
Die Funktionen sind ausschließlich von einer Variablen abhängig, d.h. bei festem ist konstant bei verändertem Dieses Verhalten wird Bjorken Skalenverhalten (Bjorken scaling) genannt.
Der Aufbau des Protons aus nicht strukturbehafteten Teilchen kann dadurch nachgewiesen werden.
3.1.4 Quantenchromodynamik
Bevor wir uns die Partondichtefunktionen genauer ansehen, haben wir noch ein Problem zu lösen : Wenn das Proton aus mehreren Partonen besteht, wieso sind diese Partonen nicht einzeln, sondern nur in einem Teilchen gebunden vorzufinden.
Direkt damit gekoppelt ist das Problem, daß Teilchen existieren, die aus drei identischen Quarks mit gleichen Quantenzahlen aufgebaut sind (z.b. Dies ist jedoch für Fermionen nach dem Pauli-Prinzip verboten [Ber92].
Das Problem läßt sich durch die Einführung einer neuen Quantenzahl lösen. Diese wird in Analogie zu den drei Grundfarben Farbladung genannt, d.h. es existieren rote, grüne und blaue Quarks bzw. anti-rote, anti-grüne und anti-blaue Antiquarks.
Das Proton ist, wie jedes andere Teilchen, das wir direkt beobachten können, farblos und somit entweder eine Kombination aus drei unterschiedlich farbigen Quarks (Baryonen) bzw. Antiquarks (Anti-Baryonen) oder ein Zusammenschluß aus einem Quark und einem Antiquark mit der zugehörigen Antifarbe (Mesonen).
Dieses Verhalten bedingt die Existenz einer neuen Wechselwirkung, der starken Kraft, und der entsprechenden Austauschteilchen. Im Gegensatz zu der elektromagnetischen Wechselwirkung, die nur ein neutrales Austauschteilchen hat, existieren hier acht linear unabhängige Farb–Antifarb–Kombinationen und somit acht Austauschteilchen, die wir Gluonen nennen.
Sehen wir uns nun die Verteilung von an, so können wir verschiedene Szenarien unterscheiden.
Ist das Proton ein punktförmiges, nicht strukturbehaftetes Teilchen, so nimmt an einer Streuung immer der gesammte Impuls P teil, d.h. und es ergibt sich Bild 3.2a.
Besteht das Proton hingegen aus Partonen, die sich in Richtung der Protonen bewegen und nicht miteinander wechselwirken, so haben diese Partonen die gleiche Geschwindigkeit und somit — unter Vernachlässigung des Massenunterschiedes — den gleichen Impuls. Für unsere Verteilung gilt dann Bei einem Aufbau aus drei Quarks ergibt sich somit Bild 3.2b.
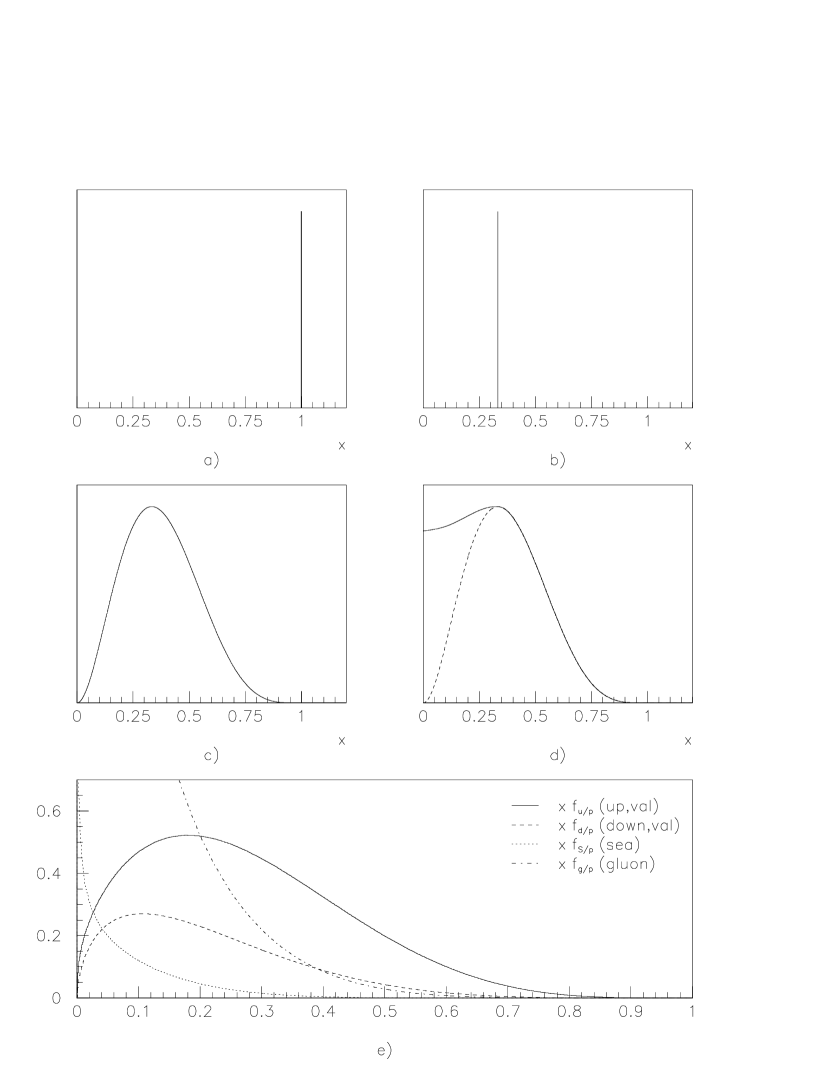
Wie wir jedoch bereits gesehen haben, sind bisher keine einzelnen Quarks beobachtet worden. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, daß es eine Partonwechselwirkung gibt und damit Impuls zwischen diesen übertragen wird. Die -Verteilung hat in diesem Fall weiterhin ein Maximum bei sie ist jedoch verschmiert (Abbildung 3.2c).
In der Quantenelektrodynamik gibt es die Möglichkeit der Vakuumpolarisation, d.h. ein hochenergetisches Photon kann ein Teilchen–Antiteilchen–Paar erzeugen. Dies ist bei Gluonen ebenfalls möglich, wir erwarten zu den drei Quarks eine der Bremsstrahlung ähnliche Quark-See-Verteilung. Dadurch erhöht sich die Dichteverteilung bei kleinen Impulsbruchteilen (Abbildung 3.2d).
Der genaue Verlauf der Dichtefunktionen ist — wie bereits erwähnt — von der kinematischen Region abhängig und in machen Phasenraumbereichen noch nicht gemessen worden. In Abbildung 3.2e ist eine Parametrisierung der Dichtefunktionen, wie sie sich aus den Messungen ergibt, gezeigt. Wir erkennen, daß die Verteilungen ungefähr unserem Modell d entspricht, dies jedoch ein noch zu einfacher Ansatz ist.
Integriert man über alle und summiert über alle Valenz- und Seequarks, so ergibt sich beim Proton jedoch nicht 1, wie Gleichung 3.27 erwarten läßt. Es müssen zusätzlich noch die Gluonen berücksichtigt werden. Da die Gluonen in Seequarks zerfallen, ist deren Spektrum ähnlich der Seequarkverteilung (siehe auch Abbildung 3.2e). Da die Gluonen jedoch nicht elektrisch geladen sind, koppeln sie nur stark und sind durch Streuung an Elektronen nicht direkt zu messen.
3.1.5 Die laufende Kopplungskonstante
In der Quantenelektrodynamik (QED) hat sich die Störungstheorie sinnvoll zur Berechnung der Wirkungsquerschnitte erwiesen.
Mit ihrer Hilfe können wir diese in Terme in unterschiedlicher Ordnung in der Kopplungskonstanten zerlegen :
| (3.30) |
Die Grundvoraussetzung ist jedoch, daß die Kopplungskonstante wesentlich kleiner als eins ist und wir somit die Terme in höherer Ordnung vernachlässigen können.
Die verschiedenen Terme können dann mit Hilfe sogenannter Feynman-Graphen veranschaulicht und mit den zugehörigen Regeln berechnet werden. Näheres hierzu findet sich in der angegebenen Literatur ([HM84], [IZ85]).
Bei den heute möglichen genauen Messungen in der QED stellen wir fest, daß die Kopplungskonstante nicht konstant ist, sondern bei hohen Energien und damit nach 2.1 bei kleineren Abständen größer wird. So steigt der Wert von bei Niedrigenergieexperimenten auf bei LEP, d.h. Energien in der Größe der Z-Boson-Masse Dies kann durch Vakuumpolarisation erklärt werden. Um die auftretenden Divergenzen zu umgehen wird anstelle der Ladung die Ladung
|
|
(3.31) |
verwendet. Dieser Vorgang wird Renormalisierung genannt.
Der Wert der Kopplungskonstante ändert sich von auf [HM84]
| (3.32) |
Wenden wir nun das gleiche Prinzip auf die Quantenchromodynamik (QCD) an. Schreiben wir den Wirkungsquerschnitt in Potenzen der starken Kopplungskonstante so wird aus Gleichung 3.30
| (3.33) |
Auch hier gibt es die Vakuumpolarisation, hinzu kommt jedoch noch die Kopplung von Austauschteilchen aneinander, die in der QED wegen der Ladungsneutralität der Photonen nicht auftritt. Somit renormalisieren wir die starke Kopplungskonstante durch
|
|
(3.34) |
T steht hier für transversale Polarisation, C für Coulomb Quarks, d.i. longitudinale bzw. skalare Polarisation ([HM84]).
In Formeln ausgedrückt mit der Anzahl Quarkarten gilt dann
| (3.35) | |||||
| (3.36) |
wobei in der letzten Gleichung der freie QCD-Parameter
| (3.37) |
eingesetzt wurde.
Wir erkennen hier, daß für die sechs uns bekannten Quarks der logarithmische Term im Gegensatz zur QED ein positives Vorzeichen hat. Dies bewirkt, daß die starke Kopplungskonstante bei kleineren Energien immer größer wird und wir somit nur farblose Teilchen sehen. Dieser Umstand wird color confinement genannt.
3.1.6 Prozesse in führender und nächst-zu-führender Ordnung
Im folgenden werden wir uns die Feynman-Graphen für einige der harten Streuprozesse ansehen.
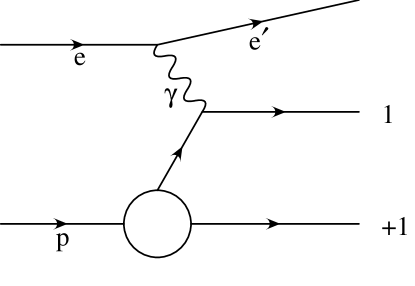
Der einfachste Graph ist in Abbildung 3.3 gezeigt. Die Streuung enthält keine starke Wechselwirkung, somit gehört sie in die Klasse der Prozesse. Da Gluonen elektrisch neutral sind, kann dieser Prozeß nur mit Quarks und Antiquarks als Partonen auftreten. Wir erhalten hier ein Parton zusätzlich zum Protonrest, deshalb wird dieser Prozeß als 1+1 Ereignis bezeichnet.
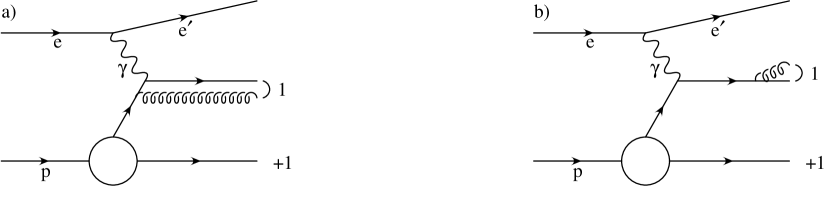
Fügen wir in diesen Graphen eine starke Wechselwirkung ein, so existiert die Möglichkeit ein Gluon vom Quark abzustrahlen. Dies kann vor der Wechselwirkung mit dem Photon geschehen, dann wird der Prozeß initial state radiation (3.4a) genannt. Erfolgt die Abstrahlung nach dem Stoß, so haben wir eine final state radiation (3.4b).
Ist das abgestrahlte Gluon weich, d.h. das Gluon hat eine geringe Energie, oder Quark und Gluon sind kollinear, d.h. die Impulsrichtung ist gleich, dann werden wir diesen Prozeß als 1+1 Ereignis klassifizieren. Da jedoch der Wirkungsquerschnitt für diesen Prozeß ist, ist dies ein Beitrag zur nächst-zur-führenden Ordnung (NLO, Next-to-Leading Order).
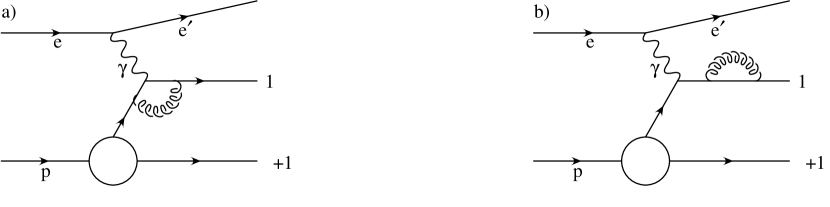
Einen weiteren Anteil erhalten wir durch virtuelle Korrekturen, d.h. Prozesse, die ein internes virtuelles Teilchen austauschen (Abbildung 3.5). Der Wirkungsquerschnitt dieser Prozesse selber ist zwar jedoch läßt sich der Endzustand nicht vom Prozeß in führender Ordnung unterscheiden. Durch die deshalb notwendige Addition der Matrixelemente entsteht bei der Berechnung des Wirkungsquerschnittes ein Interferenzterm in
| (3.38) |
Anzumerken ist hier noch, daß beim Prozeß 3.5a beim Stoß zwischen Parton und Photon nicht der komplette Partonimpulsbruchteil zur Verfügung steht, da das virtuelle Gluon ein Teil des Partonimpulses erhält.
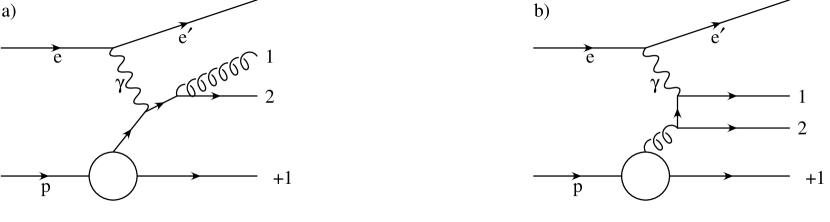
Gehen wir nun zur nächsten Prozeßklasse über. Wird entgegen unserer bisherigen Annahme ein hartes Gluon beim NLO 1+1 Ereignis (Abbildung 3.4) abgestrahlt, so erhalten wir zwei harte Partonen zum Protonrest. Dieser Prozeß wird in Analogie zur Compton Streuung in der Quantenelektrodynamik QCD-Compton Prozeß genannt (Abbildung 3.6a). Der Graph trägt somit zur führenden Ordnung der 2+1 Ereignisse bei und ist Die Entscheidung, wann ein Prozeß zur 2+1 oder zur 1+1 Ereignisklasse gehört, muß durch einen Abschneideparameter getroffen werden. Diese Unterscheidung ist auch deshalb wichtig, da der Wirkungsquerschnitt für die Abstrahlung kollinearer bzw. weicher Partonen divergiert. Eine genauere Betrachung wird bei der Behandlung des analogen Problems in Monte-Carlo-Generatoren in Kapitel 3.2 durchgeführt.
Bei der sogenannten Boson-Gluon-Fusion (Abbildung 3.6b) wird ein Gluon vom Proton abgestrahlt. Das Gluon zerfällt dann in ein Quark–Antiquark–Paar. Die Streuung des Photons kann entweder am Quark oder am Antiquark erfolgen. Auch dieser Prozeß gehört zur Klasse der LO 2+1 Ereignisse.
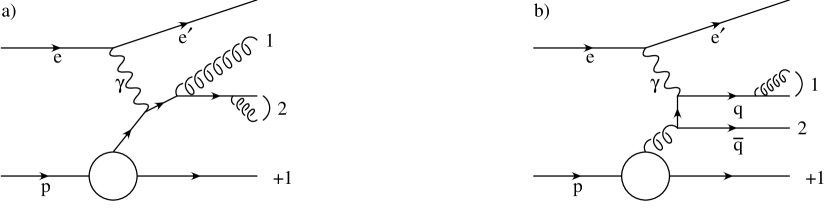
Die NLO 2+1 Prozesse entstehen analog den 1+1 Ereignissen durch Abstrahlung weicher Gluonen oder durch Interferenzterme bei den virtuellen Korrekturen (Abbildung 3.7). Dies sind Beiträge zur Störungsrechnung in
3.2 Monte-Carlo-Simulationen
Um sich ein Bild von den zu erwartenden Detektordaten zu machen, ist es notwendig Monte-Carlo-Simulationen einzusetzen.
Die Simulation von Ereignissen geschieht hierbei in mehreren Schritten. Einen allgemeinen Überblick über die unterschiedlichen Stufen eines Monte-Carlo-Generators gibt Abbildung 3.8. Begonnen wird mit dem harten Streuprozeß, dessen Art und Kinematik den theoretischen Modellen entnommen wird. Nachdem zusätzliche Abstrahlungen von Partonen berücksichtigt worden sind, wird die Hadronisierung durchgeführt, d.h. die farbigen Quarks werden zu farblosen Hadronen zusammengefaßt. Der Zerfall kurzlebiger Teilchen muß dann ebenso beachtet werden wie Detektoreffekte, die durch unsensitve Detektorregionen oder die unterschiedlichen Detektoreffizienzen entstehen.
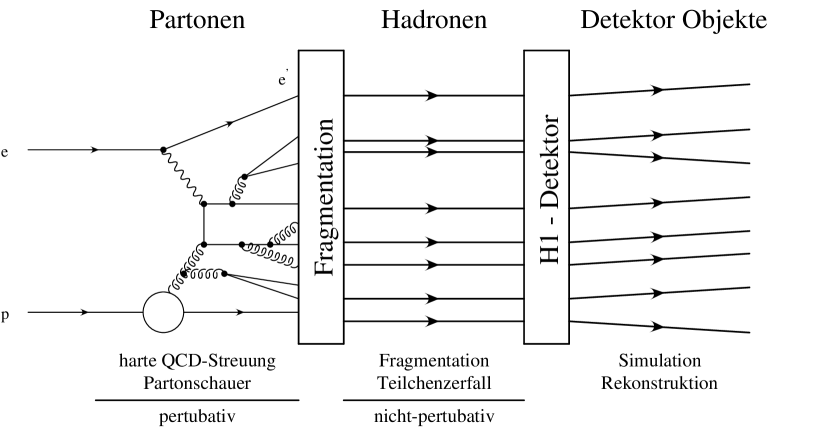
Im folgenden werden die Schritte kurz erläutert. Genaueres ist der Literatur über Monte-Carlo-Generatoren bzw. den Programmanleitungen zu entnehmen ([Sey95], [Ham93], [Ing92], [MKSW93], [Lö94], [CSS93]).
3.2.1 Beschreibung auf Parton-Niveau
Wir haben bereits im vorigen Abschnitt die einzelnen, für uns interessanten Prozesse betrachtet. Anhand dieser Wirkungsquerschnitte wird dann bei den Simulationen ein Ereignis gewürfelt.
Leider gibt es keinen Ereignisgenerator, der Ereignisse auf der Basis von NLO Berechnungen erzeugen kann. Alle vorhandenen Programme benutzen Matrixelemente in führender Ordnung (LO) für die Erzeugung von 2+1 Ereignissen.
Um dennoch die Korrekturen berücksichtigen zu können, die durch Gluonabstrahlung in höheren Ordnungen entstehen, werden als Ausweg QCD-inspirierte Partonschauer (PS, parton shower) verwendet. Diese Partonschauer müssen von den Abstrahlungen in höheren Ordnungen der QCD unterschieden werden, da die Schauer unabhängig vom harten Subprozeß angewandt werden. Es treten somit keine Interferenzen oder virtuelle Korrekturen auf. Partonschauer haben sich zusammen mit der im nächsten Abschnitt erläuterten Hadronisierung als nützliches Hilfsmittel bei der Beschreibung der Daten erwiesen.
Wir müssen hierbei zwischen zwei Fällen unterscheiden : Zum einen kann die Gluonabstrahlung vor der Streuung erfolgen (initial state parton shower), zum anderen danach (final state parton shower).
Bei den final state Partonschauern treten zwei Divergenzen auf, d.h. an diesen Stellen im Phasenraum wird die Abstrahlwahrscheinlichkeit eins bzw. der Wirkungsquerschnitt für diesen Prozeß unendlich. Eine Divergenz erhalten wir bei Kollinearität, d.h. wenn der Impuls des abgestrahlten Gluons in die gleiche Richtung zeigt wie der des abstrahlenden Partons. Dieses Problem können wir durch einen Abschneideparameter beseitigen, der z.B. eine minimale invariante Masse des Gluon Parton Paares verlangt. Der andere Fall tritt bei weicher Abstrahlung auf, d.i. wenn das Gluon eine sehr geringe Energie erhält. Auch dieses Problem läßt sich software-technisch umgehen, wobei es jedoch mehrere Vorgehensweisen gibt, deren Erklärung hier zu weit führen würde.
Bei initial state Partonschauer ist die Situation noch wesentlich komplizierter. Das größte zusätzliche Hindernis ist die Veränderung der Energie des Partons durch die Abstrahlung und damit der Kinematik des harten Prozesses. Dies können wir durch Rückwärtsentwicklung umgehen, d.h. es wird nicht die Energie des Partons nach Abstrahlung verringert, sondern die vor der Abstrahlung vergrößert.
Es ergeben sich weitere Probleme, wenn wir mehrfache Gluonabstrahlung berücksichtigen. Die verschiedenen Modelle haben unterschiedliche Algorithmen, die z.B. die Reihenfolge, in der die Gluonen entstehen, und den Abschneidepunkt, wann dieses Verfahren abzubrechen ist, betreffen.
Das Ariadne Monte-Carlo-Programm benutzt mit dem Colour Dipole Model ein völlig anderes Schema, das Partonschauer komplett umgeht. Die einzelnen Farb–Antifarb–Paare werden als Dipole verstanden, die analog der Elektrodynamik durch Polarisation neue Dipole hervorrufen.
3.2.2 Die Hadronisierung
Bei der Hadronisierung werden aus den farbigen Partonen farblose Hadronen gebildet. Es ist bisher noch nicht gelungen diesen Vorgang theoretisch zu beschreiben, da hier der pertubative Bereich verlassen wird und die Störungsrechnung somit nicht mehr funktioniert.
Die beiden meistbenutzten Modelle sind die Cluster Fragmentation und die String Fragmentation.
Beim Cluster Modell werden jeweils zwei im Phasenraum benachbarte Partonen entsprechend ihren Farbladungen zu einem sogenannten Cluster kombiniert, der dann entsprechend seiner Energie, Ladung und der vorhandenen Quarkarten in Hadronen zerfällt.
Das String Modell hingegen benutzt ein sehr anschauliches Analogon. Es zieht zwischen der Farbladung und der zugehörigen Antifarbladung eine “Saite“, die analog den Feldlinien in der Elektrodynamik Energie enthält. Aufgrund des color confinements ist die Energie hier jedoch proportional zur Länge der Feldlinien. Wird die Saite zu lang und damit die Spannung zu groß, so reißt diese und es entsteht ein neues Quark Antiquark Paar. Die Saiten, die am Ende des Verfahrens vorhanden sind, bilden dann die Hadronen.
Die Probleme in beiden Modellen liegen in der Erzeugung von Baryonen, da diese nicht aus Quark Antiquark Paaren, sondern aus jeweils drei Quarks bestehen. Leider versagen die Modelle hier und nur durch einige Tricks und eine große Anzahl freier Parameter ist es im String Modell gelungen, eine Beschreibung der existierenden Daten zu erreichen.
Im abschließenden Schritt auf Hadronniveau müssen die Teilchenbahnen nun im Magnetfeld berechnet und der Zerfall kurzlebiger Komponenten in Betracht gezogen werden. Dies ist durch die Kenntnisse der Zerfallszeiten und der verschiedenen Kanäle jedoch verglichen mit den vorhergehenden Schritten einfach und durch die Theorie beschrieben.
3.2.3 Beschreibung auf Detektor-Niveau
Im letzten Schritt werden die Detektoreffekte simuliert. Die danach vorhandenen Daten entsprechen denen gemessener Ereignisse. Wir haben nur noch solche Werte, die z.B. der Ladungsverteilung in den Kalorimetern oder den Treffern in den Spurkammern entsprechen.
Diese Stufe ist unabhängig von den Monte-Carlo-Generatoren und wird von GEANT [GEA93] mit speziellen H1 Anpassungen durchgeführt [H1 95a].
Die Daten lassen sich nun mit den wirklichen Meßergebnissen des Detektors vergleichen. Um dies einfacher zu gestalten werden im abschließenden Rekonstruktionsschritt Teilchenidentifikationen, Energieumrechnungen, Klassifizierungen und andere Berechnungen durchgeführt [H1 95c].
Kapitel 4 Messungen mit Jet-Raten
4.1 Jets
Wir werden nun Messungen durchführen und dann mit den dabei gewonnenen Detektordaten die Theorie testen. Dazu ist es notwendig eine Verbindung zwischen dem Detektorniveau und dem Partonniveau zu suchen.
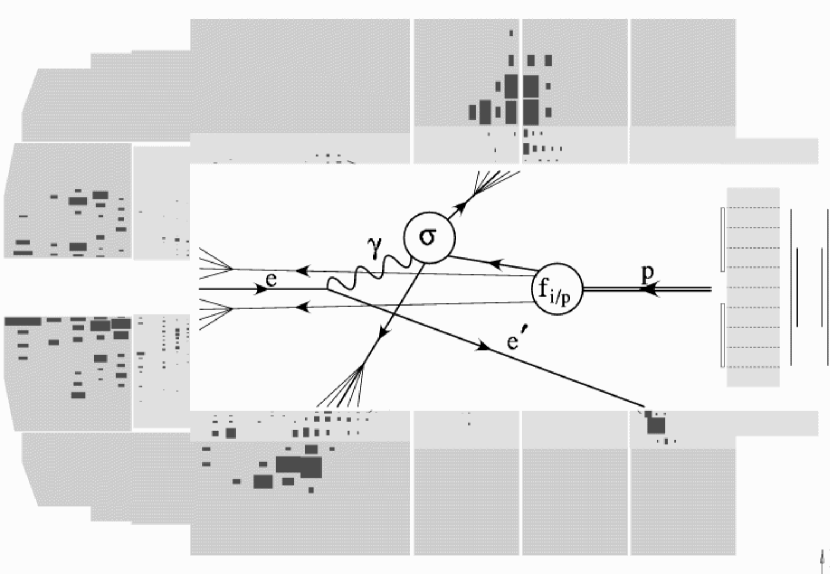
Wenn wir erst den Zwischenschritt über das Hadronniveau machen, so können wir erkennen, daß aus einigen wenigen Partonen eine wesentlich größere Anzahl Hadronen entstanden ist. Ein einfaches Modell, das eine Lokale Parton Hadron Dualität (LPHD, local parton hadron duality) vorhersagt, ist dabei erstaunlich erfolgreich. Die Grundidee ist hierbei, daß die Anzahl der Hadronen in einem Phasenraumbereich proportional zur Anzahl der Partonen ist [Sey95]. Die Aussagekraft des Modells ist zwar stark begrenzt, aber es zeigt uns, daß wir mehrere Hadronen zu einem Gebilde, das wir Jet nennen, zusammenfassen müssen.
Auf Detektorniveau tritt das gleiche Phänomen auf, da die Hadronen auf ihrem Weg durch den Detektor an unterschiedlichen Stellen Energie deponieren und nicht immer sofort gestoppt werden. Aufgrund der begrenzten Raumauflösung der Detektorzellen können wir jedoch die genaue Anzahl der Ladungsdepositionen kaum erfassen. Es ist deshalb sinnvoller Bereiche mit hohem Ladungsinhalt zu sogenannten Clustern zusammenzufassen.
Einen Überblick über die Anzahl Partonen, Hadronen und Cluster pro Ereignis gibt Abbildung 4.2.
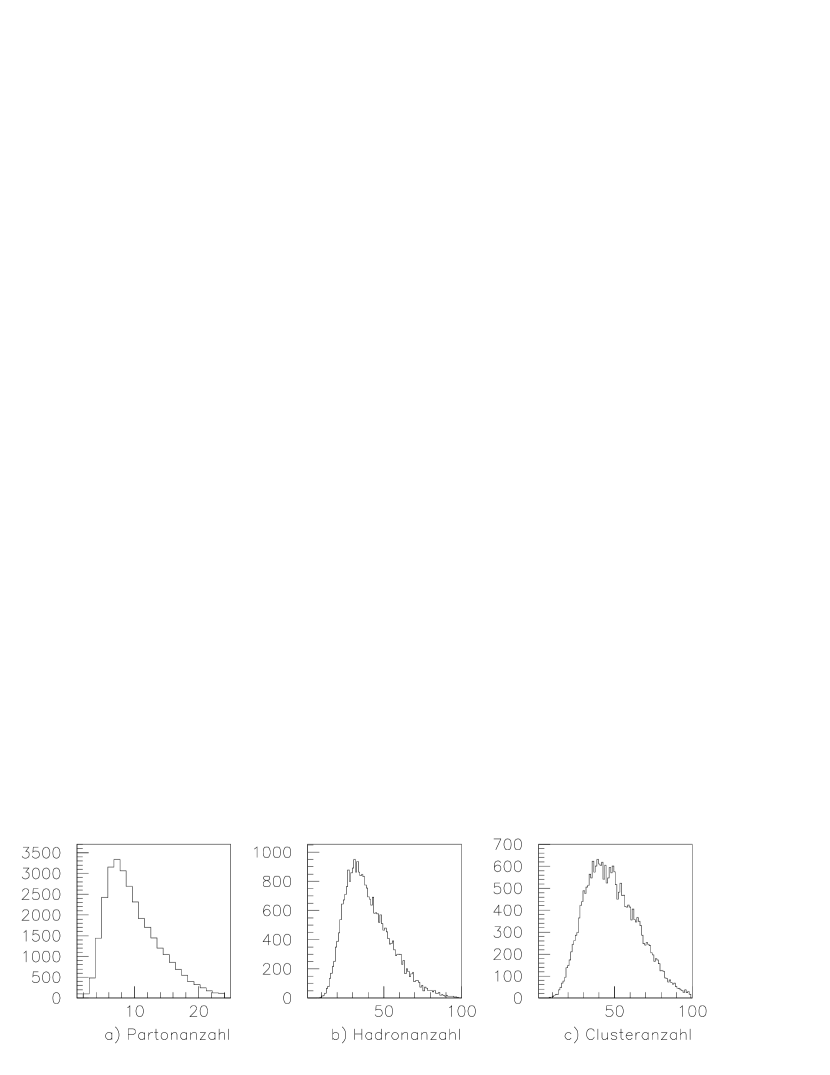
Wir müssen somit einen Algorithmus entwerfen, der Hadronen oder Cluster zu Jets zusammenfaßt. Sind zwei Partonen eng benachbart, so kann es vorkommen, daß beide Partonen auf Hadronniveau nur einen Jet ergeben. Deshalb ist es sinnvoll den gleichen Algorithmus auch auf die Partonen anzuwenden und diese Fehlinterpretationen im Wirkungsquerschnitt zu berücksichtigen. Dies haben wir im Kapitel 3.1.6 jedoch schon getan. Der Begriff Objekt beschreibt im folgenden somit Partonen, Hadronen bzw. Cluster in Abhängigkeit des betrachteten Niveaus.
Einige Jetalgorithmen werden nun vorgestellt. Zur Berechnung der NLO Wirkungsquerschnitte existieren nur die beiden Programme PROJET[Gra93] und DISJET[BM94]. Da in diesen nur der JADE Algorithmus eingebaut ist, sind wir gezwungen diesen zu verwenden. Für die Zukunft sind verschiedene neue Programme angekündigt bzw. befinden sich zur Zeit in der Testphase, die mehrere verschiedene Algorithmen enthalten. Daher beschränken wir uns hier nicht auf den JADE Algorithmus.
4.1.1 Cone Algorithmus
Der Cone Algorithmus ist sicher der intuitivste, da er räumlich benachbarte Partikel zu einem Jet zusammenfaßt. Die Abstandsberechnung geschieht hierbei über den Azimutalwinkel und die Pseudorapidität die mit dem Polarwinkel über
| (4.1) |
zusammenhängt. Der Algorithmus startet mit einer Anzahl Jet Kandidaten, die Partikeln mit einer transversalen Energie größer als das einstellbare Minimum entsprechen. Dann werden alle Partikel hinzugefügt, die in einem Radius
| (4.2) |
um den Kandidaten mit dem höchsten transversalen Impuls liegen. Dies wird dann der Reihe nach mit allen Kandidaten wiederholt. Am Ende werden alle Kandidaten, die eine bestimmte transversale Mindestenergie besitzen, als Jet aufgefaßt.
4.1.2 JADE und verwandte Algorithmen
Bei den Clusteralgorithmen wird nicht der räumliche Abstand als Maß verwendet, sondern die invariante Masse zweier Partikel. Meist wird die invariante Masse jedoch durch eine Skala geteilt, um unabhängig von der Energie des stattfindenden Prozesses zu werden. Bei Collidern wird die Schwerpunktenergie verwendet, bei HERA verwenden wir die invariante Masse des hadronischen Endzustandes Eine Begründung hierzu kann in [Nis94b] Kapitel 5.1 gefunden werden. Es ergibt sich dann als Schnittgröße
| (4.3) |
Der Algorithmus besteht aus drei Schritten, die bis zur Erfüllung der Abbruchbedingung wiederholt werden.
-
1.
Für alle möglichen Objektpaare wird die invariante Masse berechnet. Es wird der niedrigste Wert bestimmt.
-
2.
Ist so wird das Verfahren abgebrochen und die übrig gebliebenen Objekte entsprechen den Jets. Ansonsten wird mit der Berechnung fortgefahren.
-
3.
Die Teilchen und werden zusammengefaßt und das Summenteilchen wird an ihrer Stelle in die Liste aufgenommen. Der Algorithmus fängt nun wieder mit Schritt 1, der Berechnung der invarianten Massen, von vorne an.
Für die Rekombination zweier Teilchen gibt es keine vorgeschriebene Regel, da in der Theorie mit masselosen Objekten gerechnet wird. In der Praxis haben die Partikel jedoch eine nicht verschwindende Masse. Zusätzlich ergibt sich bei Addition der Vierervektoren eine Masse, die nicht der Summe der Massen der Ausgangsteilchen entspricht. Die unterschiedlichen Ideen haben zu verschiedenen Algorithmen geführt, die in Tabelle 4.1 aufgelistet sind.
| Schema | Berechnung von | Rekombination | Anmerkungen |
| JADE | Massen werden bei | ||
| Berechnung vernachlässigt | |||
| E | lorentz-invariant | ||
| E0 | ist nicht erhalten | ||
| P | nicht erhalten | ||
Im Gegensatz zum Cone Algorithmus wird hier keine minimale transversale Energie für die Jets verlangt. Somit sollte ein Jet, der durch den Protonrest (remnant) entsteht, gefunden werden. Dies geschieht auch auf Parton- und Hadronniveau. Auf dem Detektorniveau hingegen verläßt der größte Teil des Remnants den Detektor durch das Strahlrohr. Aus diesem Grunde werden die Cluster um ein Pseudoteilchen erweitert, dessen transversaler Impuls zu Null gesetzt wird.
| (4.4) | |||||
wobei die Summe über alle Cluster einschließlich derer des gestreuten Elektron läuft. Zusätzlich ist die Kenntnis über den gesamten hadronischen Endzustand, inklusive Protonrestes, zur Berechnung erforderlich. Weiteres zum Pseudoteilchenansatz ist in [GM91] und [Nis94b] zu finden, der JADE Algorithmus ist in [JAD86] näher beschrieben.
4.1.3 Algorithmus
Der Algorithmus benutzt die Partikel nicht im Labor- sondern im Breitsystem, in dem das an der Streuung teilnehmende Parton durch das Photon wie an einer Wand zurückgeworfen wird (siehe auch Abbildung 4.3).
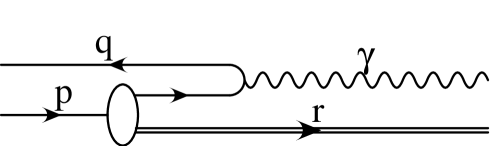
Wir können uns das Verfahren zweigeteilt vorstellen. Im ersten Schritt wird der Protonrest von den übrigen sogenannten Macro Jets separiert und diese Macro Jets werden dann im abschließenden Schritt aufgetrennt.
Der erste Schritt kann dabei folgendermaßen beschrieben werden :
-
1.
Zuerst wird eine Skala definiert, die die harte Streuung umschreibt.
-
2.
Dann wird der Schnittwert für alle Objekte relativ zum einlaufenden Proton
und für alle Objektpaare
bestimmt.
-
3.
Es wird das Minimum aller berechnet und in Abhängigkeit des Ergebnisses einer der folgenden Schritte eingeleitet :
-
•
Sind alle Schnittwerte größer 1, so wird das Verfahren abgebrochen und mit dem zweiten Teil des Algorithmus begonnen.
-
•
Ist ein kleiner als alle anderen Schnittwerte, so wird das Objekt in den Beamjet aufgenommen, d.h. für die weitere Berechnung verworfen.
-
•
Ist ein kleiner als alle anderen Schnittwerte, so werden die beiden Objekte und zu einem neuen Partikel zusammengefaßt.
-
•
-
4.
Die Schritte 2 und 3 werden solange wiederholt, bis die Abbruchbedingung erfüllt ist. Die übrigbleibenden Partikel werden als Macro Jets bezeichnet.
Im zweiten Teil des Verfahrens werden nun nur noch die nicht zum Beamjet gehörenden Objekte verwendet, d.h. die im ersten Teil entstandenen Macro Jets werden wieder in die Ursprungscluster zerlegt.
-
1.
Wir definieren nun einen Schnittwert
-
2.
Für alle Okjektpaare wird nun analog zum ersten Teil berechnet.
-
3.
Ist das Minimum aller kleiner als unser Auflösungsparameter so wird das Verfahren fortgesetzt, ansonsten ist der Jetalgorithmus hier beendet und die verbliebenen Partikel ergeben die gesuchten Jets.
-
4.
Die beiden Objekte, die das minimale bilden, werden rekombiniert. Die verschiedenen Schemata sind analog denen des JADE Algorithmus definiert. Danach wird das Verfahren ab Schritt 2 wiederholt.
4.2 Die Messung der starken Kopplungskonstante
Wenden wir uns nun der Messung eines der entscheidenden QCD-Parameter zu. Die Kopplung der starken Wechselwirkung wird durch die laufende Kopplungskonstante beschrieben. Wie wir schon in Kapitel 3.1.5 gesehen haben, können wir den Wirkungsquerschnitt durch die Störungsrechnung in Potenzen der Kopplungskonstante beschreiben.
Tun wir dies nun bis zur nächst-zur-führenden Ordnung in Abhängigkeit der Jetanzahlen, so erhalten wir :
| (4.5) | |||||
| (4.6) |
Hierbei lassen sich die aus den Wirkungsquerschnitten berechnen. Sie beschreiben Ereignisse mit Jets, d.h. harten Jets und dem Protonrest, und sind Beiträge in Ordnung
Da wir die Wirkungsquerschnitte nicht direkt messen, sondern nur die Anzahl an Jetereignissen bestimmen können, ist es sinnvoll mit der Jetrate zu rechnen. Außerdem erreichen wir dann Unabhängigkeit von Fehlern in der Luminositäts- und Effizienzenbestimmung.
Die 2+1 Jetrate ist definiert durch :
| (4.7) | |||||
| (4.8) |
und trägt der Möglichkeit Rechnung, daß manche 2+1 Ereignisse zwar zum totalen Wirkungsquerschnitt gerechnet werden, aufgrund von Phasenraumschnitten, z.B. im Jetwinkel, jedoch nicht zur 2+1 Jetanzahl.
Wir können diese Gleichung nun nach auflösen und erhalten dann
| (4.9) |
Damit können wir durch Messung der Jetrate und Berechnung der Koeffizienten bei verschiedenen die Stärke der starken Kopplung und deren Laufen mit bestimmen.
Einsichtig ist, daß wir die Faktoren nur von der Theorie, d.h. auf Partonniveau, berechnen können. Daher müssen wir dafür sorgen, daß unsere auf Detektorniveau gemessene Jetrate der auf Partonniveau entspricht. Ansonsten müssen wir einen Korrekturfaktor
| (4.10) |
einführen.
4.3 Die Messung der Gluondichtefunktion
Nahezu analog gestaltet sich die Berechnung der Gluondichtefunktion
Hier beruht die Messung auf der Aufteilung des Wirkungsquerschnittes in einen quark-induzierten und einen gluon-induzierten Teil.
| (4.11) |
Um die Messung direkt auszuführen ist es notwendig, QCD–Compton Ereignisse (Abbildung 3.6a) von Boson-Gluon-Fusion Ereignissen (Abbildung 3.6b) zu trennen, da wir so die Integrale über die beiden Terme einzeln messen können. Um dann die Dichtefunktion zu bestimmen, müssen wir die einzelnen Wirkungsquerschnitte berechnen und eine Parametrisierung der Quarkdichtefunktionen einsetzen. Die Dichtefunktionen der Quarks sind wesentlich genauer bekannt als die der Gluonen.
Auch hier kann man durch Teilen der Gleichung 4.11 durch die Effizienzen und die Luminosität zu unseren Meßgrößen, den Jetanzahlen gelangen. Für dieses Verfahren ist also eine verläßliche Jeterkennung und die richtige Behandlung der Partonjet–Detektorjet–Korrelation wichtig.
Bei einer NLO Berechnung können wir die oben beschriebene Aufteilung nicht mehr vornehmen. Dies ist an Abbildung 3.7b zu erkennen. Wir können den Prozeß als Boson–Gluon–Prozeß rechnen, wenn wir, wie in dem Feynman–Graphen angedeutet, das Gluon zum Quark fassen, oder wir können das Ereignis zu den QCD–Compton Ereignissen zählen, wenn das aus dem Paarbildungsprozeß entstandene Antiquark kollinear zum Protonrest ist und wir es somit zum Remnant packen.
Die einzige Möglichkeit ist also, das komplette Integral zu fitten. Um den Fit durchzuführen, müssen wir jedoch die Wirkungsquerschnitte für jeden Fitschritt neu berechnen. Dies ist mit der heutigen Rechnertechnologie nicht möglich.
Ein Ausweg bietet die Methode der Mellin Transformation. Gehen wir durch eine solche Transformation in den Momentenraum über, so läßt sich dort das Moment des Wirkungsquerschnittes als Produkt der Momente der Partondichtefunktionen und der Momente der Einzelwirkungsquerschnitte für den aktuellen kinematischen Bereich berechnen. Führen wir nun den Fit nur in bestimmten vorgegebenen Phasenraumintervallen durch, so müssen die Momente der Einzelwirkungsquerschnitte an den Stützstellen nur einmal berechnet werden. Da dies der zeitaufwendige Teil ist, die Transformation der Dichtefunktionen und die Rücktransformation der Momente aber schnell erfolgen kann, haben wir hiermit eine Möglichkeit gefunden den Fit in nächst-zu-führender Ordnung durchzuführen [GHVB95].
Kapitel 5 Ergebnisse der Untersuchungen
5.1 Datensätze
Wir wollen nun die Korrelation zwischen den Jets auf Parton- und denen auf Detektorniveau genauer untersuchen. Dazu benötigen wir die schon angesprochenen Monte-Carlo-Simulationen. In dieser Arbeit verwenden wir Datensätze, die mit den Programmen Lepto 6.1 [Ing92], Herwig 5.8 [MKSW93] und Ariadne 4.3 [Lö94] erzeugt wurden. Meist wird eine Unterteilung in einen niedrigen und einen hohen Bereich vorgenommen, da das Elektron dann ins rückwärtige Kalorimeter bzw. ins Flüssig–Argon–Kalorimeter gestreut wird. Die einzelnen Datensätze sind in Tabelle 5.1 aufgeführt.
| Generator | Anzahl Ereignisse | Simulationsversion | Kürzel |
| Datei | Format | Rekonstruktionsversion | Bereich |
| Lepto 6.1 | 29998 | 3.06/06 | MEPSHQ |
| MEPS3621 | DST111DST bedeutet Data Summary Tape | 6.00/20 | |
| Lepto 6.1 | 99031 | 3.06/06 | MEPSLQ |
| MEPS3620 | DST | 6.00/20 | |
| Ariadne | 22715 | 3.05/04 | ARHQ |
| MEAR3652 | V2222Version 2 der Files, H1 Standardformat | 5.02/18 | |
| Ariadne | 87248 | 3.05/03 | ARLQ |
| MEAR3641 | DST | 6.00/12 | |
| Herwig 5.8 | 34998 | 3.06/27 | HEHQ |
| MEPS3604 | DST | 6.01/08 | |
| Herwig 5.8 | 63039 | 3.06/14 | HELQ |
| MEPS3602 | DST | 6.01/05 | |
| Generator | Anzahl Ereignisse | Format | Kürzel |
| Daten | 21651 | DST6 | DAHQ |
| Daten | 162892 | DST6 | DALQ |
Zum Vergleich mit den Daten wurden die vorselektierten333Die Vorselektion wurde von der H1-ELAN Gruppe vorgenommen, eine genauere Selektion auf DIS Ereignisse von der Jet-Gruppe. Meßwerte aus der Datennahme des Jahres 1994 verwendet. Um eine Verfälschung der Daten gegenüber den zur Verfügung stehenden Monte-Carlos zu verhindern, wurden nur Positron Runs mit nominellem Vertex verwendet. Es gibt sich somit eine zur Verfügung stehende integrierte Luminosität von Die Daten sind ebenfalls in die beiden Bereiche aufgeteilt. Genaueres ist der Tabelle 5.1 zu entnehmen.
5.2 Standardschnitte
Die in diesem Kapitel erläuterten Schnitte werden benötigt, um zum einen möglichst viele Nicht–DIS Ereignisse zu verwerfen und zum anderen spezielle Eigenarten der Hard- und Software zu berücksichtigen.
5.2.1 Kinematische Variablen
Wie in Kapitel 3.1.2 erläutert, benötigen wir für die Berechnung der Reaktionskinematik Kenntnis über nur zwei unabhängige Variablen. Wir wollen nun die verschiedenen Berechnungsmethoden genauer betrachten.
In Abbildung 5.1 ist die Qualität der Bestimmung für vier Methoden gezeigt. Auf der Abszisse ist das vom Generator zur Erzeugung des Ereignisses benutzte negative Quadrat des Viererimpulsübertrages aufgetragen, auf der Ordinate jeweils der auf Detektorniveau rekonstruierte Wert. Verwendet wurden die Elektron- die Doppelwinkel- die Sigma- [BB94] und die Jacquet-Blondel-Methode Gezeigt sind die Daten der Lepto-Monte-Carlos (MEPSHQ, MEPSLQ). Die Größe der Boxen in diesen Diagrammen gibt jeweils die Anzahl der Ereignisse in diesem Bereich an. Der Maßstab ist hierbei logarithmisch, so daß auch einzelne Einträge noch eine kleine Box erzeugen. Insgesamt erkennen wir, daß die Rekonstruktion mit allen Methoden gut funktioniert. Die Jacquet-Blondel Methode ist von der Auswertung des hadronischen Endzustandes besonders abhängig. Dadurch haben Detektorverluste und die hadronische Energiekalibration einen großen Einfluß. Deshalb sind hier auch die größten Abweichungen erkennbar. Die Sigma Methode ist der Jacquet-Blondel Methode sehr ähnlich, durch Verwendung der Größe des totalen Ereignisses im Gegensatz zur zweifachen Strahlelektronenergie ist die Abhängigkeit von der Bestimmung des hadronischen Endzustandes geringer. Außerdem berücksichtigt sie damit Photonabstrahlungen am einlaufenden Elektronast. Diese Abstrahlungen sind in unseren Datensätzen nicht vorhanden und die Sigma Methode kann ihren Vorteil nicht voll ausspielen. Die Elektronmethode, die vollkommen unabhängig vom hadronischen Endzustand ist, ist über den gesamten kinematischen Bereich gesehen die geeigneteste.
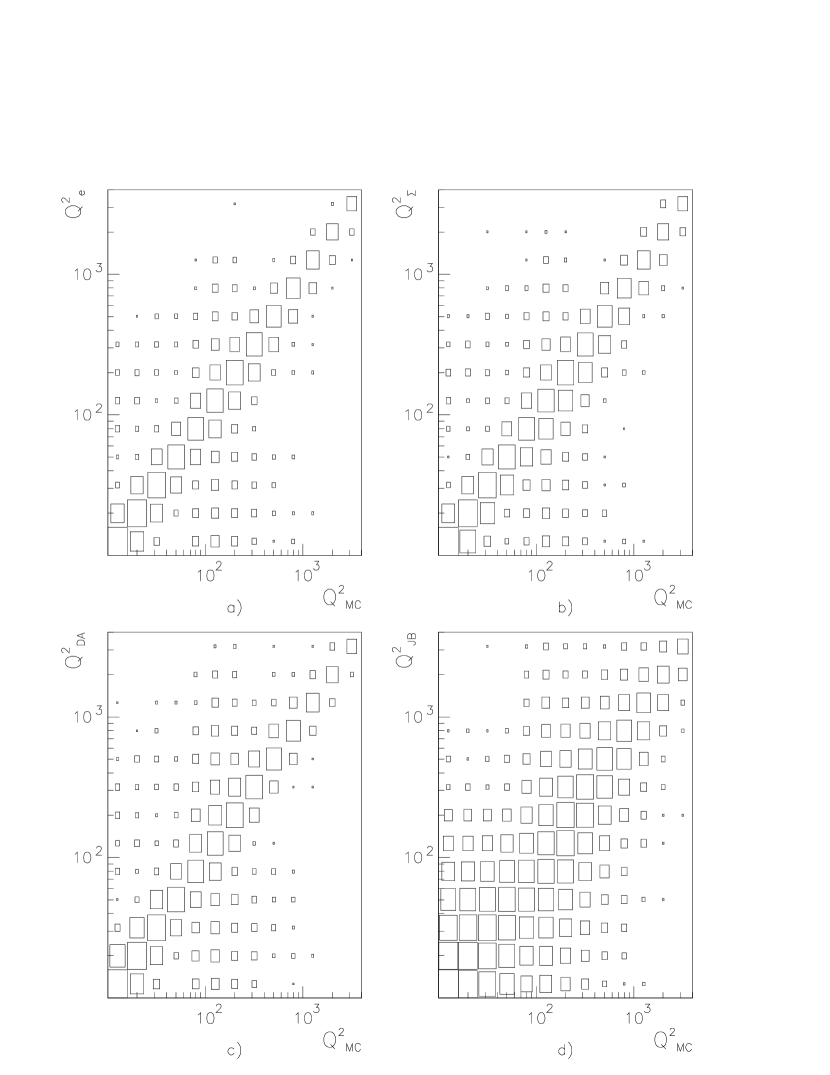
Die Bestimmung der zweiten, von unabhängigen Variable kann ebenfalls über die obengenannten Methoden erfolgen. Die entsprechenden Verteilungen sind für die hohen in Abbildung 5.2, für die niedrigen in Abbildung 5.3 gezeigt.
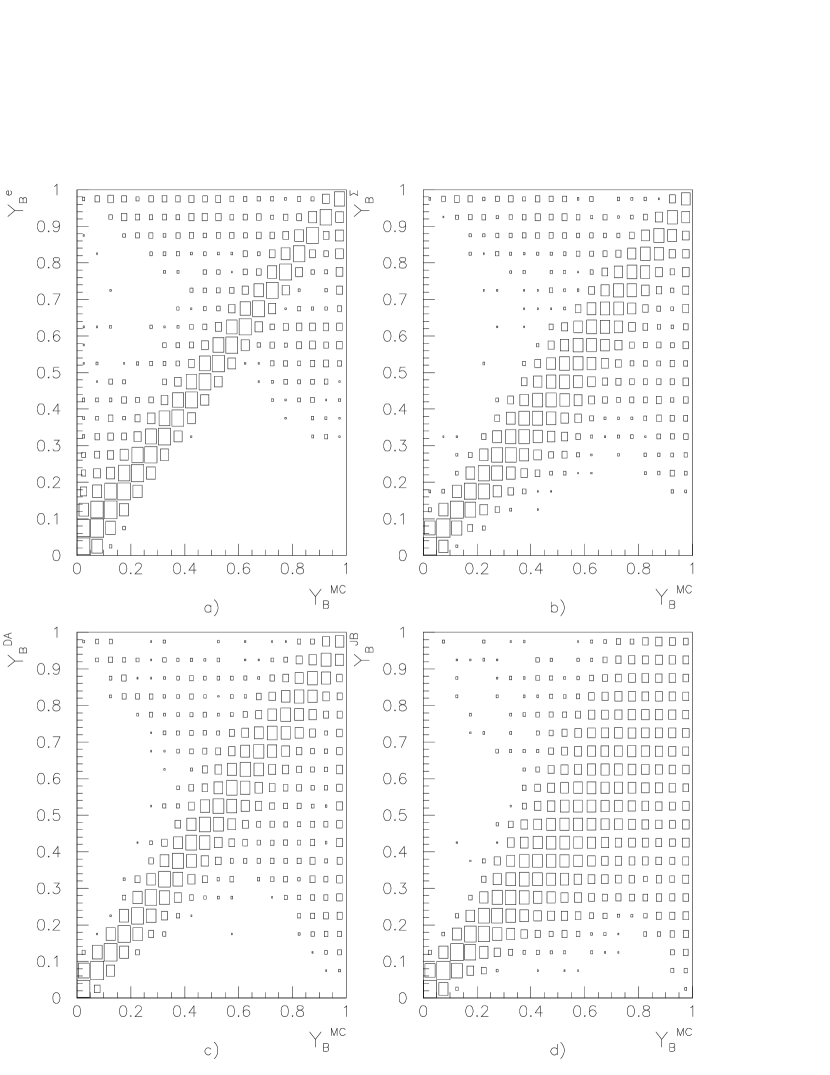
Bei hohen zeigt die Verteilung ebenfalls eine gute Übereinstimmung bei allen Methoden. Bei größer werden jedoch auch die Abweichungen größer. In diesem Bereich ist der Untergrund durch Photoproduktionsereignisse groß, da das gestreute Elektron den Detektor unbeobachtet durch das Strahlrohr verläßt und niederenergetische Hadronen ein Elektron mit hohem vertäuschen können. Deshalb betrachten wir im weiteren nur Ereignisse mit Vergleichen wir die unterschiedlichen Methoden, so ist auch hier die Elektronmethode die genaueste. Nur in Bereich erhalten wir mit der Doppelwinkelmethode die höchste Genauigkeit.
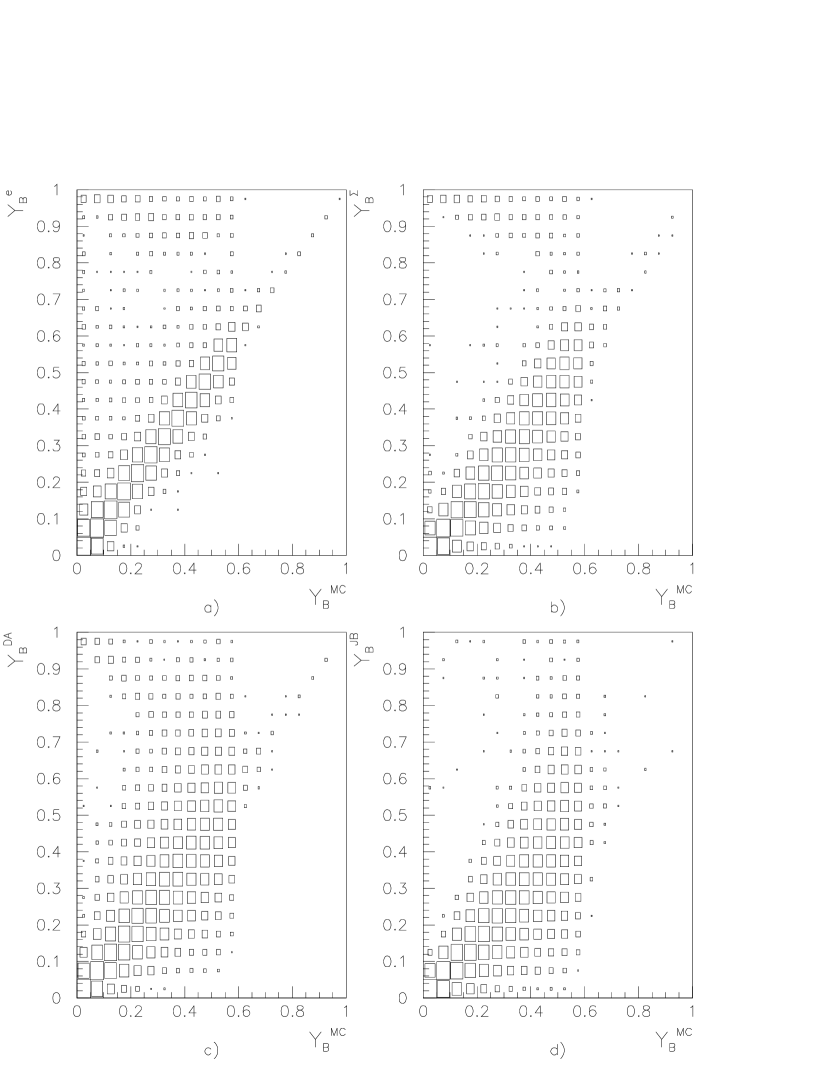
Für kleiner fällt auf, daß kaum Einträge mit vorhanden sind. Dies ist durch den Zusammenhang zwischen , der Energie des gestreuten Elektrons und dessen Winkel durch die Gleichung 3.8 erklärbar. Der Rand des BEMC bei und die minimale Clusterenergie des Elektronkandidaten von ergeben dann eine Abschätzung für den Grenzwert.
| (5.1) | |||||
Die geringe Ereignisanzahl mit entsteht ausnahmslos durch Ereignisse mit generiertem die durch das Fehlen eines oberen Schnittes im MEPSLQ Monte-Carlo entstehen. Diese Elektronen fallen deshalb nicht in den Bereich des BEMC und die oben angegebene Schranke gilt nicht. Eine Aufteilung und Untersuchung der gestreuten Elektronen in Abhängigkeit der Detektorkomponente wird in Kapitel 5.2.3 vorgenommen. Ansonsten erkennen wir auch hier ein Verhalten analog dem bei hohen Werten.
Zusammenfassend können wir also aus der Rekonstruktion der kinematischen Größen schließen :
-
•
Die Berechnung von erfolgt im gesamten Phasenraum am besten durch die Elektronmethode.
-
•
Die Berechnung von erfolgt für mit der Elektronmethode, ansonsten mit der Doppelwinkelmethode.
-
•
Ein Schnitt auf ist aufgrund von Problemen bei der Rekonstruktion und aufgrund des Photoproduktionsuntergrundes sinnvoll.
5.2.2 Kinematische Schnitte
Ein weiterer Schnitt ergibt sich aus den Strahlungskorrekturen. Diese sind bei kleinem bzw. bei kleinem besonders groß.
Nach Gleichung 3.10 gilt Dies ist in Abbildung 5.4a verdeutlicht. Wir erkennen, daß ein Schnitt von ungefähr einem Schnitt entspricht. Dies gilt nahezu unabhängig von Die Verteilung für alle MEPS Ereignisse ist in Abbildung 5.4b gezeigt.
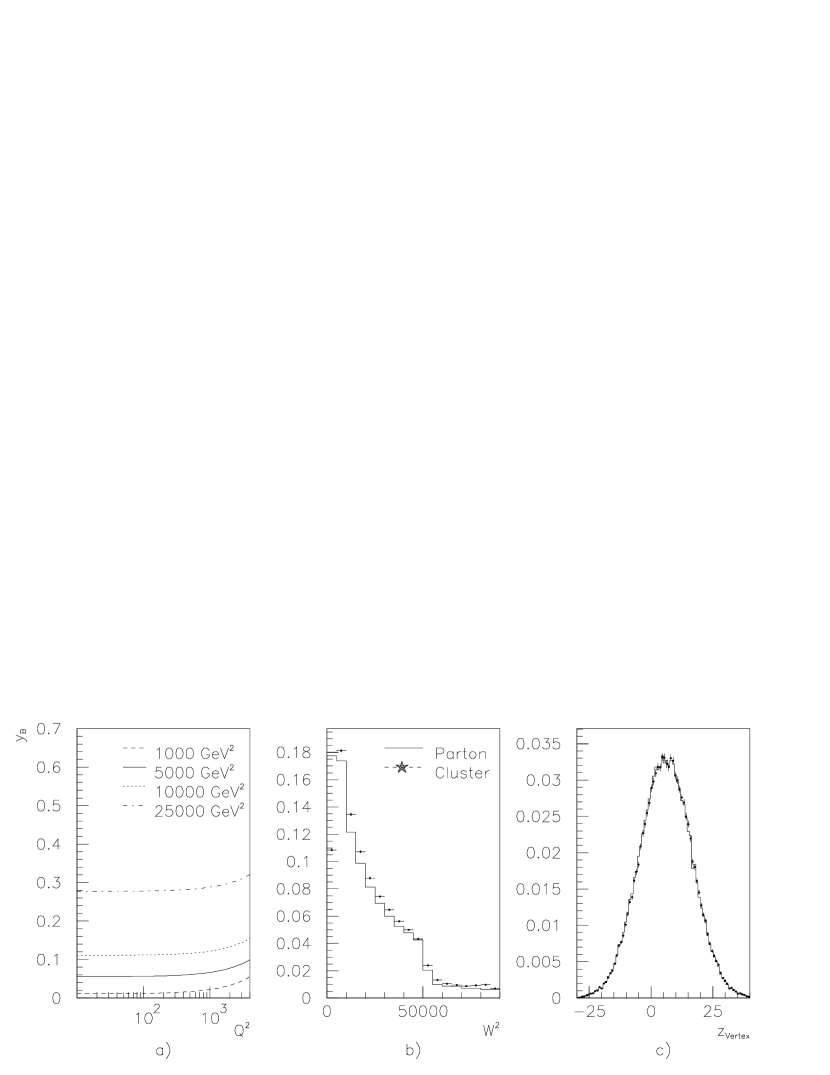
Wie wir in Kapitel 4.2 gesehen haben, sind unsere Jetraten unabhängig von den Effizienzen und der Luminosität. Dies gilt natürlich nur dann, wenn wir keinen Effizienzunterschied in den einzelnen Ereignissen berücksichtigen müssen. Es ist sinnvoll den Bereich des primären Vertex einzuschränken, da so bei jedem Ereignis die Detektorkomponenten unter den gleichen Winkeln erscheinen und wir damit für alle Ereignisse gleiche Bedingungen erhalten. Die einlaufenden Teilchenstrahlen sind in der -Ebene stark gebündelt. Daher ist nur ein Schnitt in Strahlrichtung sinnvoll. Die Verteilung für die beiden Lepto-Monte-Carlo sind in Abbildung 5.4c gezeigt. Der nominale Wechselwirkungspunkt liegt bei Einen Schnitt von erfüllen 2% der Ereignisse nicht.
Wir führen somit folgende kinematischen Schnitte ein :
-
•
-
•
5.2.3 Methoden zur Identifizierung des gestreuten Elektrons
Wir haben gesehen, wie wichtig es für die kinematischen Berechnungen bei Verwendung der Elektronmethode ist, das gestreute Elektron richtig im Detektor zu identifizieren.
Da das Elektron in zwei verschiedene Detektorkomponenten gestreut werden kann, benutzen wir für jede eine eigene Routine, sogenannte Elektronfinder. Im Flüssig–Argon–Kalorimeter wird die Routine QFSELH, im rückwärtigen elektromagnetischen Kalorimeter die Routine QFSELM verwendet. Beide sind in der offiziellen H1 Funktionsbibliothek H1PHAN[H1 95b] enthalten und wurden mit Ausnahme des Schnittes mit den voreingestellten Steuerkarten benutzt. Der Schnitt wurde nicht in der QFSELH Routine durchgeführt, sondern erst nach der Suche der Elektronkandidaten.
Wurden keine Elektronkandidaten gefunden, so wird das Ereignis auf Detektorniveau verworfen. Ergibt die Suche in nur einer Routine einen Kandidaten, wird dieser für die weitere Betrachtung verwendet. Finden jedoch beide Routinen einen Kandidaten, so wird der Kandidat im BEMC als gestreutes Elektron identifiziert, wenn dessen Energie größer als ist. Ansonsten wird für die nachfolgenden Schnitte der LAr Kandidat verwendet. Dadurch verwerfen wir Elektronkandidaten, die durch Hadronen im BEMC vorgetäuscht werden.
Nachdem somit ein Kandidat festgelegt ist, werden in Abhängigkeit von der registrierenden Detektorkomponente die in den folgenden Abschnitten erläuterten Bedingungen überprüft.
Auf Partonniveau werden die Schnitte anhand des Bereiches ausgewählt, d.h. für werden die BEMC Schnitte, ansonsten die LAr Schnitte durchgeführt.
Elektronkandidaten im BEMC
Für Elektronkandidaten im BEMC werden einige zusätzliche Schnitte eingeführt.
Im Bereich kleiner Viererimpulsüberträge ist eine Kontamination des Datensatzes durch Photoproduktionsereignisse zu erwarten. Diese Ereignisse verwerfen wir durch ein minimales von und eine minimale Energie des Kandidaten von
Ebenso sollte durch eine Winkelüberprüfung sichergestellt werden, daß das gestreute Elektron auch wirklich in den Bereich des BEMC fällt.
Da im BEMC in der Mitte aufgrund des Strahlrohres ein quadratischer Bereich unbestückt ist, müssen wir Kandidaten aus diesen Bereich durch einen Schnitt auf die und Koordinate des Elektronclusterschwerpunktes (center of gravity) aus unserem Datensatz entfernen, damit das gestreute Elektron vollständig im Detektor enthalten ist.
Ein weiterer Schnitt ergibt sich aus der Tatsache, daß außer dem Kalorimeter noch eine Rückwärtige Proportional Kammer (BPC, backward proportional chamber) vorhanden ist. Hier fordern wir einen Treffer im Umkreis von um unseren Kandidaten.
Zusammengefaßt ergibt sich somit :
-
•
-
•
-
•
-
•
oder
-
•
Elektronkandidaten im LAr
Auch hier machen wir Schnitte in und im Elektronwinkel .
Da unter kleineren Winkeln auch vermehrt Hadronen zu finden sind, müssen wir hier die Energieverteilung in den beiden unterschiedlichen Detektorteilen getrennt betrachten. Im hadronischen Kalorimeter sollte nur wenig Energie vorhanden sein, da Elektronen im vorgelagerten elektromagnetischen Teil ihre Energie komplett abgeben. Im elektromagnetischen Teil selber sollte eine relativ kleine, im Gegensatz zu hadronischen Jets kompaktere Ladungsverteilung zu erkennen sein.
Zusätzlich wird noch ein Schnitt in der Größe für das gesamte Ereignis durchgeführt. Ein Wert in Höhe der zweifachen Strahlelektronenergie stellt sicher, daß der hadronische Endzustand vollständig erkannt wurde. Dies ist nicht der Fall, wenn der Elektronkandidat durch ein Hadron vorgetäuscht wurde und das wirkliche gestreute Elektron undetektiert bleibt. Näheres zur Rekonstruktion des hadronischen Endzustandes wird im nächsten Abschnitt erläutert.
Zusammengefaßt ergeben sich für LAr Kalorimeter Elektronen die Schnitte :
-
•
-
•
-
•
in einem Konus im elektromagnetischen Kalorimeter um den Elektronkandidaten.
-
•
in einem Konus im hadronischen Kalorimeter um den Elektronkandidaten.
-
•
5.2.4 Rekonstruktionsqualität des hadronischen Endzustandes
Wir müssen zunächst die Partikel bestimmen, die wir in unserem Jetalgorithmus zu Jets zusammenfassen wollen. Dies sind auf Partonniveau die vom Generator erzeugten Partonen und auf Detektorniveau die vom Rekonstruktionsprogramm H1REC[H1 95c] bestimmten hadronischen Cluster mit dem für die Algorithmen benötigten Pseudoteilchen (siehe hierzu Kapitel 4.1.2).
Die richtige Partikelidentifizierung können wir überprüfen, indem wir uns die Energie- und Impulsverteilungen ansehen.
Für die Energie erwarten wir die Summe der Energien der Strahlteilchen
| (5.2) |
Die Verteilungen für die Ereignisse, die mit den drei Monte-Carlo-Generatoren erzeugt wurden, sehen wir in Abbildung 5.5a,e und i.
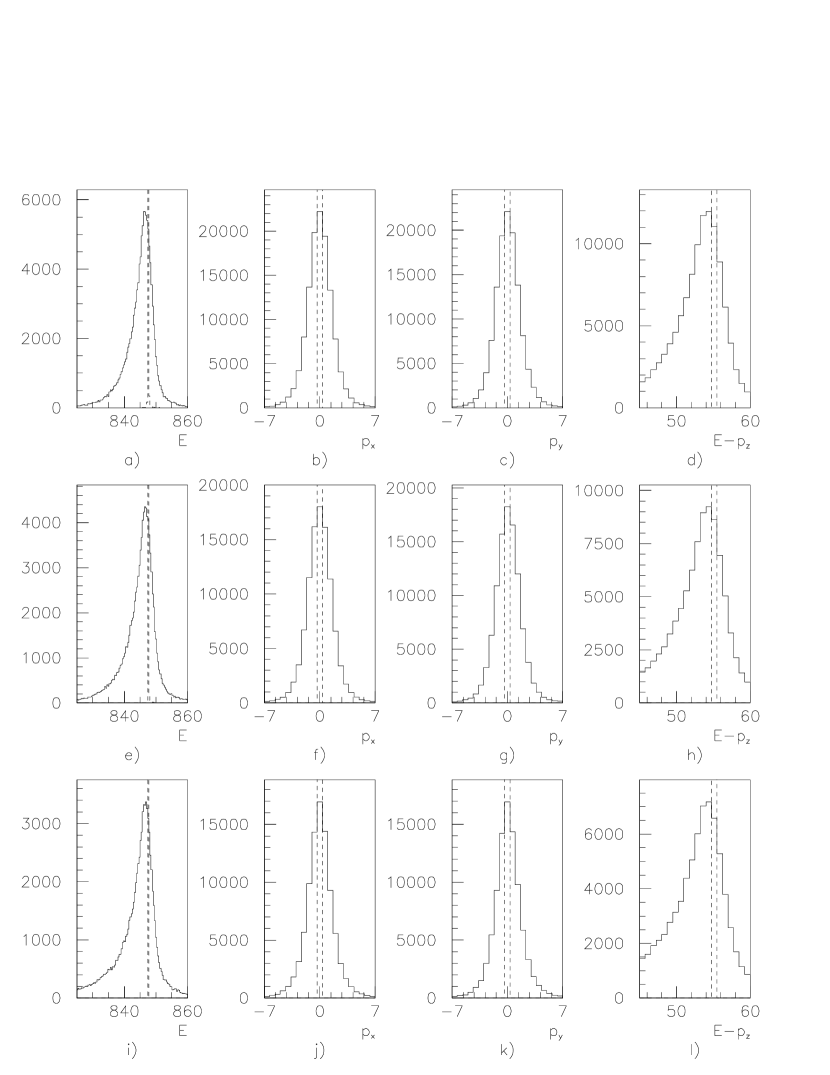
Wir erkennen, daß auf Partonniveau alle Ereignisse bei der erwarteten Energie auftreten. Bei den Clustern ist die Verteilung wesentlich breiter, der Peak ist jedoch auch hier — im Rahmen der Ungenauigkeit durch die Verluste — an der erwarteten Stelle. Die Form der Verteilung ist zum Teil durch die globale Kalibration der Kalorimeter zu erklären. Untersuchungen haben Unterschiede in der Empfindlichkeit der Detektoroktanten und der Detektorscheiben von einigen Prozent ergeben [KM95]. Der größte Teil wird aber durch Teilchen verursacht, die durch totes Material aufgehalten worden sind oder den Detektor unbeobachtet verlassen haben. Durch die Einführung des Pseudoteilchens ist die Aussagekraft der hadronischen Gesamtenergieverteilung jedoch eingeschränkt.
Die Qualität der Rekonstruktion des Protonrestes durch das Pseudoteilchen läßt sich an der Verteilung der zur Strahlachse transversalen Impulse erkennen. Da beide einlaufenden Strahlteilchen keine transversalen Impulse besitzen, erwarten wir auch für die Impulssumme über alle Endzustandspartikel eine Ausrichtung entlang der Strahlachse. Die Verteilungen im Partonniveau bestätigen dies (Abbildung 5.5b, c, f, g, j, k). Auf Detektorniveau ist ebenfalls ein Maximum bei Null zu sehen, jedoch ist auch hier die Verteilung breiter. Die Werte liegen im Rahmen der Meßungenauigkeit. Da das Pseudoteilchen keinen transversalen Impuls erhält, ist die Rekonstruktion des hadronischen Endzustandes somit gelungen und der Pseudoteilchenansatz gerechtfertigt.
Die Impulssumme in Richtung der Strahlachse stimmt auf Detektorniveau durch die Definition des Pseudoteilchens mit dem Erwartungswert überein. Dies ist hier deshalb nicht gezeigt.
In Abbildung 5.5d, h und l ist die Verteilung der Summe von gezeigt. Aus den obengenannten folgt, daß wir hier eine Kopie der Energieverteilung sehen, jetzt jedoch um den Erwartungswert
In Abbildung 5.6 sind die gleichen Verteilungen für die Daten gezeigt. Die Übereinstimmung zwischen den Daten und dem Monte-Carlo-Detektorniveau ist gut, die Datenverteilung der Energie ist jedoch etwas breiter.
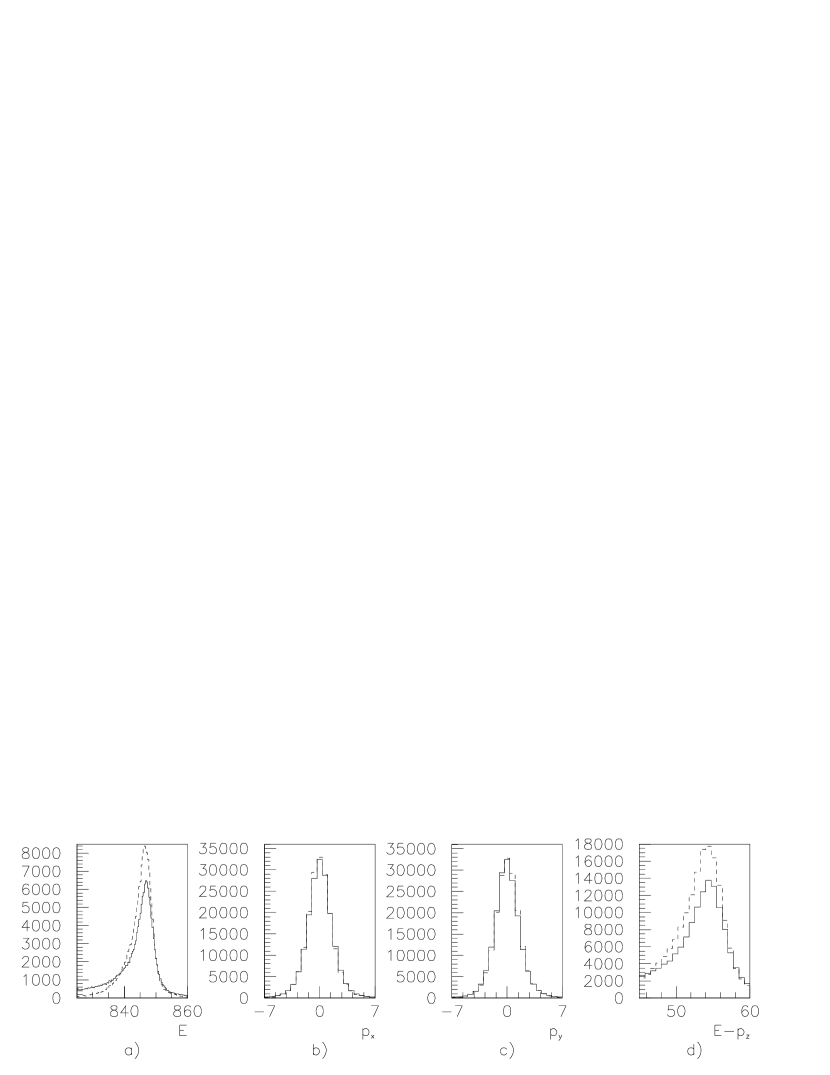
Aufgrund der Verteilung ist es sinnvoll Schnitte einzuführen, die Ereignisse mit zu großen Abweichungen verwerfen. Wir werden deshalb in dieser Arbeit folgenden Grenzen verwenden :
-
•
Die Energiesumme muß auf Partonniveau besser als auf Detektorniveau besser als mit dem Erwartungswert übereinstimmen.
-
•
Die transversalen Impulse und müssen jeweils kleiner als auf Parton- und auf Detektorniveau sein.
5.2.5 Einteilung
Für die Messung der starken Kopplungskonstanten in verschiedenen Bereichen, müssen wir eine Einteilung in sogenannte Bins vornehmen.
Bei der ersten Messung der starken Kopplungskonstante mit den Daten von 1993 wurde eine Fünfteilung in drei niedrige und zwei hohe Bins vorgenommen [Nis94b],[Nis94a],[Nis95a]. Mit der höheren Statistik aus dem Jahr 1994 ist eine Einteilung in acht Bins, fünf niedrige und drei hohe, möglich [Nis95b],[Eis95].
Die Einteilung wurde so gewählt, daß die Anzahl der 2+1 Ereignisse in den Bins bei den Daten ungefähr gleich groß ist, gleichzeitig der Bereich aber nicht zu weit wird. Diese Wahl ist sinnvoll, da der statistische Fehler der Jetrate fast ausschließlich durch den Fehler der 2+1 Jetanzahl bestimmt wird. Ich behalte diese Einteilung deshalb bei. Die genauen Angaben über die einzelnen Bins sind in Tabelle 5.2 aufgeführt.
| Bin | Bereich | mittlerer Wert | Anzahl Ereignisse | Anzahl 2+1 Ereignisse | ||
| nach Stdschnitten | nach Stdschnitten | |||||
| 1 | 10 — 14 | 11.9 | 14810 | 14951 | 744 | 854 |
| 2 | 14 — 18 | 15.9 | 10788 | 10893 | 582 | 651 |
| 3 | 18 — 25 | 21.4 | 10239 | 10329 | 650 | 674 |
| 4 | 25 — 40 | 32.1 | 9451 | 9578 | 746 | 701 |
| 5 | 40 — 100 | 66.6 | 6604 | 6547 | 628 | 604 |
| 6 | 100 — 300 | 186.6 | 7917 | 7749 | 1142 | 961 |
| 7 | 300 — 700 | 479.1 | 5047 | 4660 | 1049 | 896 |
| 8 | 700 — 4000 | 2011.7 | 2236 | 1848 | 521 | 396 |
Die Anzahl der Ereignisse mit 3 oder mehr harten Jets liegt auf beiden Niveaus summiert über alle Bins unter 3%444Weniger als 200 Ereignisse mit mehr als zwei harten Jets pro Niveau.. Der Einfluß dieser Ereignisse kann somit vernachlässigt werden.
5.3 Fehlerbestimmung
Der statistische Fehler der Jetanzahlen ist gegeben durch die Wurzel
| (5.3) |
Die Jetraten berechnen sich ähnlich Effizienzen durch
| (5.4) |
Wir müssen daher einen Effizienzenfehler benutzen, da die beiden Anzahlen korreliert sind :
| (5.5) |
oder in Jetanzahlen geschrieben
| (5.6) | |||||
Den Fehler für den Korrekturfaktor
| (5.7) |
hingegen berechnen wir durch lineare Fehlerfortpflanzung. Der Fehler für einen Quotienten zweier Größen ist dann
| (5.8) | |||||
| (5.9) |
Auch hier haben wir zwar eine Korrelation, da die gleichen Ereignisse verwendet wurden, um die Raten auf den unterschiedlichen Niveaus zu bestimmen. Durch Benutzung verschiedener Monte-Carlos mit gleichen Einstellungen für Parton- und Detektorniveau wäre es mögliche diese Korrelation vollständig auszuschalten. Wir können sie jedoch bei den hohen Ereigniszahlen vernachlässigen.
5.4 Motivation zur Untersuchung der Jet–Parton–Korrelation
Betrachten wir die Korrelation der Jet Ereignisanzahlen zwischen Parton- und Detektorniveau, so ergeben sich Matrizen der Art
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | ||
| ter | 2+1 | ||
Die Hauptdiagonalelemente und beschreiben die auf beiden Niveaus gleich klassifizierten Ereignisse und die Nebendiagonalelemente und die Migrationen, d.i. der Fall, in dem durch Fehl-Erkennung ein Ereignis beim Übergang von Parton- auf Detektorniveau die Jetklasse wechselt. Diese Elemente sollten möglichst niedrige Werte annehmen.
Benutzen wir nur die Standardschnitte, so ergeben sich die in Tabelle 5.3 verzeichneten Migrationen für die MEPS Datensätze in den verschiedenen Bins. Es wurde hier der JADE Algorithmus verwendet555Da der JADE Algorithmus mit dem Auflösungsparameter unsere Standardwahl ist, wird im folgenden der Algorithmus nur bei Verwendung eines anderen Algorithmuses explizit angegeben..
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 12458 | 326 |
| ter | 2+1 | 434 | 343 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 9419 | 247 |
| ter | 2+1 | 336 | 267 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 8970 | 291 |
| ter | 2+1 | 336 | 287 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 8108 | 345 |
| ter | 2+1 | 305 | 345 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 5464 | 256 |
| ter | 2+1 | 259 | 299 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 5934 | 448 |
| ter | 2+1 | 274 | 586 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 3324 | 341 |
| ter | 2+1 | 234 | 605 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1287 | 154 |
| ter | 2+1 | 99 | 286 |
| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Parton | 4.9 | 5.0 | 5.8 | 7.6 | 8.8 | 14.3 | 21.0 | 24.1 |
| in % | ||||||||
| Rate Detektor | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 11.9 | 18.6 | 21.1 |
| in % | ||||||||
| Korrektur- | 0.86 | 0.85 | 0.93 | 1.06 | 0.99 | 1.20 | 1.13 | 1.14 |
| faktor | ||||||||
| Reinheit in % | 44.1 | 44.3 | 46.1 | 53.1 | 53.6 | 68.1 | 72.1 | 74.3 |
Aus den Migrationen, beschrieben durch die Elemente lassen sich die Raten einfach berechnen
| (5.10) | |||||
| (5.11) |
Neben den Raten ist in der Tabelle 5.3 auch der Korrekturfaktor
| (5.12) |
berechnet worden. Hier ist jedoch anzumerken, daß bei den Migrationstabellen nur solche Ereignisse verwendet werden konnten, die auf beiden Niveaus die Standardschnitte erfüllen. Im sechsten Bin haben wir z.B. insgesamt 7242 Ereignisse, obwohl in diesem Bin 7749 Ereignisse die Standardschnitte auf Detektorniveau erfüllen und sogar 7917 die auf Partonniveau (siehe Tabelle 5.2).
Für unsere späteren Betrachtungen benutzen wir die Raten, die sich aus den kompletten Sätzen ergeben. Diese können sich somit leicht von den hier angegebenen unterscheiden.
Bei den Raten fällt uns auf, daß diese mit anwachsendem ebenfalls steigen. Wir erwarten für die starke Kopplungskonstante jedoch genau einen umgekehrten Verlauf. Die Abhängigkeit der Vorfaktoren in Gleichung 4.8 ist jedoch stärker, so daß der Abfall der starken Kopplungskonstanten mit überkompensiert wird.
Die Korrekturfaktoren liegen bei eins und zeigen keine großen Probleme bei der Jet–Parton–Korrelation an.
Sehen wir uns die Migrationen genauer an, so fällt jedoch auf, daß die 2+1 Jetklassen auf den beiden Niveaus nicht gut übereinstimmen. In den unteren Bins liegt die Reinheit der 2+1 Jetereignisse auf Detektorniveau
| (5.13) | |||||
bei nur 45 bis 50%. In den hohen Bins ist sie mit 65 bis 75% zwar besser, aber sicherlich nicht zufriedenstellend.
Zur Bekämpfung von Partonschauern wurde schon bei der Analyse der im Jahr 1993 genommenen Daten ein Jetwinkelschnitt eingeführt
| (5.14) |
Eine genauere Untersuchung dieses Schnittes wird in Kapitel 5.8.1 durchgeführt. In Tabelle 5.4 sind die Migrationen für diesen Schnitt notiert.
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6830 | 219 |
| ter | 2+1 | 136 | 147 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6500 | 135 |
| ter | 2+1 | 71 | 97 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6712 | 182 |
| ter | 2+1 | 95 | 109 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6707 | 183 |
| ter | 2+1 | 91 | 122 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 5333 | 138 |
| ter | 2+1 | 67 | 114 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 5197 | 323 |
| ter | 2+1 | 141 | 274 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 3804 | 246 |
| ter | 2+1 | 109 | 249 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1506 | 105 |
| ter | 2+1 | 48 | 141 |
| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Parton | 5.0 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 10.1 | 11.2 | 13.7 |
| in % | ||||||||
| Rate Detektor | 3.9 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 7.0 | 8.1 | 10.5 |
| in % | ||||||||
| Korrektur- | 1.29 | 1.38 | 1.43 | 1.43 | 1.39 | 1.44 | 1.38 | 1.30 |
| faktor | ||||||||
| Reinheit in % | 51.9 | 57.7 | 53.4 | 57.3 | 63.0 | 66.0 | 69.6 | 74.6 |
Wir erkennen hier die gleiche Systematik. Für die Abhängigkeit gilt auch hier das obengesagte. Der Korrekturfaktor liegt nun jedoch mit durchschnittlich 1.4 weiter von 1 entfernt als ohne Schnitt. Um dies zu erklären, vergleichen wir die Migrationen näher.
Betrachten wir zuerst die niedrigen Bins. Durch den zusätzlichen Schnitt hat sich die Anzahl der Ereignisse, die in beiden Niveaus zwei harte Jets haben (2+1 Jet,) auf ca. 40% reduziert. Die Ereignisse die auf Partonniveau einen harten Jet haben, auf Detektorniveau jedoch zwei, sind zu über 70% unterdrückt worden. Im Gegensatz dazu werden nur etwa 42% der Ereignisse, die auf Detektorniveau einen harten Jet, auf Partonniveau jedoch zwei haben, verworfen. Die Konsequenzen abgesehen vom vergrößerten Korrekturfaktor sind kleinere Raten auf beiden Niveaus und bei kleinen eine leicht verbesserte Reinheit unserer Detektorprobe.
Dieser Schnitt deutet auf Unterschiede in der Parton- und der Detektor-Jetwinkelverteilung hin. Hierauf werden wir in Kapitel 5.8.1 zurückkommen.
Bei den hohen Bins ist die Unterdrückung um 55% für 51% für und 29% für nicht ganz so extrem, aber trotzdem sehr unterschiedlich. Insbesondere ist der Effekt auf die auf beiden Niveaus gleich erkannten Ereignisse groß, was die höheren relativen Fehler bewirkt.
Um die Stärke der Migrationen zu charakterisieren genügt also nicht nur der Korrekturfaktor, sondern die Reinheit unserer Jetklassifizierung ist ebenfalls wichtig.
Unser Problem bei der Jetanalyse ist deutlich geworden. Wir suchen einen oder mehrere Schnitte, die die Migrationen, d.h. die Elemente und der Migrationsmatrix unterdrücken. Außerdem sollte die Reduktion möglichst auf beide Elemente gleich stark ausfallen, da sonst der Korrekturfaktor zu groß666Unter einem großen Korrekturfaktor verstehen wir einen Wert, der eine große Abweichung vom idealen Wert 1 bedeutet. Es ist dabei nebensächlich, ob die Abweichung nach unten, d.i. ein kleiner Korrekturfaktorwert, oder nach oben, d.i. ein großer Korrekturfaktorwert, ausfällt. wird. Wünschenswert wäre zusätzlich, daß die auf beiden Niveaus gleicherkannten Ereignisse, insbesondere die, die beide Male als 2+1 Jetereignisse klassifiziert wurden, nicht zu sehr reduziert werden. Dies würde sonst den statistischen Fehler stark erhöhen.
5.5 Verschiedene Monte-Carlo-Generatoren
Bevor wir nun weitere Schnitte testen, ist es sinnvoll die Abhängigkeit vom Monte-Carlo-Generator und dem Jetalgorithmus zu betrachten. Ersteres untersuchen wir in diesem Abschnitt, letzteres im nächsten.
Wir haben neben unserem Lepto-MEPS-Monte-Carlo noch Simulationen von Ereignissen, die mit Ariadne bzw. mit Herwig erzeugt wurden. Die genauen Angaben zu diesen Datensätzen sind in Tabelle 5.1 aufgeführt.
Die Migrationen sind in Tabelle 5.5 für Ariadne und in Tabelle 5.6 für Herwig mit der gleichen Einteilung (siehe Tabelle 5.2) unter Verwendung der Standardschnitte aufgeführt.
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 5728 | 454 |
| ter | 2+1 | 305 | 296 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 4497 | 400 |
| ter | 2+1 | 243 | 262 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 4363 | 391 |
| ter | 2+1 | 227 | 277 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 3997 | 417 |
| ter | 2+1 | 203 | 282 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 2552 | 301 |
| ter | 2+1 | 154 | 229 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 2875 | 258 |
| ter | 2+1 | 137 | 263 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1663 | 169 |
| ter | 2+1 | 138 | 214 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 673 | 77 |
| ter | 2+1 | 75 | 86 |
| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Parton | 11.1 | 12.3 | 12.7 | 14.3 | 16.4 | 14.7 | 17.5 | 17.9 |
| in % | ||||||||
| Rate Detektor | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 11.8 | 11.3 | 16.1 | 17.7 |
| in % | ||||||||
| Korrektur- | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.44 | 1.38 | 1.30 | 1.09 | 1.01 |
| faktor | ||||||||
| Reinheit in % | 49.3 | 51.9 | 55.0 | 58.1 | 59.8 | 65.8 | 60.8 | 53.4 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 4589 | 56 |
| ter | 2+1 | 129 | 43 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 3426 | 94 |
| ter | 2+1 | 116 | 74 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 3167 | 108 |
| ter | 2+1 | 122 | 78 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 2950 | 90 |
| ter | 2+1 | 135 | 109 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1879 | 91 |
| ter | 2+1 | 94 | 93 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6223 | 304 |
| ter | 2+1 | 217 | 491 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 3570 | 266 |
| ter | 2+1 | 189 | 522 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1237 | 116 |
| ter | 2+1 | 86 | 288 |
| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Parton | 2.1 | 4.5 | 5.4 | 6.1 | 8.5 | 11.0 | 17.3 | 23.4 |
| in % | ||||||||
| Rate Detektor | 3.6 | 5.1 | 5.8 | 7.4 | 8.7 | 9.8 | 15.6 | 21.7 |
| in % | ||||||||
| Korrektur- | 0.58 | 0.88 | 0.93 | 0.82 | 0.98 | 1.12 | 1.11 | 1.08 |
| faktor | ||||||||
| Reinheit in % | 25.0 | 38.9 | 39.0 | 44.7 | 49.7 | 69.4 | 73.4 | 77.0 |
Vergleichen wir die drei Tabellen, stellen wir fest, daß die Abhängigkeit der Raten bei den drei Monte-Carlos unterschiedlich ist. Bei dem mit Herwig generierten Datensatz ist sie am größten und beim Ariadne Datensatz am geringsten.
Damit sind natürlich auch die Raten unterschiedlich. Die Abweichungen sind bei den niedrigen Bins jedoch etwas größer.
Bei den Korrekturfaktoren wird die Abhängigkeit und die Abhängigkeit vom benutzten Monte-Carlo besonders deutlich. Im ersten Bin reichen die Werte von 0.58 bis 1.25, im zweiten immerhin noch von 0.85 bis 1.31. In den letzten beiden Bins liegen die Werte zwischen 1.01 und 1.14 und stimmen im Rahmen der Fehler überein. Dies ist bereits ein deutlicher Hinweis darauf, daß die Probleme bei den Jet–Parton–Korrelationen in den niedrigen Bins wesentlich größer sind.
Zusammenfassend können wir also sagen, daß unsere Berechnungen abhängig vom benutzen Monte-Carlo-Generator sind. Wir werden deshalb in Kapitel 5.8 verschiedene Verteilungen untersuchen, um Probleme bei unseren simulierten Ereignissen im Vergleich mit den Daten zu finden und die entsprechenden Phasenraumbereiche dann ausschließen zu können.
5.6 Verschiedene Jetalgorithmen
Wie bereits im letzten Kapitel angesprochen, müssen wir auch die Abhängigkeit der Werte vom verwendeten Jetalgorithmus näher betrachten. Dazu wurden auf den beiden Niveaus der Lepto Simulationen der JADE und der Cone Algorithmus angewandt. Aus Kapitel 4.1.2 wissen wir, daß bei der Berechnung der invarianten Masse im JADE Schema die Teilchenmassen vernachlässigt werden. Dies bedeutet jedoch, daß der Jetalgorithmus insgesamt nicht lorentz-invariant ist. Um diesen Effekt näher zu betrachten, wurde der JADE Algorithmus mit JADE Schema in drei unterschiedlichen Bezugssystemen angewendet. Dazu wurde neben dem Laborsystem, das unsere Standardeinstellung ist, das hadronische Schwerpunktsystem und das Breitsystem (siehe Kapitel 4.1.3) verwendet. Aufgrund des hohen Energieunterschiedes von Strahlproton und -elektron können jedoch Lorentz Transformationen mit extremen Werten in den Rotationsmatrizen auftreten 777In diesen Fällen ist . Die Lorentz-Transformationen sind deshalb nicht unproblematisch und spezielle Tests mußten eingebaut werden, um nichtphysikalische Werte zu verhindern. Die einzelnen Partikel sind vor der Berechnung der Jets in das entsprechende System transformiert worden und nach der Anwendung des JADE Algorithmus wurden die Jets ins Laborsystem zurücktransformiert, um einen Vergleich der drei Versionen zu ermöglichen.
Als weitere Variante wurde der JADE Algorithmus mit einem veränderten Schnittwert von benutzt, um die Größenordnung der Abhängigkeit vom Auflösungsparameter zu bestimmen (siehe Kapitel 4.2).
Zum Schluß wurde auch der JADE-Algorithmus unter Verwendung der Massenberechnung und Rekombination durch das E Schema eingesetzt, das den Algorithmus lorentz-invariant macht. Frühere Untersuchungen der JADE Varianten haben jedoch schon gezeigt, daß gerade dieser Algorithmus große Korrekturfaktoren bewirkt ([Nis94b] Kapitel 10, Abbildung 10.19 und 10.20).
Eine Aufstellung der verwendeten Algorithmen ist in Tabelle 5.7 wiedergegeben.
| Abkürzung | Algorithmus | Lorentzsystem | Schnittparameter |
|---|---|---|---|
| JL | JADE | Labor | 0.02 |
| JC | JADE | hadr.Schwerpunkt | 0.02 |
| JB | JADE | Breit | 0.02 |
| 3L | JADE | Labor | 0.03 |
| CL | Cone888Mit den Parametern und | Labor | 0.7 |
| EL | E Schema | Labor | 0.02 |
In den Abbildungen 5.7 bis 5.11 sind die entsprechenden Werte graphisch für verschiedene Bins dargestellt. Die Ereignisse aus den ersten vier Bins wurden dabei zu einer Abbildung zusammengefaßt. Zum einfacheren Vergleich sind die Graphen in einer festen Skalierung gezeigt. Die Werte für alle acht Bins sind in den Tabellen 5.8 bis 5.10 zusammengefaßt.
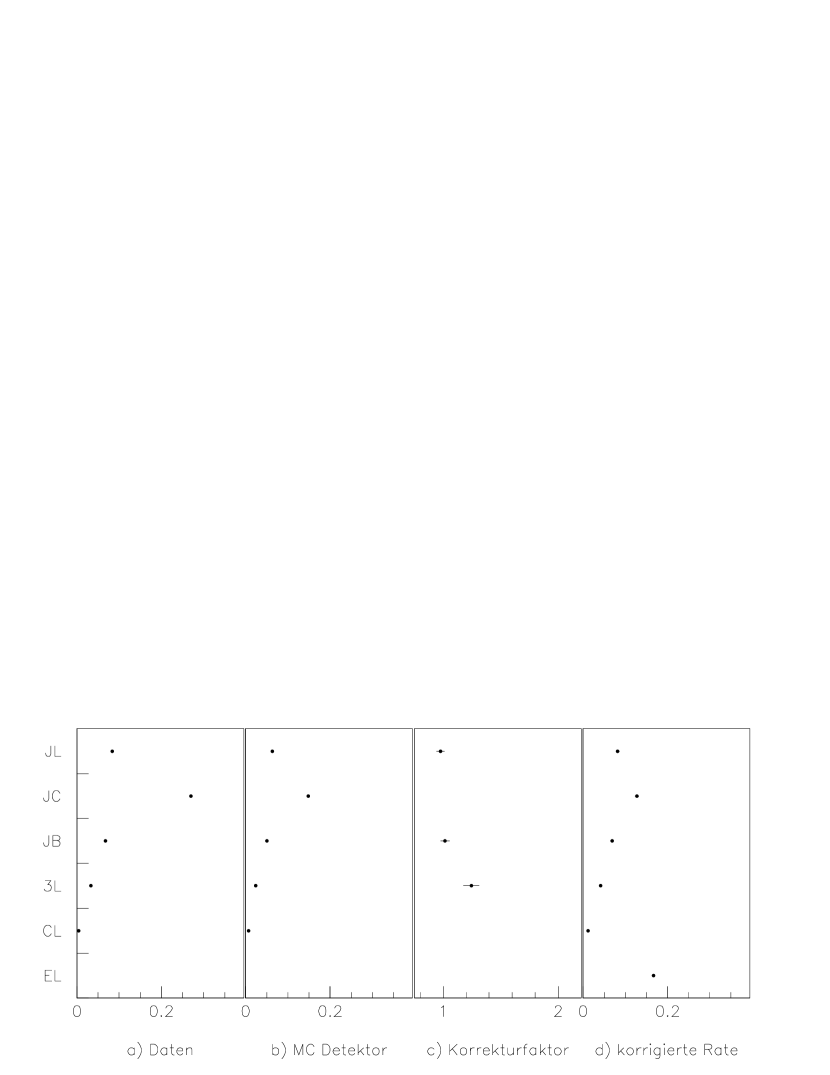
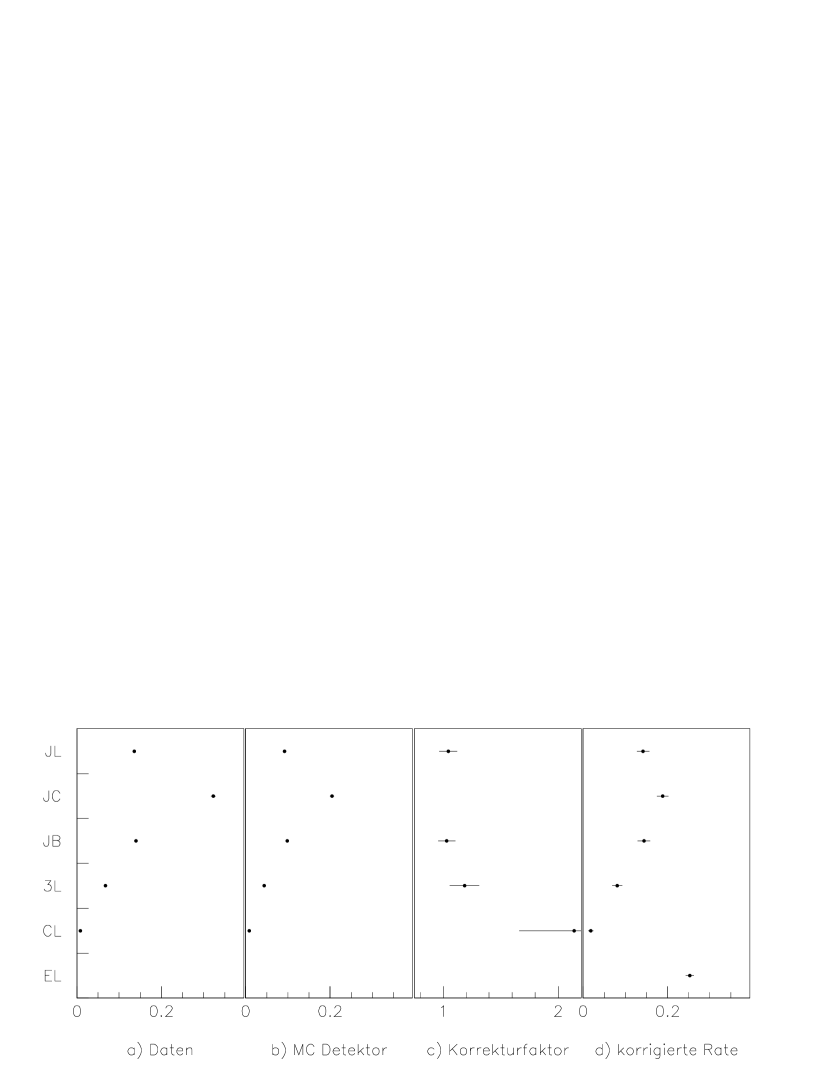
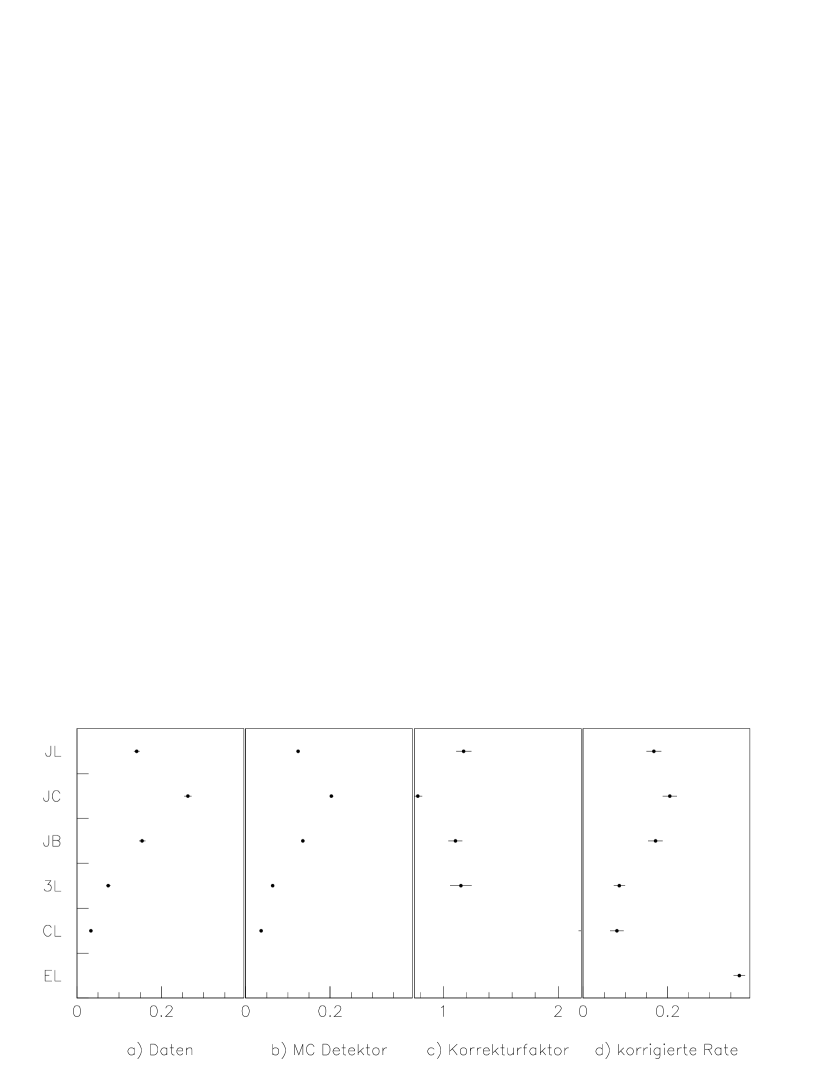
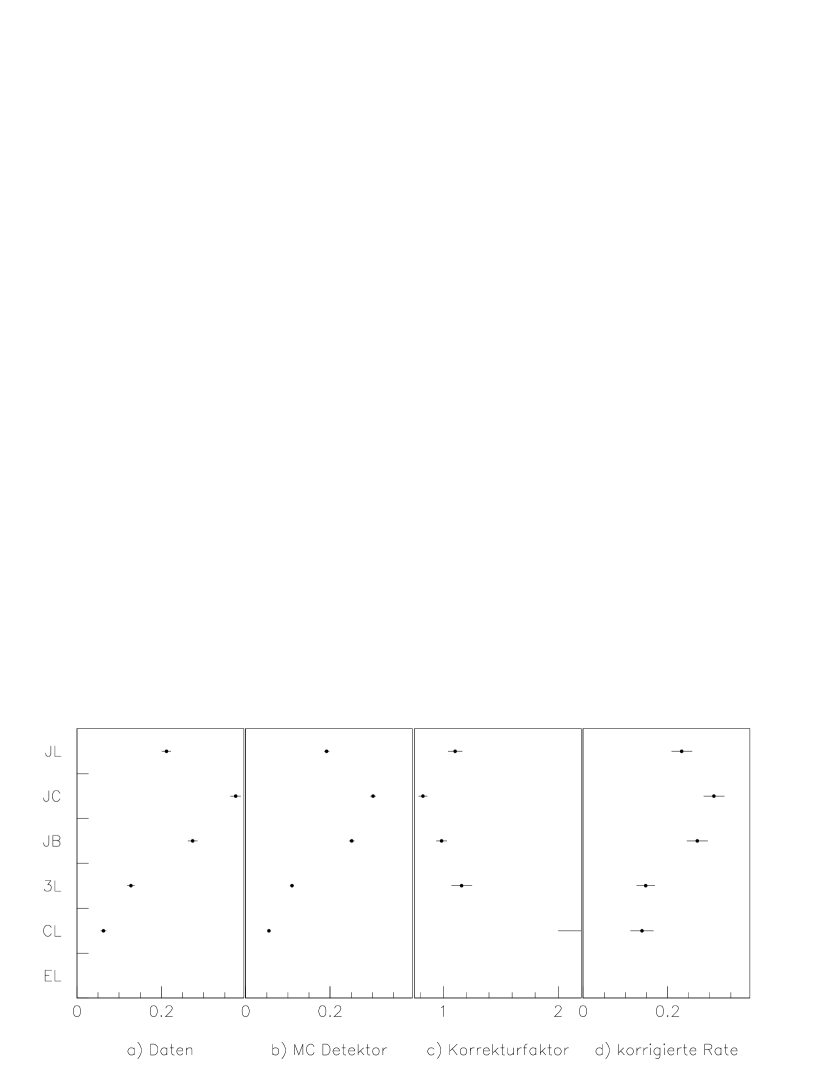
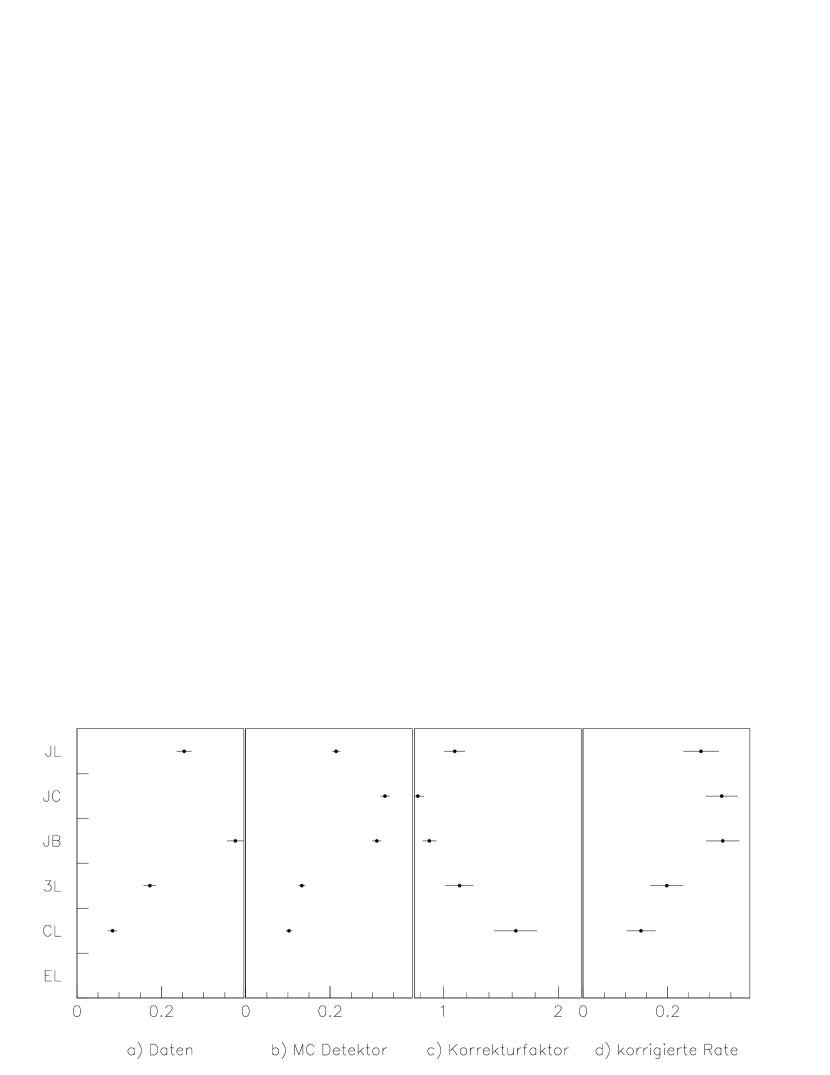
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Datenrate in % | ||||||||
| JL | 6.9 | 8.2 | 8.8 | 10.2 | 13.6 | 14.2 | 21.2 | 25.4 |
| JC | 25.4 | 26.9 | 27.8 | 28.4 | 32.3 | 26.3 | 37.6 | 42.1 |
| JB | 4.7 | 6.5 | 7.1 | 9.6 | 14.0 | 15.5 | 27.4 | 37.5 |
| 3L | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 6.8 | 7.4 | 12.8 | 17.3 |
| CL | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.3 | 6.3 | 8.4 |
| EL | 67.6 | 69.8 | 69.8 | 71.3 | 73.1 | 70.3 | 71.3 | 68.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Monte-Carlo-Detektorrate in % | ||||||||
| JL | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | 9.2 | 12.4 | 19.2 | 21.5 |
| JC | 13.2 | 14.5 | 15.5 | 17.0 | 20.4 | 20.3 | 30.2 | 33.0 |
| JB | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 7.0 | 9.8 | 13.6 | 25.1 | 31.0 |
| 3L | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 6.4 | 10.9 | 13.3 |
| CL | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.6 | 5.5 | 10.2 |
| EL | 60.8 | 64.3 | 63.8 | 64.8 | 66.5 | 63.5 | 68.8 | 65.7 |
| Monte-Carlo-Partonrate in % | ||||||||
| JL | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.6 | 14.6 | 21.2 | 23.6 |
| JC | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 9.2 | 11.9 | 15.9 | 24.8 | 25.7 |
| JB | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 7.1 | 10.1 | 15.0 | 24.8 | 27.3 |
| 3L | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 7.4 | 12.7 | 15.2 |
| CL | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 8.7 | 12.2 | 16.7 |
| EL | 13.1 | 13.8 | 15.7 | 19.3 | 23.0 | 33.4 | 43.7 | 45.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Korrekturfaktor | ||||||||
| JL | 0.91 | 0.90 | 1.01 | 1.11 | 1.04 | 1.18 | 1.10 | 1.10 |
| JC | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.78 | 0.82 | 0.78 |
| JB | 0.99 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.11 | 0.99 | 0.88 |
| 3L | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.14 |
| CL | 2.72 | 3.17 | 2.59 | 2.30 | 2.14 | 2.40 | 2.21 | 1.63 |
| EL | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.53 | 0.64 | 0.69 |
| korrigierte Rate in % | ||||||||
| JL | 6.2 | 7.4 | 8.9 | 11.3 | 14.2 | 16.7 | 23.4 | 28.0 |
| JC | 11.0 | 12.1 | 13.2 | 15.3 | 18.9 | 20.5 | 31.0 | 32.8 |
| JB | 4.7 | 6.5 | 7.5 | 9.7 | 14.4 | 17.1 | 27.0 | 33.1 |
| 3L | 3.0 | 4.0 | 4.3 | 5.8 | 8.1 | 8.6 | 14.8 | 19.8 |
| CL | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 8.0 | 13.9 | 13.7 |
| EL | 14.6 | 15.0 | 17.1 | 21.2 | 25.3 | 37.0 | 45.3 | 47.2 |
Die Abbildungen ermöglichen sowohl den Vergleich zwischen Daten und Monte-Carlo-Detektorniveau als auch die Bewertung der Korrekturfaktoren und den Vergleich der korrigierten Raten
Zum letzten Punkt ist anzumerken, daß wir nur für den JADE Algorithmus mit Schnittwert in den verschiedenen Systemen die gleiche korrigierte Rate erwarten. Bei Verwendung eines anderen Schnittparameters oder anderen Algorithmus verändern sich die von der Theorie vorhergesagten Koeffizienten zur Berechnung der starken Kopplungskonstante (siehe Kapitel 4.2). Da das von uns verwendete Programm zur Berechnung der theoretischen Werte PROJET nur den JADE Algorithmus verwendet, ist auf einen Vergleich der Partonraten mit den theoretischen Werten hier verzichtet worden.
Vergleichen wir zuerst die unterschiedlichen Systeme. Uns fällt auf, daß sich bei der Datenrate große Unterschiede ergeben. Obwohl bei allen Versionen die Datenrate mit steigt, ist die Stärke der Abhängigkeit unterschiedlich. Vergleichen wir dies mit der Rate auf Monte-Carlo-Detektorniveau, so ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Raten selber sind jedoch um etwa 2% kleiner als bei den Daten. Auf Partonniveau sieht das Bild schon wesentlich besser aus. Die Werte sind nun wesentlich enger zusammen und die Abhängigkeit ist ebenfalls sehr ähnlich. Aus den letzten beiden Punkten ergeben sich zwangsläufig sehr unterschiedliche Korrekturfaktoren. Während die Korrekturfaktoren für das Labor- und das Breitsystem zwischen 0.88 und 1.18 im Rahmen bleiben, sind sie für den JADE Algorithmus im hadronischen Schwerpunktsystem mit Werten zwischen 0.43 und 0.82 unakzeptabel.
Betrachten wir nun den JADE Algorithmus mit dem größeren Schnittwert, so ist die Rate auf allen drei gemessenen Niveaus im Einklang mit unserer Erwartung kleiner als bei der Standardeinstellung. Die Reduktion beträgt in allen Fällen ungefähr 50%, wobei das Verhältnis in den niedrigeren Bins auf Detektorlevel eher kleiner, auf Partonlevel etwas höher liegt. Für den Korrekturfaktor ergibt sich ein recht gleichmäßiger Verlauf mit Werten zwischen 1.14 und 1.30. Für die korrigierte Rate gilt somit ebenfalls eine Reduktion um die Hälfte gegenüber den Standardeinstellungen.
Der Cone Algorithmus hat sehr niedrige Raten. Die Beschreibung der Daten durch das Monte-Carlo-Detektorniveau ist recht gut, aber es zeigen sich große Abweichungen zwischen den beiden Monte-Carlo-Niveaus. Dies bedingt auch die unakzeptablen Korrekturfaktoren mit Werten zwischen 1.63 und 3.17. Die sich daraus ergebende korrigierte Rate zeigt ein merkwürdiges Verhalten. Während die Rate in den unteren fünf Bins nahezu konstant ist, tritt ein Anstieg zwischen Bin fünf und acht um einen Faktor sieben bis acht auf.
Beim E Schema ergeben sich sehr große Raten auf Daten und Detektorniveau. Die Übereinstimmung hier ist gut. Die Raten auf Partonniveau sind um ein Vielfaches kleiner und die Abhängigkeit ist hier wesentlich stärker. Somit ergeben sich unakzeptable, abhängige Korrekturfaktoren zwischen 0.22 und 0.69.
Zusammenfassend ergeben sich starke Unterschiede bei Verwendung anderer Algorithmen oder anderer Einstellparameter. Der Cone Algorithmus und das E Schema zeigen merkwürdige Abhängigkeiten insbesondere beim Korrekturfaktor. Eine endgültige Bewertung dieser Algorithmen kann aber erst nach einem Vergleich mit den Theorieraten erfolgen. Dies ist zur Zeit noch nicht möglich. Für die vier JADE Versionen zeigen sich zu große Abweichungen insbesondere bei Verwendung des Algorithmus im hadronischen Schwerpunktsystem. Die korrigierte Rate liefert jedoch akzeptable Werte.
5.7 Untersuchungen auf dem Hadronniveau
Der Korrekturfaktor beschreibt die Ratenänderung, die durch mehrere Effekte eintreten kann. Neben der Hadronisierung und Fragmentation können auch Detektoreffekte eine Rolle spielen. Um den Anteil dieser beiden Schritte an den Migrationen zu untersuchen, spalten wir unsere Betrachtung auf. Zur Untersuchung der durch die Hadronisierung verursachten Migrationen sind in Tabelle 5.11 die Migrationen vom Parton- zum Hadronniveau verzeichnet. Die Migrationen durch Detektoreffekte oder Fehl-Erkennung des gestreuten Elektrons sind in Tabelle 5.12 beim Übergang von Hadron- auf Detektorniveau notiert. Bei diesem Schritt ist auch zu berücksichtigen, daß die Akzeptanz auf Parton- und Hadronniveau im gesamten Raum eins ist, während wir auf Detektorniveau Akzeptanzlücken haben. Daher benutzen wir nur auf Detektorniveau ein Pseudoteilchen als Näherung für den Protonrest.
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Ha- | 1+1 | 14825 | 327 |
| dron | 2+1 | 433 | 508 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Ha- | 1+1 | 10839 | 251 |
| dron | 2+1 | 325 | 385 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Ha- | 1+1 | 10095 | 291 |
| dron | 2+1 | 351 | 442 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1+1 | 2+1 | |
| Ha- | 1+1 | 9151 | 306 |
| dron | 2+1 | 301 | 528 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1+1 | 2+1 | |
| Ha- | 1+1 | 6262 | 251 |
| dron | 2+1 | 230 | 440 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 1+1 | 2+1 | |
| Ha- | 1+1 | 7067 | 423 |
| dron | 2+1 | 363 | 849 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 1+1 | 2+1 | |
| Ha- | 1+1 | 3990 | 349 |
| dron | 2+1 | 301 | 805 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 1+1 | 2+1 | |
| Ha- | 1+1 | 1675 | 128 |
| dron | 2+1 | 128 | 429 |
| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Parton | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.6 | 14.6 | 21.2 | 23.6 |
| in % | ||||||||
| Rate Hadron | 5.8 | 6.0 | 7.1 | 8.1 | 9.3 | 13.9 | 20.3 | 23.6 |
| in % | ||||||||
| Korrektur- | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.00 |
| faktor | ||||||||
| Reinheit in % | 54.0 | 54.2 | 55.7 | 63.7 | 65.7 | 70.0 | 72.8 | 77.0 |
| Bin | Hadron | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 12395 | 389 |
| ter | 2+1 | 419 | 358 |
| Bin | Hadron | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 9358 | 308 |
| ter | 2+1 | 324 | 279 |
| Bin | Hadron | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 8934 | 327 |
| ter | 2+1 | 298 | 325 |
| Bin | Hadron | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 8128 | 325 |
| ter | 2+1 | 282 | 368 |
| Bin | Hadron | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 5483 | 237 |
| ter | 2+1 | 242 | 316 |
| Bin | Hadron | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 5968 | 414 |
| ter | 2+1 | 270 | 590 |
| Bin | Hadron | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 3368 | 297 |
| ter | 2+1 | 223 | 616 |
| Bin | Hadron | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1304 | 137 |
| ter | 2+1 | 90 | 295 |
| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Hadron | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 8.8 | 13.9 | 20.3 | 23.7 |
| in % | ||||||||
| Rate Detektor | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 11.9 | 18.6 | 21.1 |
| in % | ||||||||
| Korrektur- | 0.96 | 0.97 | 1.05 | 1.07 | 0.99 | 1.17 | 1.09 | 1.12 |
| faktor | ||||||||
| Reinheit in % | 46.1 | 46.3 | 52.2 | 56.6 | 56.6 | 68.6 | 73.4 | 76.6 |
Vergleichen wir diese beiden Tabellen mit den Gesamtmigrationen in Tabelle 5.3, so stellen wir fest, daß in beiden Teilschritten die Reinheit in den hohen Bins in etwa gleich ist. Gegenüber den Parton–Cluster–Migrationen hat sich die Reinheit nur leicht verbessert. In den niedrigen Bins ist die Reinheit beim Übergang zwischen Parton- und Hadronniveau besser, ansonsten gilt das gleiche wie für die hohen Bins. Der Korrekturfaktor läßt ebenfalls nur den Schluß zu, daß die Probleme in beiden Bereichen gleich stark sind.
Zum Vergleich der Raten ziehen wir die Partonrate von Tabelle 5.3 und die Hadron- und Detektorrate von Tabelle 5.12 heran, da zur Berechnung der Tabelle 5.11 auch die Ereignisse verwendet wurden, die auf Detektorniveau die Standardschnitte nicht erfüllen. Die Hadronrate liegt in fünf Bins zwischen den beiden anderen Raten, in zwei Bins entsprechen sie den Partonraten und in nur einem Bin ist die Rate höher als die auf Parton- und Detektorniveau. Die Ursache der Migrationen scheint somit ein Effekt zu sein, der sowohl beim Übergang vom Parton- zum Hadronniveau alsauch bei Berücksichtigung der Detektoreffekte auftritt. Um dies zu beweisen, sind jedoch weitere Studien und ein besseres Verständnis der Hadronisierung und der Detektoreffekte nötig.
Um den Einfluß der Hadronanzahl zu untersuchen, habe ich die Ereignisse in Bins entsprechend ihrer Hadronanzahl geteilt. Die sich daraus ergebenden Migrationen sind in Tabelle 5.13 verzeichnet. Wir erkennen, daß die Reinheit mit der Hadronanzahl stark ansteigt. Unsere Probleme scheinen also nicht durch die von Niveau zu Niveau steigende Partikelanzahl ausgelöst zu werden. Der Korrekturfaktor ist im Rahmen der Fehler in allen Bereichen gleich. Der Grund für das Ansteigen der Raten mit der Multiplizität ist unbekannt und deutet die Wichtigkeit von weiteren Untersuchungen der Hadronisierungseffekte an. Diese würden jedoch den Rahmen der Diplomarbeit sprengen.
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Ha- | 1+1 | 1890 | 37 |
| dron | 2+1 | 39 | 19 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Ha- | 1+1 | 8191 | 443 |
| dron | 2+1 | 409 | 942 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Ha- | 1+1 | 2164 | 382 |
| dron | 2+1 | 318 | 1037 |
| Hadronanzahl im Ereignis | kleiner | 25 bis 50 | größer |
|---|---|---|---|
| Rate Parton | 2.8 | 13.9 | 36.4 |
| in % | |||
| Rate Hadron | 2.9 | 13.5 | 34.7 |
| in % | |||
| Korrektur- | 0.97 | 1.03 | 1.05 |
| faktor | |||
| Reinheit in % | 32.8 | 69.7 | 76.5 |
5.8 Einführung zusätzlicher Schnitte
5.8.1 Jetwinkel
Aufgrund der Hinweise von Kapitel 5.4 schauen wir uns nun die Winkelverteilung der harten Jets an. In Abbildung 5.12a sind die Verteilungen für das Parton- und das Detektorniveau für alle Ereignisse und in Bild b die inklusiven Verteilungen für die 2+1 Ereignisse alleine gezeigt. Beide Verteilungen sind auf gleiche Flächen normiert.
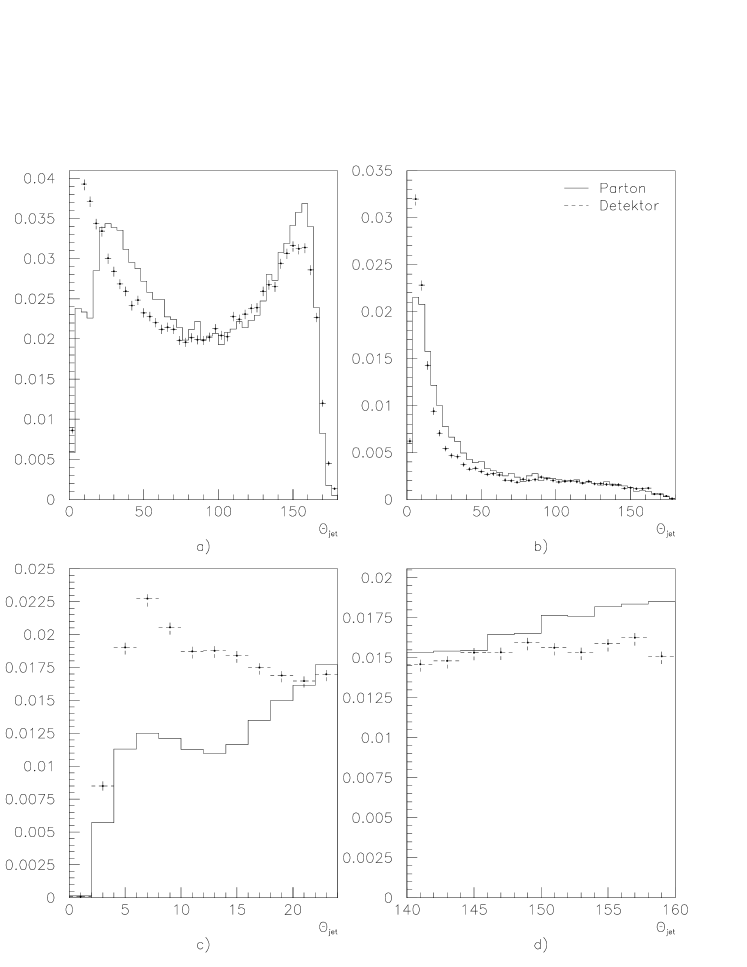
Wir erkennen schon hier, daß im Vorwärts- und im Rückwärtsbereich die Beschreibungen nicht gut übereinstimmen. Deshalb sind die beiden Bereiche für alle Ereignisse in c und d nochmal vergrößert dargestellt. Dazu wurde die gleiche Normierung wie in Bild a benutzt.
Die Beschreibung der Bereiche kleiner 70 Grad und größer 150 Grad zeigt Abweichungen zwischen den Monte-Carlo-Niveaus. Im Bereich dazwischen stimmt die Verteilung der 2+1 Ereignisse gut und bei allen Ereignissen unter Berücksichtigung der dann leicht geänderten Normierung einigermaßen überein. Es scheint jedoch eine Verschiebung von großen Winkeln auf Partonniveau zu kleineren auf Detektorniveau vorzuliegen.
Betrachten wir jedoch zuerst den Randbereich bei hohen Winkeln (Abbildung 5.12d). Das LAr Kalorimeter endet bei 153 Grad und der auf Hadronen empfindlichste Bereich bereits etwas eher. Dies hat jedoch auch schon Auswirkungen bei leicht kleineren Winkeln, da dann der Jet einseitig abgeschnitten wird und sich der Jetwinkel leicht zu kleineren Werten verschiebt. Die Abweichungen hier sind also verständlich und es empfiehlt sich ein Schnitt auf Jetwinkel kleiner als 150 Grad.
Im Bereich kleiner 20 Grad liegt die Situation etwas anders. Hier übersteigt die Detektorverteilung die auf Partonniveau. Der Detektoranfang liegt bei vier Grad und dort ist auch ein entsprechender Abfall auf beiden Niveaus zu erkennen. Ein anderer Effekt erhöht jedoch die Anzahl Jets unter kleinen Winkeln. Der Protonrest verläßt den Detektor ungesehen durch das Strahlrohr. Dieser Rest kann durch Abstrahlung oder Hadronisierung in mehrere Hadronen zerfallen, die ähnlich den harten Jets einen gewissen Bereich im Detektor überdecken. Diese Hadronen fallen dann unter kleinen Winkeln in das Kalorimeter und hinterlassen dort ihre Energie. Wird ein harter Jet unter kleinen Winkeln gestreut, können sich diese überlagern und es ergeben sich Verfälschungen in der Energie und dem Winkel der Jets. Dies ist in Abbildung 5.13 zu erkennen. Dort ist die Energie des Protonrestes auf Partonniveau gegen die Energie des Jets aufgetragen, der aus dem Pseudoteilchen und eventuell zusätzlichen, rekonstruierten Clustern gebildet wurde. Die Größe der Boxen ist wieder logarithmisch. In den Teilbildern wurden jeweils unterschiedliche Jetwinkel Bereiche für den unteren harten Jet ausgewählt.
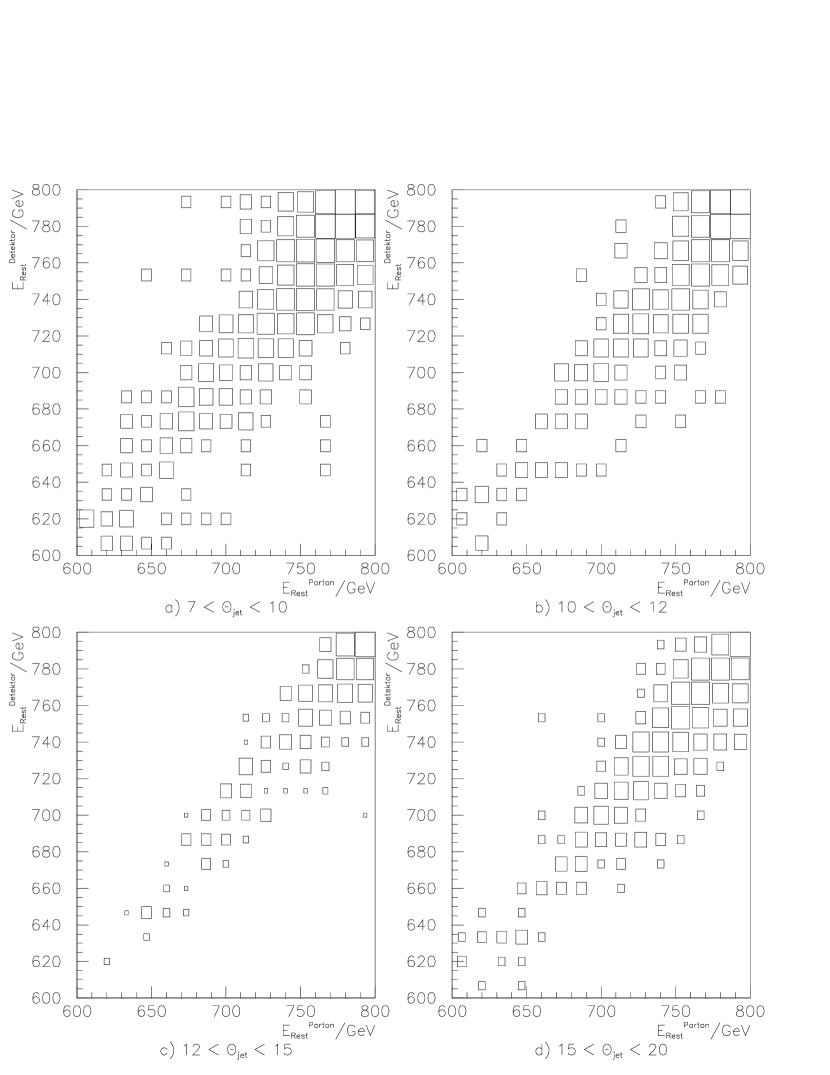
Im Bild links oben sind die Ereignisse gezeigt, deren unterster harter Jet im Bereich zwischen sieben Grad und zehn Grad liegt. Wir erkennen hier eine sehr breite Verteilung, die auf eine mangelnde Rekonstruktion schließen läßt. In der Abbildung daneben ist der Bereich zwischen zehn und zwölf Grad gezeigt. Hier zeigt sich eine nur leicht verbesserte Korrelation. Erst in den beiden unteren Graphen ist eine zufriedenstellende Korrelation erreicht. Die Bereiche sind hier zwölf bis 15 und 15 bis 20 Grad. Dies legt einen Winkelschnitt von 15 Grad nahe.
Bei Anwendung des Jetwinkelschnittes werden solche Ereignisse zur totalen Anzahl gezählt, die einen Winkel in dem angegebenen Bereich haben, zur 2+1 Jetanzahl jedoch nur dann, wenn beide harten Jets die Bedingung erfüllen. Dadurch kann jedoch die Situation eintreten, daß in einem Ereignis zwar zwei harte Jets gefunden werden, es aber als 1+1 Ereignis gehandhabt wird, da nur ein Jet den Winkelschnitt erfüllt. Dieses Vorgehen ist aber dem kompletten Verwerfen solcher Ereignisse vorzuziehen, da auch Ereignisse, deren zweiter Jet z.B. durch Detektorakzeptanzen erst garnicht detektiert wurde, beim totalen Wirkungsquerschnitt berücksichtigt werden.
Die Abhängigkeit der Rate von der Größe des unteren Schnittes ist in den Tabellen 5.14 und 5.15 für die oberen Bins gezeigt. Wir erkennen ein Abnehmen der Raten und ein Ansteigen der Korrekturfaktoren.
| Bin 6 | ||||||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Parton- | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 13.0 | 11.6 | 10.0 |
| rate | ||||||
| Detektor- | 12.4 | 12.4 | 11.9 | 10.4 | 8.5 | 6.7 |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.26 | 1.38 | 1.51 |
| faktor | ||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Parton- | 8.9 | 7.6 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | |
| rate | ||||||
| Detektor- | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 1.63 | 1.72 | 1.75 | 1.89 | 1.86 | |
| faktor | ||||||
| Bin 7 | ||||||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Parton- | 21.2 | 21.2 | 20.1 | 17.4 | 14.5 | 12.3 |
| rate | ||||||
| Detektor- | 19.1 | 19.1 | 17.8 | 14.2 | 10.9 | 8.5 |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.23 | 1.34 | 1.45 |
| faktor | ||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Parton- | 10.2 | 8.6 | 7.2 | 6.0 | 5.2 | |
| rate | ||||||
| Detektor- | 6.6 | 5.3 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 1.56 | 1.65 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | |
| faktor | ||||||
| Bin 8 | ||||||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Parton- | 23.6 | 23.6 | 22.4 | 20.3 | 17.0 | 13.9 |
| rate | ||||||
| Detektor- | 21.8 | 21.8 | 21.3 | 18.3 | 14.0 | 10.9 |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.12 | 1.22 | 1.28 |
| faktor | ||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Parton- | 11.5 | 9.4 | 8.0 | 7.1 | 6.6 | |
| rate | ||||||
| Detektor- | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.5 | 4.2 | |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 1.40 | 1.41 | 1.50 | 1.57 | 1.57 | |
| faktor | ||||||
Betrachten wir nun den mittleren Jetwinkelbereich. In Abbildung 5.14 ist die Korrelation des Jetwinkels auf Parton- gegen den auf Detektorniveau gezeigt. In Bild a sind alle Ereignisse verzeichnet. Die Übereinstimmung ist gut zu sehen, es erfolgen jedoch auch viele Fehl-Erkennungen. Bei den 2+1 Ereignissen, die in Bild b gezeigt sind, ist die Korrelation ebenfalls gut, die Statistik ist jedoch begrenzt.
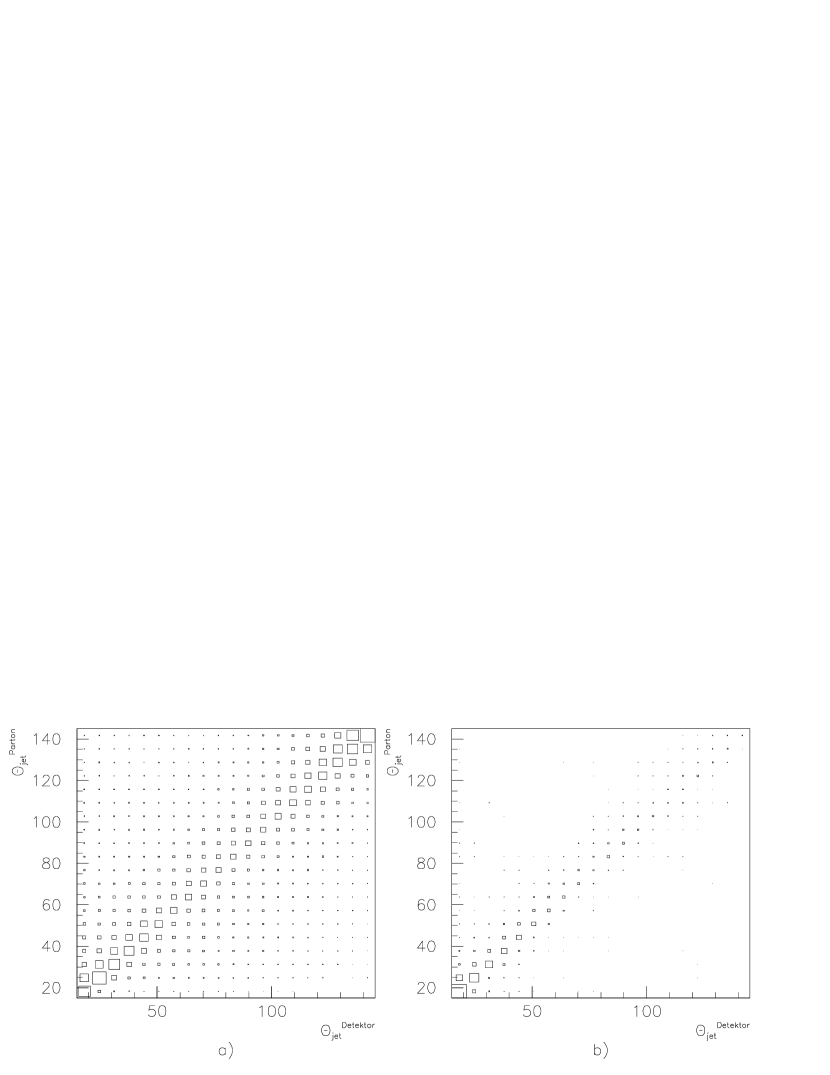
In Anbetracht der schlechten Beschreibung der Jetwinkel im Bereich kleiner und großer Winkel, ist ein Schnitt in dieser Größe sinnvoll. Wir erreichen dadurch eine gute Beschreibung im mittleren Winkelbereich. Dies ist aufgrund der guten Korrelation dort erlaubt. Der obere Schnitt sollte einen Wert von 145 bis 150 Grad haben. Bei der unteren Grenze ist die Angabe eines Wertes komplizierter. Ein zu tiefer Wert behält einen zu großen Teil der Problemzone bei. Um eine gute Übereinstimmung der beiden Monte-Carlo-Niveaus zu erreichen, wäre ein Schnitt von mindestens 20 Grad angebracht. Dabei verliert man jedoch viel Statistik, so daß sich der entsprechende Fehler vergrößert, und der Korrekturfaktor steigt, was eine Ratenmessung problematisch werden läßt. Der Schnitt sollte deshalb im Bereich zwischen zehn und 20 Grad je nach Anforderungen an die Messung liegen. Ist eine hohe Statistik erwünscht, so sollten schwächere Grenzen gewählt werden, wobei sich der systematische Fehler dann erhöht. Wir wählen die Grenzen 15 und 145 Grad.
5.8.2 Skalenvariable
Eine weitere Größe, die ich untersucht habe, ist die Verteilung in der Skalenvariable Sie ist definiert für 2+1 Jet Ereignisse durch den Viererimpuls des einlaufenden Protons P und die Viererimpulse der beiden harten Jets
| (5.16) | |||||
| (5.17) |
Der Winkel ist der Winkel zwischen den beiden harten Jets im hadronischen Schwerpunktsystem. Es gelten die beiden Beziehungen
| (5.18) | |||||
| (5.19) |
Abbildung 5.15 zeigt die Verteilung des jeweils minimalen für Parton- und Detektorniveau und für die Daten. Die Verteilungen sind auf gleiche Flächen normiert. Wir erkennen eine gute Übereinstimmung. Ein Schnitt in dieser Größe wird keine Änderung des Korrekturfaktors hervorrufen, da Parton- und Detektorniveau in gleicher Weise getroffen werden.
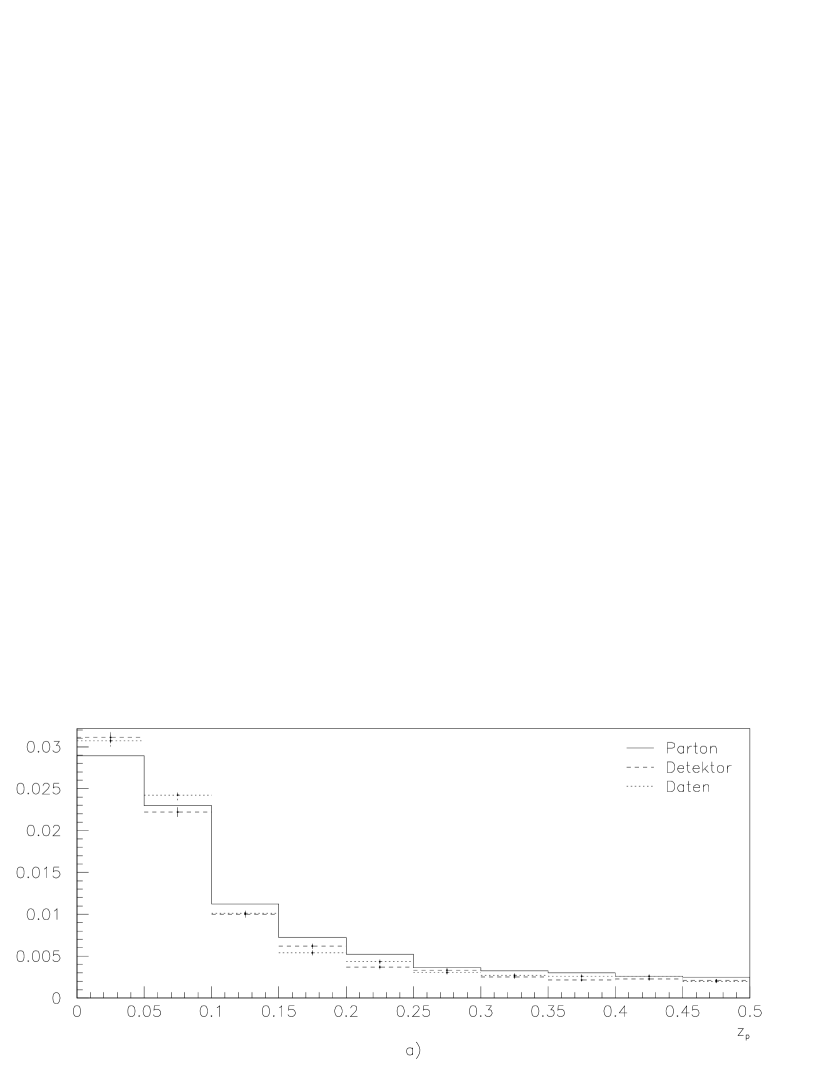
Um jedoch einen Einfluß des Schnittes auf die Migrationen und die Reinheit zu untersuchen, berechnen wir die Raten in Abhängigkeit eines minimalen Schnittes. Tabelle 5.16 zeigt das Ergebnis für die Bins drei, sechs und acht für drei unterschiedliche Schnittwerte. Diese Werte können mit denen in Tabelle 5.3 verglichen werden. Für die einzelnen Schnitte gilt, daß die Gesamtereigniszahl gleich bleibt, wobei jedoch einige der 2+1 Ereignisse durch die Schnitte nicht mehr als 2+1 Ereignisse gezählt werden. Auch hier ist dieses Verfahren sinnvoller als ein Verwerfen der Ereignisse, da Ereignisse, deren zweiter Jet nicht gefunden wurde, ebenfalls zur Gesamtanzahl gerechnet werden. Dadurch werden die Raten kleiner. Wir erkennen, daß der Einfluß des Schnittes auf den Korrekturfaktor im Rahmen der Fehler wie erwartet keine Änderung bewirkt, wobei das niedrige Bin etwas empfindlicher reagiert. Die Reinheit zeigt auch keine erkennbare Veränderung.
| Bin 3 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 9330 | 188 |
| ter | 2+1 | 168 | 198 |
| Bin 3 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 9563 | 123 |
| ter | 2+1 | 91 | 107 |
| Bin 3 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 9668 | 85 |
| ter | 2+1 | 60 | 71 |
| Bin 6 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6367 | 306 |
| ter | 2+1 | 177 | 392 |
| Bin 6 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6678 | 195 |
| ter | 2+1 | 118 | 251 |
| Bin 6 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6852 | 140 |
| ter | 2+1 | 67 | 183 |
| Bin 8 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1431 | 95 |
| ter | 2+1 | 71 | 229 |
| Bin 8 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1536 | 82 |
| ter | 2+1 | 52 | 156 |
| Bin 8 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1596 | 69 |
| ter | 2+1 | 44 | 117 |
| Bin | 3 | 6 | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Parton | 3.9 | 2.3 | 1.6 | 9.6 | 6.2 | 4.5 | 17.7 | 13.0 | 10.2 |
| in % | |||||||||
| Detektor | 3.7 | 2.0 | 1.3 | 7.9 | 5.1 | 3.5 | 16.4 | 11.4 | 8.8 |
| in % | |||||||||
| Korrek- | 1.05 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.21 | 1.29 | 1.08 | 1.14 | 1.16 |
| turfa. | |||||||||
| Reinheit | 54.1 | 54.0 | 54.2 | 68.9 | 68.0 | 73.2 | 76.3 | 75.0 | 72.7 |
| in % | |||||||||
Ein Schnitt in erscheint aus diesen Gründen nicht nötig, aber auch nicht verboten.
5.8.3 Transversaler Impuls
Der transversale Impuls der Jets im hadronischen Schwerpunktsystem ist ebenfalls untersucht worden. Wir erwarten hier nur geringe Impulswerte für 1+1 Jet Ereignisse, da der Protonrest den Detektor weiterhin in -Richtung verläßt. Bei 2+1 Jet Ereignissen sollten die transversalen Impulse der beiden harten Jets die gleiche Größe haben, da die transversale Impulssumme der harten Jets ebenfalls klein sein sollte.
Die zugehörigen Verteilungen sind in Abbildung 5.16 dargestellt. Im Bild links oben ist die Verteilung für alle Ereignisse in den drei Niveaus, daneben für die 2+1 Ereignisse gezeigt. Wir erkennen, daß der mittlere Wert für die 2+1 Verteilungen klar von Null abweicht, während die Verteilung für alle Ereignisse bei Null einen Peak zeigt. Im unteren Teil ist die Korrelation der beiden Werte der harten Jets für 2+1 Ereignisse abgebildet. Die Größe der Boxen ist wieder logarithmisch.
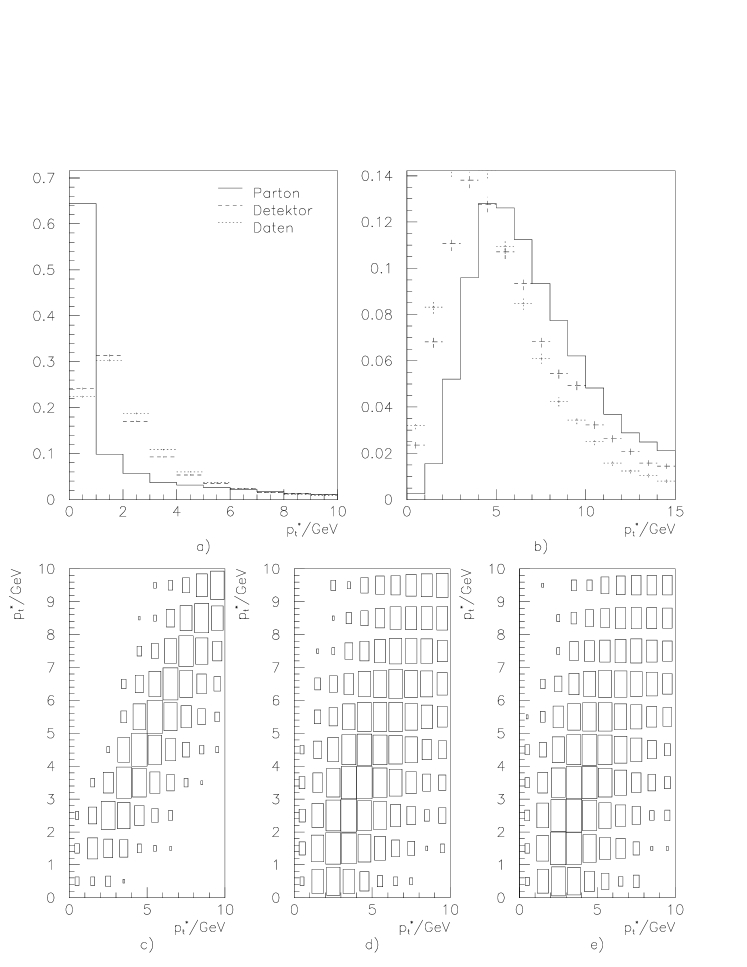
Die Korrelationen auf Partonniveau sind gut. Auf Detektorniveau und bei den Daten zeigt die Gegenüberstellung schlechtere Wert. Dies liegt an der Ungenauigkeit des transversalen Impulses im Laborsystem, die sich auch hier zeigen, da die Lorentztransformation fast ausschließlich in Richtung stattfindet. Im Rahmen der in Kapitel 5.2.4 betrachteten Impulsverteilung ist die Korrelation auch hier gut.
Vergleichen wir die Niveaus in Abbildung 5.16a, so fällt auf, daß auf Detektorniveau und bei den Daten weniger Jets mit einem transversalen Impuls kleiner als gefunden werden. Dies ist aufgrund der begrenzten Energieauflösung erklärbar. Insbesondere ist die Berechnung der Lorentztransformation auf die Genauigkeit der Rekonstruktion des hadronischen Endzustandes angewiesen. Dies verursacht wie erwähnt auch die Verbreiterung der Korrelationen in den Bildern c bis e, die in der gleichen Größenordnung liegen. Bei größeren transversalen Impulsen stimmen jedoch alle drei Verteilungen unter Beachtung der geänderten Normierung einigermaßen überein. Dies gilt ebenso für die 2+1 Ereignisse, da deren transversale Impulse, wie bereits erwähnt, größer sind. Die Beschreibung der Daten gelingt auch hier durch das Detektorniveau sehr gut.
Bei einem Schnitt in den transversalen Impuls in der Größe von erwarten wir also den Wegfall vieler 1+1 Jet Ereignisse, jedoch nur weniger mit zwei harten Jets. Dies wird in Tabelle 5.17 an den Migrationsmatrizen deutlich. Die Raten sind stark angestiegen. Beim Vergleich mit Tabelle 5.3 stellen wir einen Anstieg des Korrekturfaktorwertes fest. Die Variation ist mit 1.26 bis 1.40 kleiner und alle Werte sind im Rahmen ihrer Fehler mit dem Mittelwert 1.33 verträglich. Die Reinheit der 2+1 Jetklasse ist in allen Bins deutlich gestiegen. Dieser Schnitt verbessert auch aufgrund der geänderten Normierung die Verteilungen der transversalen Impulse.
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 607 | 221 |
| ter | 2+1 | 108 | 326 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 419 | 172 |
| ter | 2+1 | 72 | 247 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 453 | 204 |
| ter | 2+1 | 78 | 269 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 404 | 230 |
| ter | 2+1 | 87 | 330 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 320 | 176 |
| ter | 2+1 | 61 | 274 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 811 | 369 |
| ter | 2+1 | 105 | 556 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 543 | 283 |
| ter | 2+1 | 97 | 560 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 239 | 127 |
| ter | 2+1 | 33 | 274 |
| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Parton | 43.3 | 46.0 | 47.1 | 53.3 | 54.2 | 50.2 | 56.8 | 59.6 |
| in % | ||||||||
| Rate Detektor | 34.4 | 35.1 | 34.6 | 39.7 | 40.3 | 35.9 | 44.3 | 45.6 |
| in % | ||||||||
| Korrektur- | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.40 | 1.28 | 1.31 |
| faktor | ||||||||
| Reinheit in % | 75.1 | 77.4 | 77.5 | 79.1 | 81.8 | 84.1 | 85.2 | 89.3 |
Die Qualität des Schnittes trügt jedoch. Dies sieht man an der Ratenänderung in Abhängigkeit der Größe des Schnittes. Wir erkennen hier sehr große Korrekturfaktoren. Der Unterschied zwischen den Detektorraten bei den Migrationsmatrizen und bei der Berechnung in der Tabelle 5.19 liegt darin begründet, daß bei den Migrationsmatrizen nur die Ereignisse gezeigt werden, die die Schnitte auf beiden Niveaus erfüllen. Viele Ereignisse haben aber, wie wir in Abbildung 5.16a gesehen haben, einen verschwindenden transversalen Impuls auf Partonniveau, jedoch einen höheren auf Detektorniveau. Eine Stabilisierung auf hohem Niveau tritt erst ein, wenn die Verteilung der transversalen Impulse auf beiden Niveaus übereinstimmt.
| Bin 6 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Parton- | 14.6 | 32.2 | 46.9 | 60.6 | 68.9 | 73.3 |
| rate | ||||||
| Detektor- | 12.4 | 14.2 | 18.5 | 23.7 | 27.6 | 31.4 |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 1.19 | 2.28 | 2.55 | 2.56 | 2.50 | 2.34 |
| faktor | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Parton- | 75.9 | 77.3 | 77.9 | 75.5 | 74.3 | |
| rate | ||||||
| Detektor- | 34.5 | 38.3 | 41.0 | 42.6 | 45.1 | |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 2.21 | 2.02 | 1.90 | 1.77 | 1.65 | |
| faktor | ||||||
| Bin 7 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Parton- | 21.2 | 37.6 | 53.6 | 65.5 | 72.3 | 77.4 |
| rate | ||||||
| Detektor- | 19.1 | 20.3 | 23.5 | 26.8 | 29.4 | 30.7 |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 1.11 | 1.86 | 2.29 | 2.45 | 2.46 | 2.52 |
| faktor | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Parton- | 78.1 | 78.6 | 77.7 | 77.9 | 76.9 | |
| rate | ||||||
| Detektor- | 32.0 | 31.6 | 31.7 | 32.0 | 33.1 | |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 2.45 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | |
| faktor | ||||||
| Bin 8 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Parton- | 23.6 | 39.4 | 54.7 | 66.1 | 73.9 | 77.8 |
| rate | ||||||
| Detektor- | 21.8 | 22.7 | 25.2 | 27.4 | 29.2 | 31.2 |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 1.09 | 1.74 | 2.17 | 2.42 | 2.54 | 2.50 |
| faktor | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Parton- | 81.1 | 81.9 | 79.0 | 79.4 | 79.5 | |
| rate | ||||||
| Detektor- | 32.3 | 34.0 | 32.4 | 31.4 | 32.0 | |
| rate | ||||||
| Korrektur- | 2.51 | 2.41 | 2.44 | 2.53 | 2.49 | |
| faktor | ||||||
Ein Schnitt in dieser Größe ist gefährlich, da die Verteilung in keinem Bereich gut beschrieben wird.
5.8.4 Hadronische Schwerpunktenergie
Die bereits in Kapitel 3.1.1 in Gleichung 3.5 eingeführte Variable kann in der Praxis für 2+1 Jet Ereignisse durch zwei unterschiedliche Methoden berechnet werden. Die eine berechnet die invariante Masse des harten hadronischen Endzustandes und die andere benutzt die Jetwinkel im hadronischen Schwerpunktsystem. Während die zweite Berechnung eindeutig vom Jetalgorithmus abhängig ist, trifft dies für die erste Methode nur in abgeschwächter Form zu. Das Problem bei der Berechnung über den hadronischen Endzustand ist, daß nur die Cluster verwendet werden dürfen, die zu den harten Jets gehören, nicht jedoch die es Protonrestes. Dazu ist jedoch ein Jetalgorithmus nötig.
Die Berechnung kann dann durch die Formeln
| (5.20) | |||||
| (5.21) |
mit den Pseudorapiditäten der beiden harten Jets im hadronischen Schwerpunktsystem erfolgen.
In Abbildung 5.17 sind die Werte gegenübergestellt, die mit den unterschiedlichen Methoden berechnet wurden. Aufgetragen wurde die Wurzel von Dabei ist oben für Daten, Parton- und Detektorniveau die Korrelation dargestellt und in Bild d der Absolutbetrag der Differenz aufgetragen. Wir erkennen, daß die Verteilung in allen Niveaus ähnlich ist, nur im Bereich kleiner Unerschiede macht sich die zusätzliche Begrenzung durch die Energieauflösung bemerkbar. Die Korrelationen zwischen den beiden Berechnungen ist jedoch nicht sehr gut. Die Skalierung der Boxen ist logarithmisch.
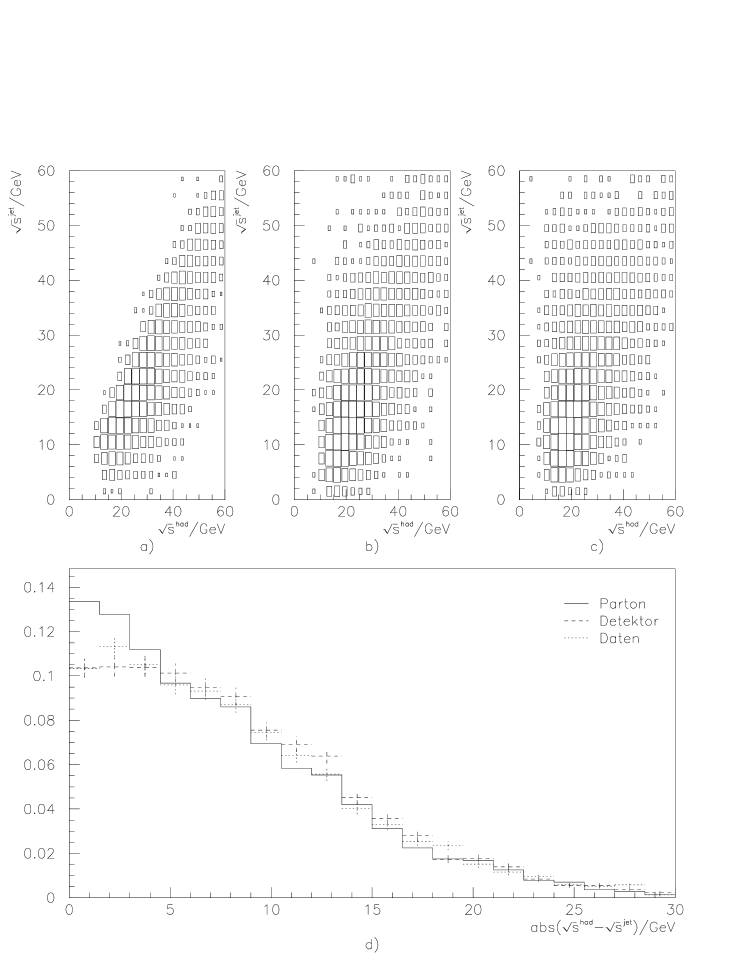
Die zugehörigen Migrationen wurden berechnet und in Tabelle 5.20 exemplarisch für die Bins drei, sechs und acht mit drei verschiedenen Schnitten aufgetragen. Der höchste Schnitt 3 ist hier der loseste und gibt deshalb die höchste Statistik. Der Korrekturfaktor ändert sich nur im Bin acht, dort vergrößert er sich jedoch stark. Die Reinheit verschlechtert sich in allen Bins mit stärkerem Schnitt.
| Bin 3 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 9507 | 147 |
| ter | 2+1 | 157 | 73 |
| Bin 3 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 9233 | 235 |
| ter | 2+1 | 251 | 165 |
| Bin 3 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 9043 | 294 |
| ter | 2+1 | 314 | 233 |
| Bin 6 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6674 | 261 |
| ter | 2+1 | 184 | 123 |
| Bin 6 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6352 | 342 |
| ter | 2+1 | 261 | 287 |
| Bin 6 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6125 | 404 |
| ter | 2+1 | 288 | 425 |
| Bin 8 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1540 | 149 |
| ter | 2+1 | 56 | 81 |
| Bin 8 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1412 | 171 |
| ter | 2+1 | 77 | 166 |
| Bin 8 | Parton | ||
|---|---|---|---|
| Schnitt 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1361 | 153 |
| ter | 2+1 | 85 | 227 |
| Bin | 3 | 6 | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Parton | 2.2 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 8.7 | 11.4 | 12.6 | 18.5 | 20.8 |
| in % | |||||||||
| Detektor | 2.3 | 4.2 | 5.5 | 4.2 | 7.6 | 9.8 | 7.5 | 13.3 | 17.1 |
| in % | |||||||||
| Korrek- | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.25 | 1.15 | 1.16 | 1.68 | 1.39 | 1.22 |
| turfa. | |||||||||
| Reinheit | 31.7 | 39.7 | 42.6 | 40.1 | 52.4 | 59.6 | 59.1 | 68.3 | 72.8 |
| in % | |||||||||
Ein Schnitt in dieser Variable ist nicht empfehlenswert.
5.8.5 Rapiditätsdifferenz
Ein weiterer Schnitt, den es zu untersuchen lohnt, bezieht sich auf die räumliche Verteilung der Jets. Schon anschaulich ist klar, daß Verwechslungen verstärkt auftreten, wenn die Jets nahe beieinander liegen und sich so nach der Hadronisierung teilweise durchdringen. Um diese Ereignisse zu unterdrücken ist ein Schnitt sinnvoll, der einen minimalen Rapiditätsunterschied zwischen den beiden harten Jets verlangt. In Abbildung 5.18 ist deshalb die Verteilung des Rapiditätsunterschiedes auf den beiden Monte-Carlo-Niveaus und bei den Daten aufgetragen. Wir erkennen eine gute Beschreibung der Daten durch den Detektorlevel des Monte-Carlos. Die Partonjets sind jedoch im Durchschnitt etwas dichter beieinander und die Verteilung ist leicht verschoben.
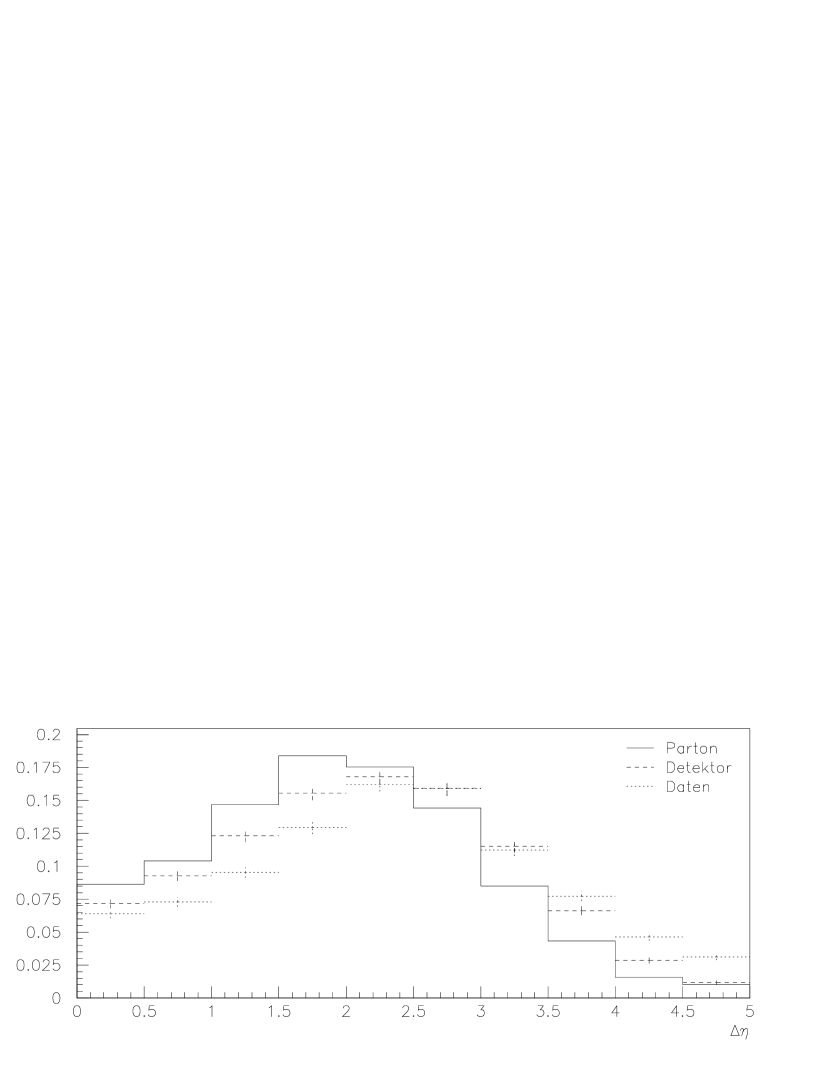
In Tabelle 5.21 sind die Migrationen für einen Mindestabstand von eingetragen. Im Vergleich zu Tabelle 5.3 erkennen wir eine Erniedrigung des Korrekturfaktors und eine Verschlechterung der Reinheit. Auffällig ist weiterhin die Änderung der Abhängigkeit. Die Raten schwanken zwar auf beiden Niveaus und steigen leicht an, jedoch ist die Steigung minimal und im achten Bin ist eine starke Reduktion zu sehen.
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 12705 | 260 |
| ter | 2+1 | 420 | 176 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 9593 | 220 |
| ter | 2+1 | 327 | 129 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 9208 | 231 |
| ter | 2+1 | 323 | 122 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 8400 | 276 |
| ter | 2+1 | 294 | 133 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 5755 | 169 |
| ter | 2+1 | 229 | 125 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6555 | 276 |
| ter | 2+1 | 230 | 181 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 4083 | 152 |
| ter | 2+1 | 154 | 115 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1731 | 35 |
| ter | 2+1 | 32 | 28 |
| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Parton | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 6.3 | 5.9 | 3.5 |
| in % | ||||||||
| Rate Detektor | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 3.3 |
| in % | ||||||||
| Korrektur- | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.96 | 0.83 | 1.11 | 0.99 | 1.05 |
| faktor | ||||||||
| Reinheit in % | 29.5 | 28.3 | 27.4 | 31.1 | 35.3 | 44.0 | 42.8 | 46.7 |
Ein Schnitt in dieser Variable ist für Jetanalysen ungeeignet.
5.8.6 Quarkwinkel
Wie wir schon in Kapitel 5.8.1 an Abbildung 5.12a und b gesehen haben, treten große Jetwinkel hauptsächlich bei 1+1 Ereignissen auf, wohingegen nahezu alle 2+1 Ereignisse einen Jet unter kleinen Winkeln haben. Durch einen Schnitt ließe sich somit das Verhältnis von 2+1 zu 1+1 Jet Ereignissen und damit die Rate verändern. Besser als der Jetwinkel eignet sich hierfür der Winkel des nach dem harten Stoß auslaufenden Quarks im Quark Parton Modell. Dieser Winkel läßt sich wegen der relativ einfachen Reaktionskinematik des Born Graphen aus der Messung des gestreuten Elektrons durch die folgende Gleichung herleiten :
| (5.22) |
Die Werte für und werden dabei wie in Kapitel 5.2.1 erläutert berechnet.
Abbildung 5.19 zeigt die Verteilung des Quarkwinkels für alle und für die 2+1 Ereignisse in beiden Bereiche getrennt. Die Verteilungen zeigen eine unbefriedigende Beschreibung der Daten. Nur im Bereich ist die Beschreibung gut. Das gleiche gilt für den Unterschied zwischen den Monte-Carlo-Niveaus. Ein Schnitt auf einen maximalen Quarkwinkel verwirft im hohen Bereich wesentlich mehr 1+1 Ereignisse als solche mit 2+1 Jets. Wir erwarten daher eine Ratensteigerung. Im Bereich gilt die gleiche Aussage. Die Verteilungen sind jedoch steiler, so daß ein Schnitt hier die Statistik stark reduziert.
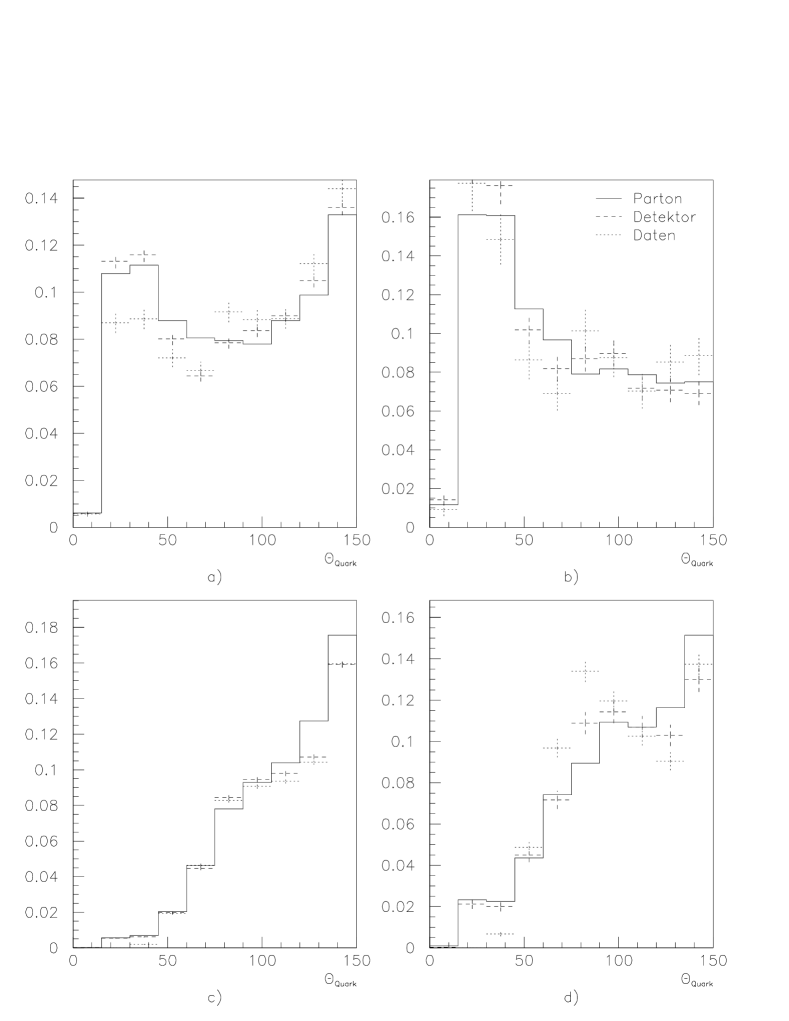
Ein Schnitt auf einen maximalen Quarkwinkel verwirft mehr 1+1 Ereignisse als solche mit 2+1 Jets. Wir erwarten somit eine Ratensteigerung. Der Effekt ist bei einer Grenze von 100 Grad am deutlichsten zu sehen. Die Migrationen, die sich aus der Anwendung dieses Schnittes ergeben, sond in Tabelle 5.22 gezeigt. Ein Vergleich mit Tabelle 5.3 zeigt die Bestätigung des oben gesagten. Die Raten sind auf beiden Niveaus gestiegen, wobei es in den verschiedenen Bins jedoch starke Unterschiede gibt. Die Reinheit ist in etwa konstant geblieben und der Korrekturfaktor hat sich nur in den drei unteren Bins verändert. In diesen Bins macht sich die Reduktion der Statistik stark bemerkbar. Der relative Fehler ist von ca. 5% ohne Schnitt auf ca. 20% mit Schnitt angestiegen.
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 198 | 5 |
| ter | 2+1 | 14 | 10 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 668 | 17 |
| ter | 2+1 | 29 | 20 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1183 | 27 |
| ter | 2+1 | 55 | 44 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1726 | 89 |
| ter | 2+1 | 83 | 100 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 2165 | 121 |
| ter | 2+1 | 133 | 148 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1526 | 187 |
| ter | 2+1 | 136 | 261 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 2187 | 253 |
| ter | 2+1 | 178 | 490 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1069 | 137 |
| ter | 2+1 | 92 | 260 |
| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Parton | 6.6 | 5.0 | 5.4 | 9.5 | 10.5 | 21.2 | 23.9 | 25.5 |
| in % | ||||||||
| Rate Detektor | 10.6 | 6.7 | 7.6 | 9.2 | 10.9 | 18.8 | 21.5 | 22.6 |
| in % | ||||||||
| Korrektur- | 0.62 | 0.76 | 0.72 | 1.03 | 0.96 | 1.13 | 1.11 | 1.13 |
| faktor | ||||||||
| Reinheit in % | 41.7 | 40.8 | 44.4 | 54.6 | 52.7 | 65.7 | 73.4 | 73.9 |
Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse ist ein Schnitt im Quarkwinkel nur in den hohen Bins sinnvoll. Er verbessert die Migrationen jedoch nicht.
5.9 Alternative Ratenberechnung
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels untersuchen wir einen alternativen Ansatz die Jetrate zu bestimmen. Dieser verzichtet auf einen Jetalgorithmus und macht sich die Tatsache zu nutze, daß die Energieverteilung im Breitsystem je nach Anzahl der Jets unterschiedlich ist[Hoe95]. Hierzu machen wir uns klar, wie sich 2+1 Ereignisse im Breitsystem verhalten. Dabei tritt das Problem auf, daß ungleich Null ist (siehe Kapitel 5.8.4) und somit nach Gleichung 3.11 die Bjorken Skalenvariable nicht dem Partonimpulsbruchteil entspricht. Deshalb wird das einlaufende Parton nach der Transformation nicht mehr durch das Austauschteilchen wie an einer harten Wand reflektiert (siehe Kapitel 4.1.3 und Abbildung 4.3). Es verbleibt statt dessen ein Restimpuls. Im Spezialfall ist der Impuls des Photons entgegengesetzt gleich groß wie der Impuls des Partons. Die Jets laufen in entgegengesetzte Richtungen aus. Ist noch größer, werden sogar beide Jets in die Photon Hemisphäre gelenkt. Dies wird in Abbildung 5.20 verdeutlicht.
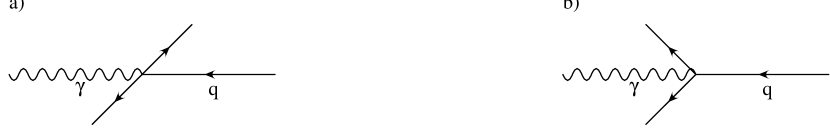
Legen wir nun zwei Bereiche im Breitsystem fest. Die Grenze wird durch einen Winkel relativ zur einlaufenden Partonrichtung festgelegt. Wir benutzen im folgenden 90 Grad zur Trennung der sogenannten Current Hemisphäre, d.i. die Seite mit dem einlaufenden Parton, und der Target Hemisphäre, d.i. die Seite mit einlaufendem Photon. Wir erwarten in der Current Hemisphäre die gesamte Schwerpunktenergie im Falle eines 1+1 Ereignisses und bei 2+1 Jet Ereignissen mit Bei erwarten wir keine Energie in der Current Hemisphäre. Abbildung 5.21 zeigt die Verteilung auf den beiden Monte-Carlo-Niveaus und bei den Daten. Auf Partonniveau entspricht die Verteilung den Erwartungen. Das Detektorniveau beschreibt die Daten einigermaßen, die Verteilungen sind aber sehr breit. Wir benutzen nun einen Abschneideparameter und definieren Ereignisse mit als 2+1 Jet Ereignisse und die mit größerer Current Energie als 1+1 Jet Ereignisse.
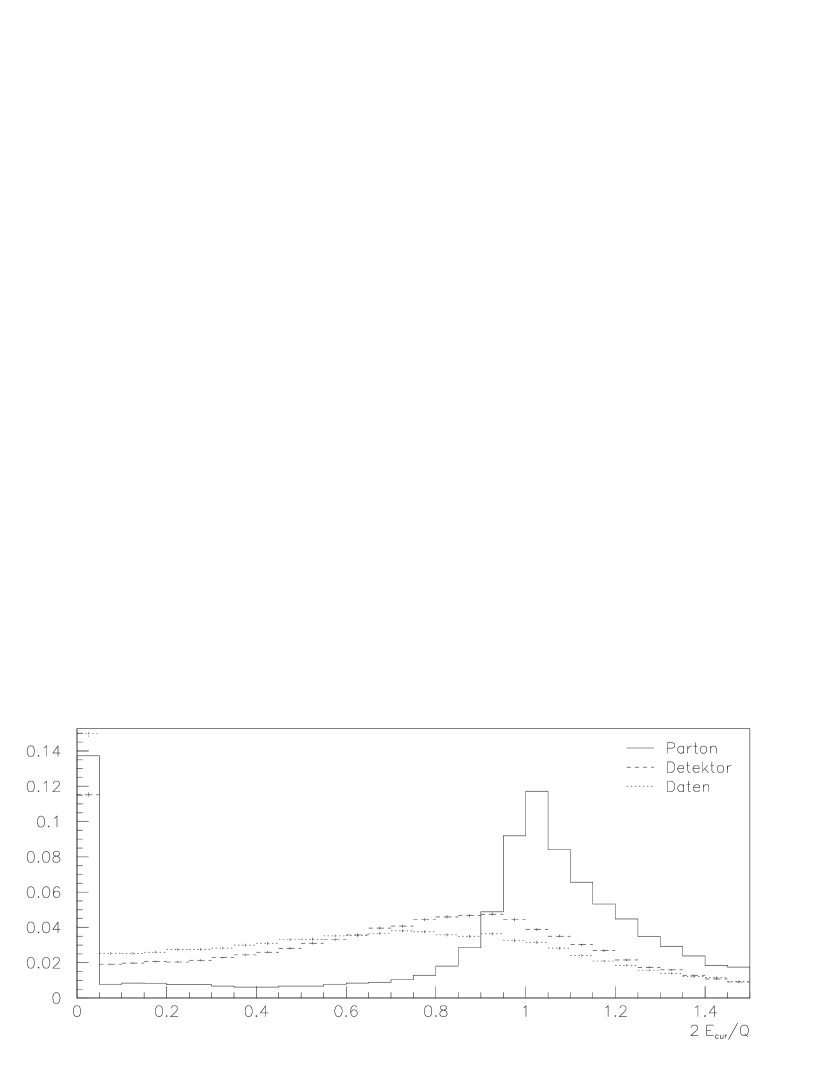
Die Migrationen in Tabelle 5.23 zeigen ein merkwürdiges Verhalten. Die Raten fallen mit steigendem Ob dies durch die Theorie beschrieben wird, ist unklar, da die vorhandenen Theorieprogramme die Partonjets erzeugen, nicht jedoch die Cluster. Ein Vergleich in nächst-zu-führender Ordnung ist somit nicht möglich. Auch die Reinheit der Jetklassen ist in den unteren vier Bins besser als beim JADE Algorithmus, während die oberen Bins eine schlechtere Reinheit zeigen. Der Korrekturfaktor zeigt ein uneinheitliches Verhalten.
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 8569 | 1297 |
| ter | 2+1 | 1474 | 2221 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6709 | 894 |
| ter | 2+1 | 1187 | 1479 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6844 | 739 |
| ter | 2+1 | 1053 | 1248 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6691 | 535 |
| ter | 2+1 | 932 | 945 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 5117 | 252 |
| ter | 2+1 | 499 | 410 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6648 | 165 |
| ter | 2+1 | 165 | 264 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 4308 | 38 |
| ter | 2+1 | 77 | 81 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1803 | 5 |
| ter | 2+1 | 11 | 7 |
| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Parton | 25.9 | 23.1 | 20.1 | 16.3 | 10.5 | 5.9 | 2.6 | 0.7 |
| in % | ||||||||
| Rate Detektor | 27.2 | 26.0 | 23.3 | 20.6 | 14.5 | 5.9 | 3.5 | 1.0 |
| in % | ||||||||
| Korrektur- | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.67 |
| faktor | ||||||||
| Reinheit in % | 60.1 | 55.5 | 54.2 | 50.3 | 45.1 | 61.5 | 51.3 | 38.9 |
Ein Vergleich zwischen der Jetklassifizierung über die Current Energie mit dem JADE Algorithmus ist in Tabelle 5.24 dargestellt. Wie wir schon aufgrund des völlig unterschiedlichen Verhaltens erwarten konnten, ist die Korrelation sehr schlecht.
| Parton- | alternativ | ||
|---|---|---|---|
| niveau | 1+1 | 2+1 | |
| JADE | 1+1 | 56980 | 9442 |
| 2+1 | 3766 | 2969 | |
| Detektor- | alternativ | ||
|---|---|---|---|
| niveau | 1+1 | 2+1 | |
| JADE | 1+1 | 49991 | 10659 |
| 2+1 | 3379 | 2529 | |
Diese Jetanzahlbestimmung hat den Vorteil, daß sie die Klassifizierung nicht über einen Algorithmus durchführt, sondern durch Berechnung nur eines Wertes. Der Nachteil dieses Verfahrens, neben den oben angesprochenden, ist, daß die Jets selber nicht bestimmt werden. Es sind somit keine weiteren Schnitte auf z.B. Jetwinkel möglich.
Kapitel 6 Zusammenfassung und Ausblick
6.1 Zusammenfassung
Aus den im vorigen Kapitel gezeigten Untersuchungen werden die unten genannten Schnitte gefolgert :
- •
-
•
und der Jetwinkelschnitt
Mit diesen Schnitten ergeben sich die in Tabelle 6.1 aufgetragenen Migrationen. Im Vergleich zur Tabelle 5.3 zeigen sich hier die kleineren Raten und der erhöhte Korrekturfaktor. Der ungewichtete Mittelwert des Korrekturfaktors ist Im Rahmen ihrer Fehler sind alle Werte mit dem mittleren Korrekturfaktor verträglich. Auch die Schwankungen in der Reinheit sind kleiner. Die Reinheit selber hat sich durch den Schnitt erhöht.
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6716 | 128 |
| ter | 2+1 | 61 | 81 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6343 | 74 |
| ter | 2+1 | 30 | 52 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6584 | 114 |
| ter | 2+1 | 34 | 52 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 6647 | 121 |
| ter | 2+1 | 40 | 56 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 5351 | 91 |
| ter | 2+1 | 26 | 43 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 5413 | 240 |
| ter | 2+1 | 66 | 176 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 3954 | 172 |
| ter | 2+1 | 57 | 137 |
| Bin | Parton | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 1+1 | 2+1 | |
| Clus- | 1+1 | 1508 | 62 |
| ter | 2+1 | 21 | 74 |
| Bin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate Parton | 3.0 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 7.1 | 7.2 | 8.2 |
| in % | ||||||||
| Rate Detektor | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 4.1 | 4.5 | 5.7 |
| in % | ||||||||
| Korrektur- | 1.47 | 1.54 | 1.93 | 1.84 | 1.94 | 1.72 | 1.59 | 1.43 |
| faktor | ||||||||
| Reinheit in % | 57.0 | 63.4 | 60.5 | 58.3 | 62.3 | 72.7 | 70.6 | 77.9 |
Vergleichen wir nun die in Kapitel 5 untersuchten Verteilungen noch einmal unter Berücksichtigung des Jetwinkelschnittes in den Abbildungen 6.1 und 6.2. Bei der Verteilung haben wir im Vorwärtsbereich nicht den gesamten ungenügend beschriebenen Bereich durch unseren Schnitt beseitigt. Die Gründe für die Wahl dieser Grenzen sind schon in Kapitel 5.8.1 besprochen worden. Die Verteilung für die 2+1 Raten stimmt nun jedoch auf allen drei Niveau hervorragend überein. (vergleiche Abbildung 5.12). Für die Verteilung des transversalen Impulses im hadronischen Schwerpunktsystem gilt die gleiche Aussage (vergleiche Abbildung 5.16). Die Gesamtverteilung stimmt aus Gründen der Energiekalibration nur für den Vergleich zwischen Monte-Carlo-Detektorniveau und Daten. Auch hier hat sich die Verteilung der 2+1 Jet Ereignisse wesentlich verbessert. Die Verschiebung zwischen Parton- und Detektorniveau wurde also durch die schlecht beschriebene Jetwinkelverteilung ausgelöst.
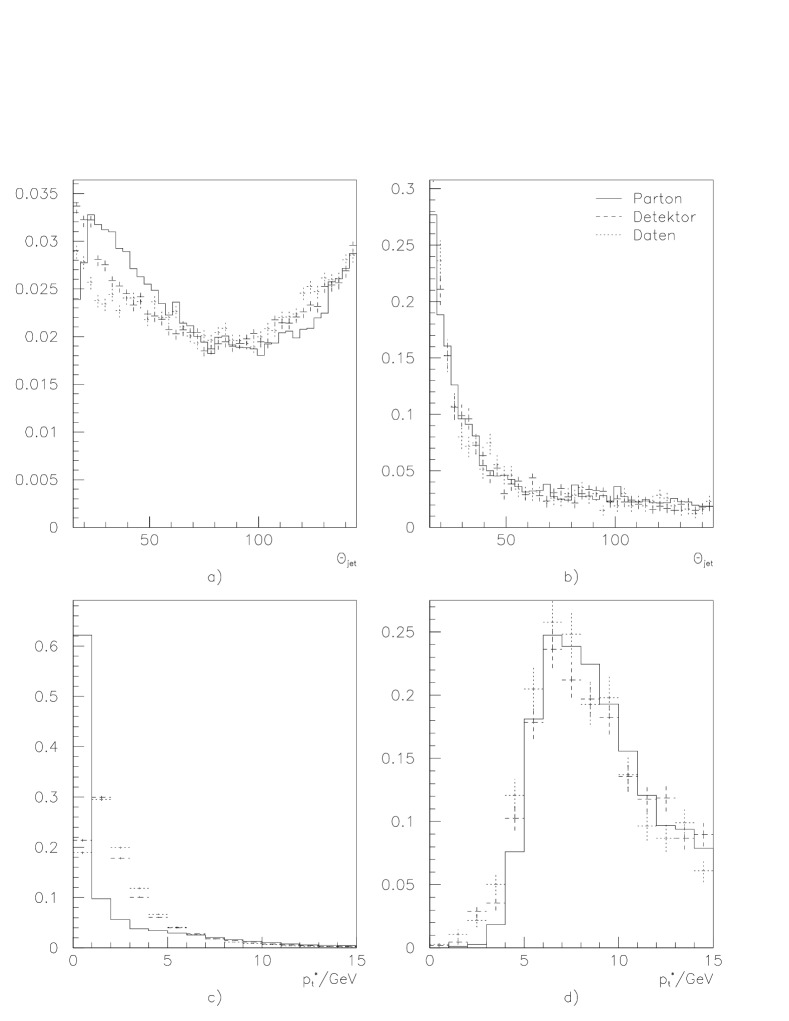
Die Quarkwinkelverteilungen waren vor dem Schnitt unbefriedigend beschrieben (siehe Abbildung 5.19). Dies hat sich auch mit der Einschränkung des Jetwinkelbereiches nicht geändert (Abbildung 6.2a und b). Das Aussehen der Verteilung hat sich geändert. Im untersten Bin sind nun wesentlich weniger Einträge. In diesem Bin ist die Übereinstimmung zwischen Parton- und Detektorniveau nicht mehr gegeben. Dies kann in Anbetracht der Stärke der Steigung jedoch ein reiner Migrationseffekt sein (vergleiche Abbildung 5.15). Die Verteilung des Rapiditätsunterschiedes hat sich am stärksten geändert. Dies ist auch verständlich, da durch den Jetwinkelschnitt die Jets unter extremen Winkeln wegfallen. Daher finden wir nur noch solche Ereignisse, deren Jets wesentlich dichter zusammen liegen.
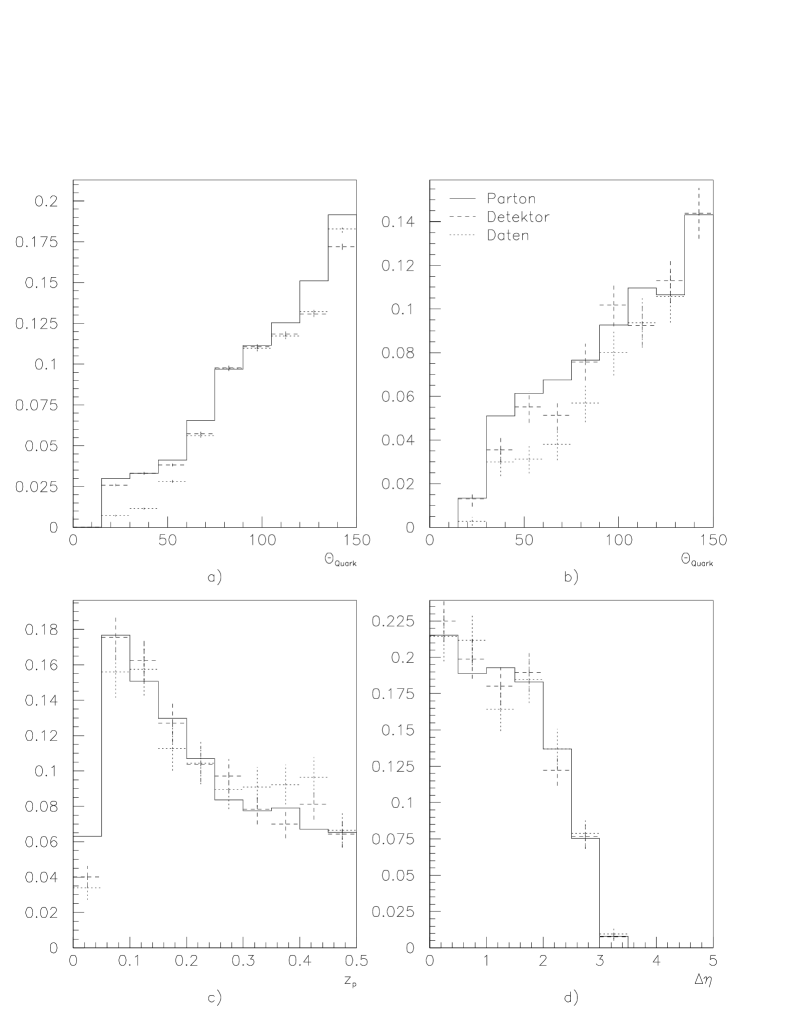
Betrachten wir nun noch einmal die Abhängigkeit des Ergebnisses vom Jetalgorithmus. Der Jetwinkelschnitt wurde dabei immer im Laborsystem angewandt, d.h. die Partikel wurden erst in das entsprechende System transformiert, danach der Jetalgorithmus angewandt und danach wurden die Jets zurücktransformiert. Anschließend wurde der Jetwinkelschnitt durchgeführt. Das Ergebnis ist in den Abbildungen 6.3 bis 6.7 und den Tabellen 6.2 bis 6.4 gezeigt. Ein Vergleich mit den entsprechenden Abbildungen und Tabellen im Kapitel 5.4 verdeutlicht, daß wir durch den Schnitt im Jetwinkel wesentlich kleinere Raten und einen erhöhten Korrekturfaktor finden. Die Werte bei den verschiedenen Jetalgorithmen zeigen nun jedoch kleinere Abweichungen. Die Abhängigkeit vom Jetalgorithmus und vom Lorentzsystem ist deutlich kleiner geworden. Sicherlich kann noch nicht von einer Übereinstimmung der verschiedenen Algorithmen gesprochen werden.
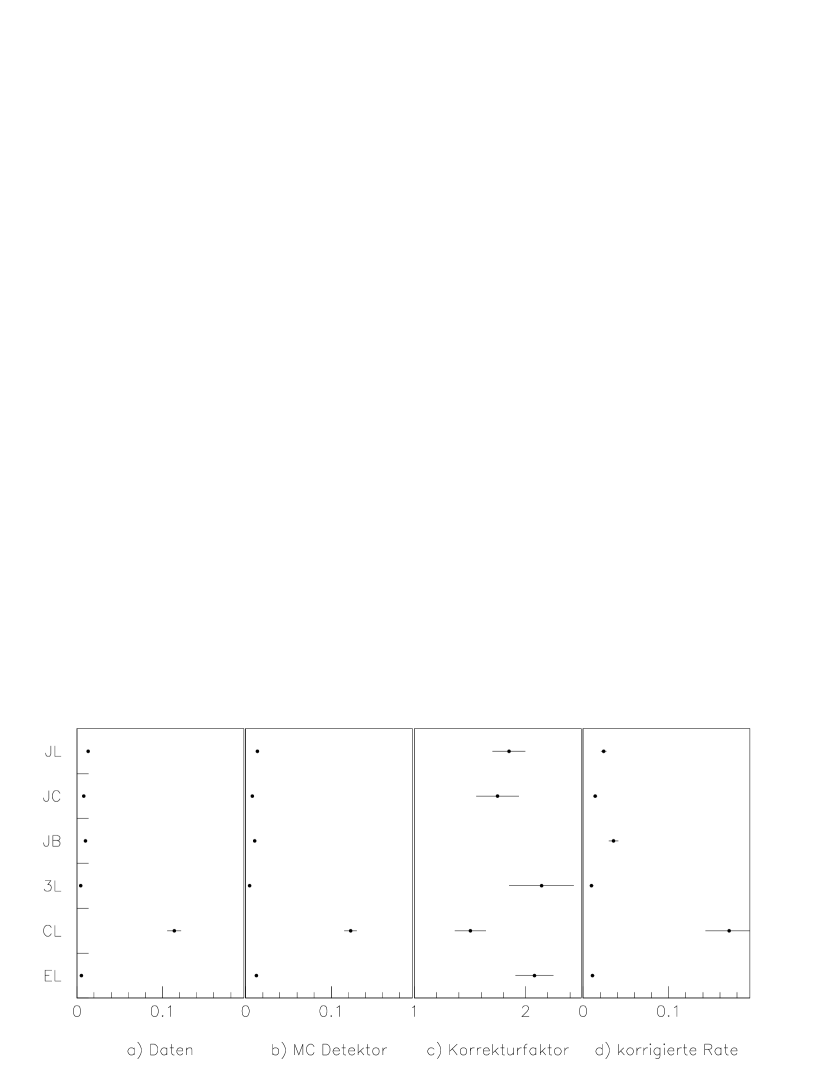
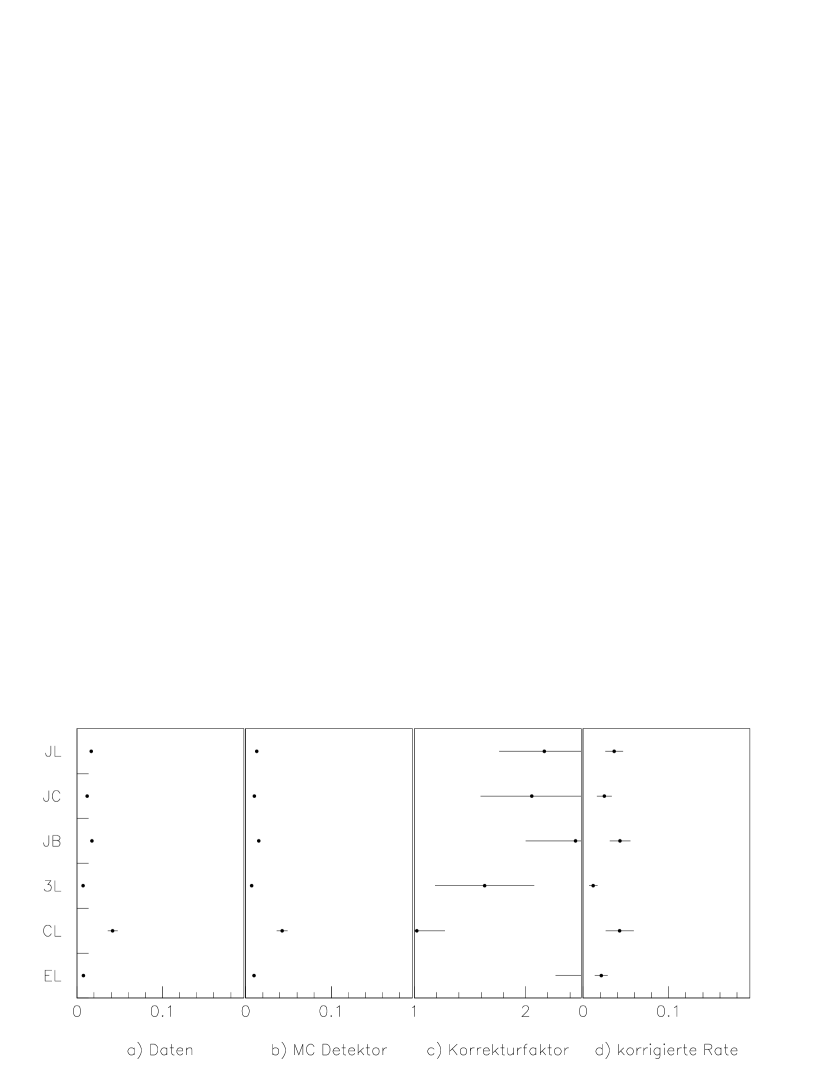
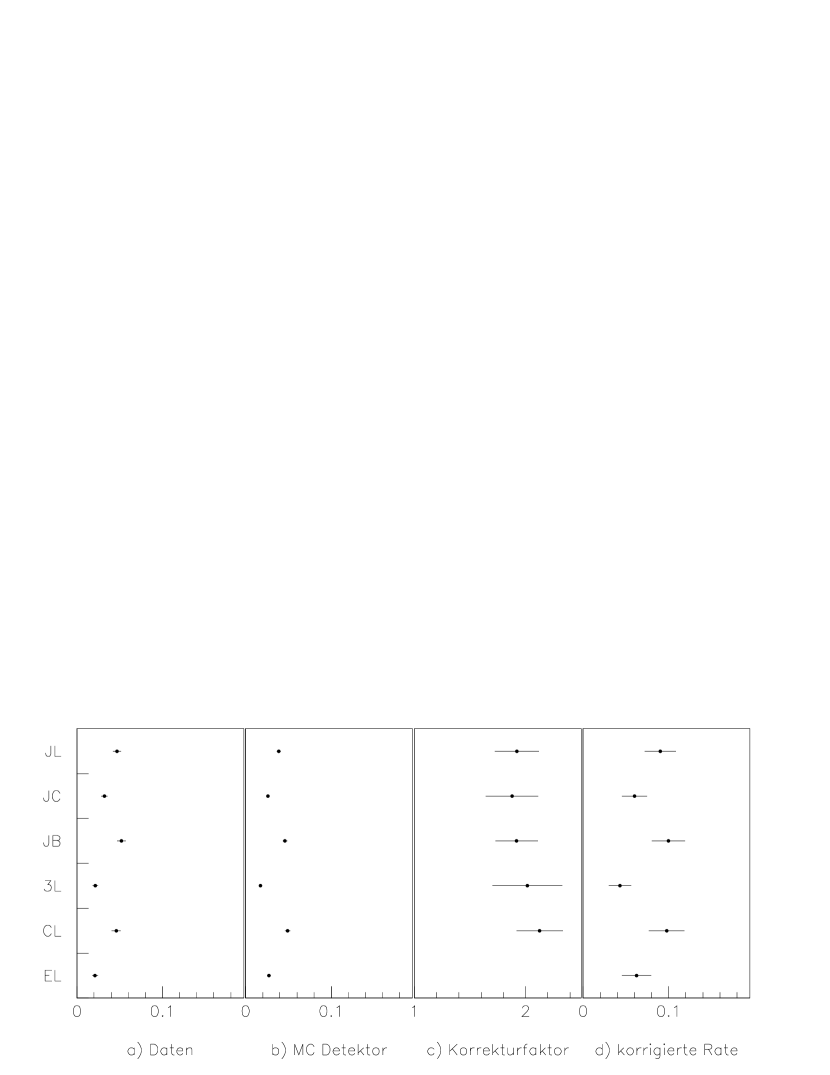
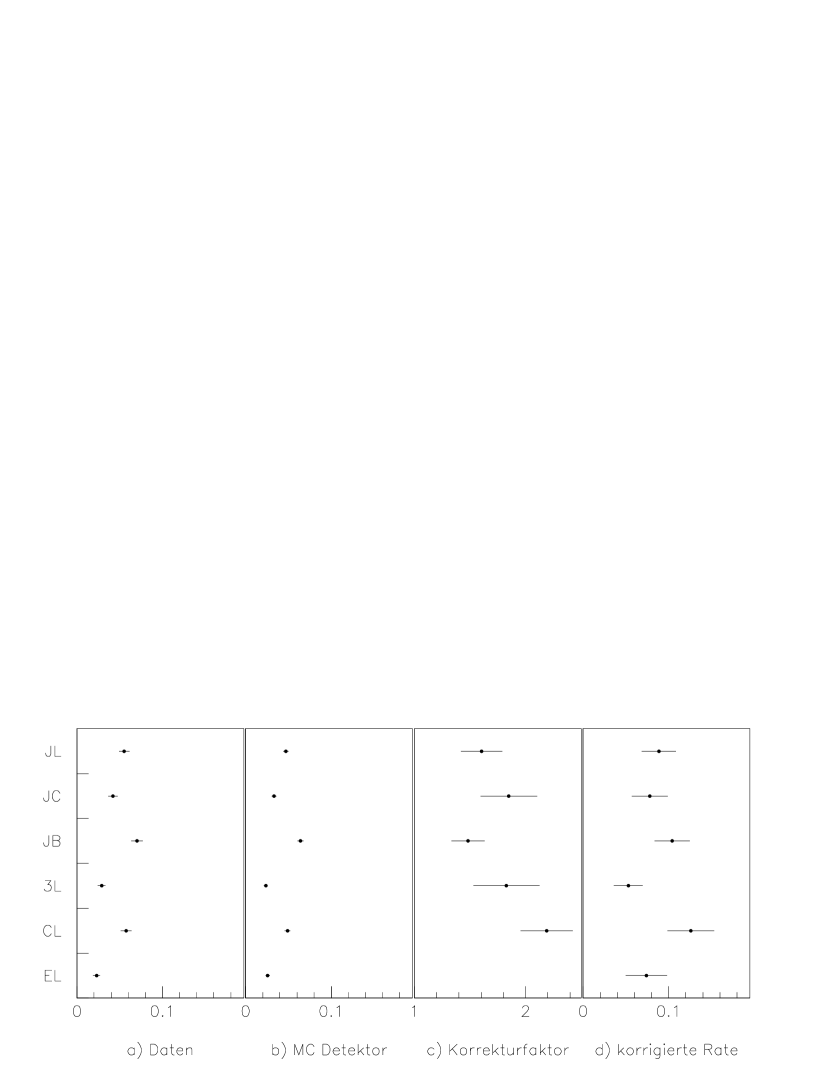
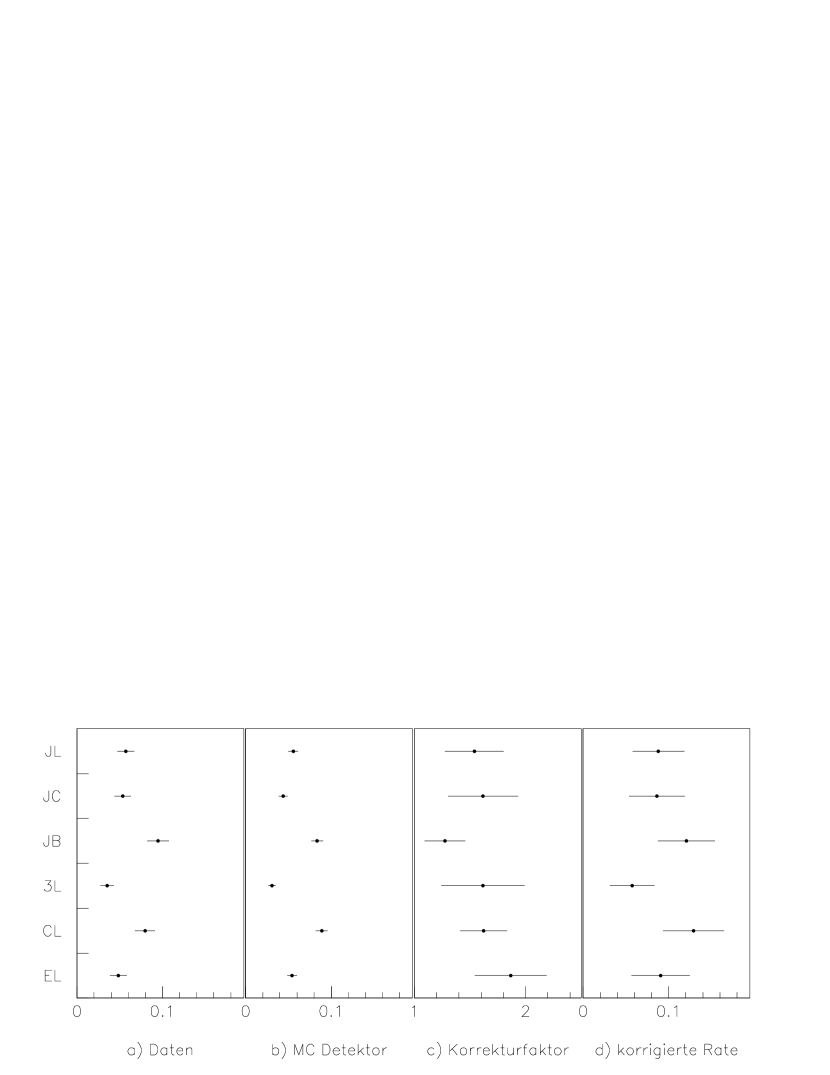
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Datenrate in % | ||||||||
| JL | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 4.7 | 5.5 | 5.7 |
| JC | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 3.2 | 4.2 | 5.3 |
| JB | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 7.0 | 9.5 |
| 3L | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 3.5 |
| CL | 17.0 | 14.8 | 9.2 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 5.7 | 8.0 |
| EL | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 4.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Monte-Carlo-Detektorrate in % | ||||||||
| JL | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 |
| JC | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 3.3 | 4.4 |
| JB | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 4.6 | 6.4 | 8.4 |
| 3L | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 3.1 |
| CL | 16.5 | 11.3 | 9.6 | 11.2 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 8.9 |
| EL | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 2.6 | 5.4 |
| Monte-Carlo-Partonrate in % | ||||||||
| JL | 2.9 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 7.4 | 7.5 | 8.6 |
| JC | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 4.9 | 6.1 | 7.1 |
| JB | 5.1 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 8.8 | 9.5 | 10.7 |
| 3L | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 3.5 | 4.3 | 5.0 |
| CL | 24.2 | 19.5 | 16.4 | 14.2 | 4.4 | 10.4 | 10.7 | 14.4 |
| EL | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 8.0 | 8.3 | 10.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Korrekturfaktor | ||||||||
| JL | 1.63 | 1.77 | 2.06 | 2.11 | 2.17 | 1.92 | 1.60 | 1.54 |
| JC | 1.94 | 1.70 | 1.63 | 1.71 | 2.06 | 1.88 | 1.85 | 1.62 |
| JB | 3.80 | 3.62 | 4.10 | 2.88 | 2.45 | 1.92 | 1.48 | 1.27 |
| 3L | 1.82 | 2.24 | 2.82 | 2.09 | 1.63 | 2.02 | 1.83 | 1.62 |
| CL | 1.47 | 1.73 | 1.70 | 1.27 | 1.02 | 2.13 | 2.19 | 1.62 |
| EL | 1.98 | 1.60 | 2.34 | 2.58 | 2.86 | 2.94 | 3.22 | 1.87 |
| korrigierte Rate in % | ||||||||
| JL | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 9.0 | 8.9 | 8.8 |
| JC | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 6.0 | 7.8 | 8.6 |
| JB | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 10.0 | 10.4 | 12.1 |
| 3L | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 4.3 | 5.3 | 5.7 |
| CL | 25.0 | 25.6 | 15.7 | 11.2 | 4.3 | 9.8 | 12.6 | 12.9 |
| EL | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 6.3 | 7.4 | 9.1 |
6.2 Ausblick
Zusammenfassend konnte deutlich gemacht werden, daß die Betrachtung von Jet–Parton–Korrelationen einem Problem in einem multi-dimensionalen Phasenraum entspricht. Es war nicht möglich einen Schnitt in einer einzelnen kinematischen Größe zu finden, der eine Beseitigung der Migrationen bewirkt, d.h. der eine Verkleinerung des Korrekturfaktors und gleichzeitig eine Verbesserung der Reinheit der 2+1 Jetereignisklasse erreicht. Immerhin konnte die Reduktion der Abhängigkeit von Rekombinationsschema, Jetalgorithmus und Bezugssystem durch Einführung eines Jetwinkelschnittes gezeigt werden.
Weitere Arbeit ist nötig um neue Verteilungen zu überprüfen. Zu den dringendsten Problemen gehören sicherlich die Erweiterung der Untersuchungen auf das Theorieniveau. Diese wird besonders interessant, wenn es gilt, verschiedene Programme zu vergleichen. Neben dem von uns benutzten Programm PROJET [Gra93] sind zur Zeit zwei weitere Programme in der Test- (MEPJET, [MZ95]) bzw. Entwicklungsphase. Diese neuen Programme werden eine höhere Flexibilität in Bezug auf die Auswahl des Jetalgorithmus haben.
Daneben sind jedoch auch neue Möglichkeiten entstanden durch den Austausch des rückwärtigen Kalorimeters BEMC durch das SPACAL [BW95], welches nun auch einen hadronischen Teil besitzt. Sobald die Energiekalibration dort verstanden ist, kann der obere Winkelschnitt vielleicht fallen gelassen oder zumindest verändert werden. Wie wir aber an der Jetwinkelverteilung in Abbildung 5.12 gesehen haben, sind dort nur wenige Jets von 2+1 Jetereignissen. Außerdem hat sich die Luminosität bei der Datennahme 1995 wieder erhöht, so daß wir mehr Ereignisse und damit geringere statistische Fehler erwarten dürfen.
Das immer besser werdende Verständnis von Monte-Carlo-Simulationen und die Untersuchung der Hadronisierungseffekte werden sicher auch weiterhin neue Aspekte zum Verständnis der Jet–Parton–Korrelation beitragen. Wünschenswert wäre jedoch ein Monte-Carlo-Ereignisgenerator, der auf den Partonschaueransatz zur Beschreibung der nächst-zu-führenden Ordnung Korrekturen verzichtet und sie statt dessen bereits in den Matrixelementen beinhaltet. Dem stehen jedoch nicht nur software-technische Probleme entgegen.
Die in Kapitel 4.3 erwähnte Messung der Gluondichte des Protons durch eine Jetanalyse stellt durch die zusätzliche Einteilung neue Anforderungen an das Verständnis der Jet–Parton–Korrelationen. Hier ist eine Untersuchung der Größen auf eine Abhängigkeit von Nöten.
Wie wir aus dieser sicher unvollständigen Aufzählung erkennen können, bleiben noch viele Fragen offen, die die Neugier des Physikers anregen.
Literatur
- [BB94] U. Bassler und G. Bernardi. On the kinematic reconstruction of deep inelastic scattering at HERA: the method. DESY, 94-231, Dezember 1994.
- [Ber92] Ch. Berger. Teilchenphysik. Springer ISBN 3-540-54218-3, 1992.
- [Bes93] M. Besançon. A proposal for the use of the clustering algorithm for jets in DIS. DAPNIA, Saclay, Frankreich, 93-336, 1993.
- [BM94] T. Brodkorb und E. Mirkes. DISJET manual, 1994. MAD/PH/821.
- [BW95] K. Borras und M. Weber. The H1 calorimetry: Performance and Upgrade Program. DESY, 95-067, April 1995.
- [CDB92] S. Catani, Yu.L. Dokshitzer, und B.R.Webber. The clustering algorithms for jets in deep inelastic scattering and hadron collisions. Physics Letters B, 285:291–299, 1992.
- [CDF95] CDF Collaboration. Observation of Top Quark Production in Collisions. Fermilab, 95/022-E, Februar 1995.
- [CSS93] K. Charchula, G. A. Schuler, und H. Spiesberger. Combined QED and QCD Radiative Effects in Deep Inelastic Lepton Proton Scattering the Monte Carlo Generator DJANGO6, 1993.
- [DZe95] DZero Collaboration. Observation of the Top Quark. Fermilab, 95/028-E, Februar 1995.
- [Eis95] F. Eisele. Deep Inelastic Scattering. In Invited Talk at the International Europhysics Conference On High Energy Physics, Brussels, 27 July - 2 August, 1995, 1995. Available on WWW http://dice2.desy.de/psfiles/proceedings/list.html.
- [GEA93] GEANT Team. Geant – detector description and simulation tool. CERN Program Library, W5053, 1993.
- [GHVB95] D. Graudenz, M. Hampel, A. Vogt, und Ch. Berger. The Mellin transform technique for the extraction of the gluon density. DESY, CERN, RWTH-Aachen, 95-107, Juni 1995. auch : CERN-TH/95-149.
- [GM91] D. Graudenz und M. Magnussen. Jet cross section in deeply inelastic scattering at HERA. In Physics at HERA, Proceedings of the workshop, Band 1, Seiten 261–273. DESY, Oktober 1991.
- [Gra93] D. Graudenz. PROJET jet cross sections in deeply inelastic electron proton scattering — version 3.6, 1993.
- [H1 93a] The H1 Calorimeter Group. The H1 Liquid Argon Calorimeter System. DESY, 93-078, Juni 1993.
- [H1 93b] H1 Collaboration. The H1 Detector at HERA. DESY, 93-103, Juli 1993.
- [H1 95a] H1 Collaboration. Guide to simulation program H1SIM, 1995. H1 Intern.
- [H1 95b] H1 Collaboration. H1PHAN - Funktionsbibliothek von H1, 1995. H1 Intern, Version 2.3.4.
- [H1 95c] H1 Collaboration. H1REC - Rekonstruktionsprogramm von H1, 1995. H1 Intern.
- [Ham93] M. Hampel. Monte-Carlo Untersuchungen zur tief inelastischen Elektronen-Streuung. Diplomarbeit, RWTH Aachen, Februar 1993.
- [HM84] F. Halzen und A. Martin. Quarks and leptons. John Wiley & Sons, ISBN 0-471-81187-4, 1984.
- [Hoe95] Ch. Hoeger. Extracting with Energy Distributions in the Breit Frame. In Talk at internal jet meeting on 3th March, 1995.
- [Ing92] G. Ingelmann. LEPTO — The Lund Monte Carlo for Deep Inelastic Lepton-Nucleon Scattering, 1992. Version 6.01.
- [Itt93] H. Itterbeck. Untersuchungen am Myonsystem des H1-Detektors. Diplomarbeit, RWTH Aachen, Februar 1993.
- [IZ85] C. Itzykson und J.-B. Zuber. Quantum field theory. McGraw-Hill ISBN 0-07-066353-X, 1985.
- [JAD86] JADE Collaboration. Experimental studies on multi–jet production in annihilation at PETRA energies. Z.Phys., C33:23f, 1986.
- [KM95] S. Kermiche und J. Marks. LAr electromagnetic energy scale studies using NC DIS (1+1) jet and QED Compton events for the 1994 H1 data. Centre de physique des particules de Marseille, Frankreich, 95-466, 1995.
- [Kö95] T. Köhler. Suche nach angeregten Leptonen mit dem H1-Detektor. Promotionsarbeit, RWTH Aachen, Februar 1995.
- [Lö94] Leif Lönnblad. ARIADNE — a program for simulation of QCD-cascades implementing the colour dipole model. CERN, 1994. Revision 5.
- [MKSW93] G. Marchesini, I.G. Knowles, M.H. Seymour, und B.R. Webber. HERWIG — a Monte Carlo event generator for simulating Hadron Emission Reactions With Interfering Gluons, 1993. Version 5.8, Computer Phys. Commun. 67 (1992) 465.
- [MZ95] E. Mirkes und D. Zeppenfeld. MEPJET 1.0 : A next-to-leading order event generator for jets, 1995. Preliminary Version.
- [Nac92] O. Nachtmann. Elementarteilchenphysik. Vieweg ISBN 3-528-08926-1, 1992.
- [Nis94a] R. Nisius. Jet Studies in Deep Inelastic ep Scattering at HERA. In QCD 94, Montpellier, France, July 1994, 1994. Available on WWW http://dice2.desy.de/psfiles/proceedings/list.html, published in Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 39B,C (1995) March 1995.
- [Nis94b] R. Nisius. Measurement of the strong coupling constant from jet rates in deep inelastic scattering. Promotionsarbeit, RWTH Aachen, Juni 1994. Available on WWW http://www.physik.rwth-aachen.de/group/IIIphys/H1/papers/nisius_dr.ps.Z.
- [Nis95a] R. Nisius. The alpha_s Measurement from Jet Rates in Deep Inelastic ep Scattering at HERA. In Talk at the XXXth Rencontre de Moriond, Les Arcs, France, March 1995, 1995. Available on WWW http://dice2.desy.de/psfiles/proceedings/list.html.
- [Nis95b] R. Nisius. Determination of the Strong Coupling Constant alpha_s in Deep Inelastic Scattering at HERA. In Talk at the International Europhysics Conference On High Energy Physics, Brussels, 27 July - 2 August, 1995, 1995. Available on WWW http://dice2.desy.de/psfiles/confpap/pap_list.html#EPS95.
- [Par94] Particle Data Group. Particle Physics Booklet. American Institut of Physics, Juli 1994. Auszug aus Review of Partice Properties, Physical Review, D50, 1173(1194).
- [PB95] H. Plothow-Besch. PDFLIB. CERN Program Library, W5051, 1995. Version 6/06/02.
- [Ros95] K. Rosenbauer. Suche nach Leptoquarks und Leptogluonen im H1-Experiment bei HERA. Promotionsarbeit, RWTH Aachen, Juli 1995.
- [Sey95] M. Seymour. Monte Carlo models and hadronization. In Folienkopien vom 4.-5.Oktober, 1995. Graduate School of Partice Physics, 25.September - 6.Oktober 1995, Cul-des-Sarts, Belgien.
- [ZEU95] ZEUS Collaboration. Measurement of from jet rates in deep inelastic scattering at HERA. DESY, 95-182, September 1995.
Danksagung
Am Ende dieser Arbeit möchte ich nun all denen danken, ohne die meine Diplomarbeit nicht möglich gewesen wäre.
Als Erstes bin ich Herrn Prof. Ch. Berger zu Dank verpflichtet. Nicht nur die interessante Themenstellung ist sein Verdienst, sondern auch die hervorragende Betreuung. Ebenso hat er mir durch Reisen zum DESY und zur graduate school of particle physics in Belgien ermöglicht, die Vielfalt der physikalischen Grundlagenforschung kennenzulernen.
Prof. G. Flügge danke ich für die Mühe bei der Erstellung des Zweitgutachtens.
Für die Einarbeitung in das Thema habe ich Dr. Richard Nisius zu danken. Er hat trotz der eigenen Arbeit immer wieder die Zeit gefunden, mir bei Problemen zu helfen und mich in die wissenschaftliche Arbeitsweise einzuführen. Außerdem hat er mir durch neue Ideen immer wieder die Möglichkeit gegeben an der aktuellen Analyse teil zu haben.
Der inzwischen recht groß gewordenen Aachener Jetgruppe, namentlich Martin Hampel, Christian Niedzballa, Klaus Rabbertz, Dr. Konrad Rosenbauer und Jürgen Scheins, danke ich für den engen Informationsaustausch und die gute Zusammenarbeit. Das freundliche Arbeitsklima, sowohl in Aachen als auch in Hamburg, ist sicherlich nicht selbstverständlich. Eingeschlossen sind hier auch diejenigen, die sich nicht direkt mit Jetanalysen beschäftigen, aber trotzdem immer ein offenes Ohr für Fragen und Probleme hatten. Erwähnt seien noch Dr. Torsten Köhler, Oliver Mang, Claus Keuker und Heiko Itterbeck, letzterer hat mich auf das faszinierende Arbeitsfeld des I. Physikalischen Instituts hingewiesen.
Sicher haben alle Mitarbeiter der H1 Kollaboration durch das Erstellen von Softwarepaketen, die Instandhaltung des Detektors und die Messung der Daten zu dieser Arbeit beigetragen.
Mein besonderer Dank gilt Martin Hampel, Patrick Kandel, Richard Nisius, Klaus Rabbertz und Konrad Rosenbauer, die das Manuskript durchgesehen haben und denen ich viele Tips und Anregungen verdanke.
Ein besonderer Dank gilt meinen Eltern, die mir mein Studium nicht nur finanziell ermöglicht haben, sondern mir auch immer wieder viel Verständnis entgegenbrachten.
Lebenslauf
- 24. Juni 1969
-
geboren in Grevenbroich als einziger Sohn der Näherin Marlies Hadig, geb. Roumen, und des Starkstromelektrikers Wolfgang Hadig.
- 1975 - 1979
-
Besuch der Gemeinschaftsgrundschule Hochneukirch in Otzenrath
- ab 1979
-
Besuch des Franz–Meyers–Gymnasium in Giesenkirchen/Mönchengladbach (früher Gymnasium i.E. Giesenkirchen (bis 1980), dann Franz-Meyers-Gymnasium i.E. (1980-1982)).
- 1988
-
Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife
- 1988-1989
-
Ableistung eines 15-monatigen Wehrdienstes bei der Bundeswehr
- Oktober 1989
-
Beginn des Studiums an der RWTH Aachen im Studiengang Physik
- Frühjahr 1992
-
Vordiplom in Physik
- Oktober 1990 - März 1993
-
Studentische Hilfskraft am Rogowski–Institut für Elektrotechnik. Beaufsichtigung von Computer-unterstütztem Unterricht und administrative Aufgaben auf Sun-Workstations.
- Juli 1993 - Juni 1994
-
Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Informatik I. Betreuung eines CIP-Pools mit UNIX-Workstation und PC-Rechnern.
- Juli 1994
-
Beginn der Mitarbeit in der H1 Kollaboration
- Februar 1995
-
Beginn der Diplomarbeit bei Prof. Dr. Berger am I. Physikalischen Institut der RWTH Aachen im Rahmen der H1 Kollaboration