Nico Tauchnitz
Steuerungsprobleme mit
freiem rechten Endpunkt
Die Herleitung des Pontrjaginschen Maximumprinzips
mit der Methode der einfachen Nadelvariation
Einfache Nadelvariation der
Optimalen Steuerung:
Marginale Zustandsvariation:
![[Uncaptioned image]](/html/2503.07134/assets/Nadelvariation31.jpg)
Einleitung
Diese Ausarbeitung behandelt notwendige Optimalitätsbedingungen für ein starkes lokales Optimum in
gewissen Klassen von Steuerungsproblemen mit freiem rechten Endpunkt.
Die Aufgaben mit freiem rechten Endpunkt setzen sich aus einem Optimierungskriterium in Form eines Zielfunktionals,
aus einer dynamischen Nebenbedingung in Form eines Systems von Differentialgleichungen mit Anfangsbedingungen
und aus Steuerbeschränkungen zusammen.
Dieser Standardtyp eines Steuerungsproblems lässt sich konstruktiv mit Hilfe einer einfachen Nadelvariation behandeln.
Im Zuge dieser Ausarbeitung wird dieser Zugang auf Steuerungsprobleme mit individuellen Charakteristiken erweitert.
Der Begriff eines starken lokalen Optimum ist der Klassischen Variationsrechnung,
aus der sich die Theorie der Optimalen Steuerungen entwickelte, entlehnt.
Wenn wir von einem Optimum sprechen,
so bezeichnet dies eine Lösung der Aufgabe,
die sich über einer Menge von Konkurrenten als die Bestmögliche behauptet.
Es ist somit die Untersuchungen auf einer möglichst großen Konkurrentenmenge anzustreben.
In diesem Zusammenhang kann man einer Optimalstelle eine Qualtitäts- bzw. Gütestufe zuweisen,
nämlich in Bezug auf den Umfang der Konkurrenten.
In der Klassischen Variationsrechnung haben sich die Begriffe eines schwachen bzw. starken lokalen Optimum etabliert.
Während bei einer schwachen lokalen Minimalstelle (“Stelle” bezeichnet hier eine gewisse Funktion)
sowohl die konkurriende Funktion und auch deren Ableitung sich wenig von einem Optimum und der Ableitung des Optimum zu unterscheiden haben,
so schränkt man bei einem starken lokalen Optimum lediglich die konkurrierende Funktion, aber nicht deren Ableitung ein.
Das bedeutet, die Konkurrentenmenge bei der Untersuchung auf starke lokale Optimalität ist umfassender als diejenige bei der
Behandlung von schwachen lokalen Optimalstellen.
Folglich besitzt ein starkes Optimum eine höhere Güte als ein schwaches
und die Herleitung von Optimalitätsbedingungen ist für ein starkes Optimum ist anzustreben.
Im Rahmen der Optimalen Steuerung sucht man nicht nur eine Lösungsfunktion,
sondern ein Funktionenpaar (den sogenannten Steuerungsprozess) aus Zustand(sfunktion) und Steuerung(sfunktion).
Von zentraler mathematischer und auch anwendungsbezogener Bedeutung ist die freie Wahl an Steuerungen,
denn in der Praxis ist man oft mit der Situation konfrontiert,
dass man sprichwörtlich “den Schalter umlegen” oder “das Steuer herumreißen” muss.
Ein solcher abrupter Wechsel wird gerade durch Abläufe mit sprunghaftem Änderungsverhalten widergegeben
und ist in den Anwendungen von besonderem Interesse.
Um dies in den Rahmen der Optimalen Steuerungen einzubinden, ergibt sich die Anforderung,
dass man konkurrierenden Steuerungsprozessen zwar Einschränkungen an den Zustand, aber nicht an die Steuerung auferlegt.
Die so gebildete Konkurrentenmenge führt (in Analogie zur Klassischen Variationsrechnung)
zur starken lokalen Optimalität im Rahmen der Theorie Optimaler Steuerungen.
Die notwendigen Optimalitätsbedingungen für ein starkes lokales Optimum in der Steuerungstheorie bilden einen Verbund, dessen Zusammenstellung man als Pontrjaginsches Maximumprinzip bezeichnet. Im Rahmen dieser Ausarbeitung wollen wir bei freiem rechten Endpunkt das Pontrjaginsche Maximumprinzip mit Hilfe der elementaren Beweismethode der einfachen Nadelvariation für
-
eine Standardaufgabe mit Wiedergewinnungswert,
-
optimale Multiprozesse,
-
einer Aufgabe mit unendlichem Zeithorizont,
-
zeitverzögerte Systeme,
-
die Steuerung Volterrascher Integralgleichungen
vorstellen.
Diese Methode haben wir für die Standardaufgabe bei Ioffe & Tichomirov [9]
entnommen und für die weiteren Klassen ausgebaut.
Wir haben uns entschieden,
die Methode der einfachen Nadelvariation in dieser Ausarbeitung ausführlich darzustellen,
denn der Nachweis der notwendigen Optimalitätsbedingungen für Aufgaben der Optimalen Steuerung mit freiem rechten Endpunkt mit Hilfe dieser Methode
fällt “vergleichsweise einfach” aus:
Die “Einfachheit” besteht in einem konstruktiven Nachweis des Pontrjaginschen Maximumprinzips.
Auf Basis der einfachen Nadelvariation lassen sich notwendige Optimalitätsbedingungen direkt ermitteln.
Die Herausforderungen des Beweises liegen in den mathematischen Instrumenten,
nämlich in Existenz-, Eindeutigkeits- und Abhängigkeitssätzen für Differential- und Integralgleichungen mit stückweise stetigen rechten Seiten.
Aufgrund des speziellen Rahmens werden die benötigten Resultate im Anhang ausführlich erarbeitet.
Dazu sind aber gewisse Grundbausteine der Funktionalanalysis,
z. B. der Begriff des Banachraumes, Fixpunktsätze und der Satz über implizite Funktionen, heranzuziehen.
Somit sind die nötigen Instrumente eher von “abstrakter” als von “einfacher” Natur.
Im “Vergleich” zu Steuerungsproblemen mit allgemeineren Nebenbedingungen ist bei der elementaren Beweismethode der Nachweis der
Gültigkeit des Lagrangeschen Prinzips in unendlich-dimensionalen Funktionenräumen nicht nötig.
Dadurch wird das Beweisverfahren deutlich abgekürzt,
da die Maß- und Integrationstheorie oder die Grundprinzipien der Funktionalanalysis und der Satz von Ljusternik oder
die Rieszschen Darstellungssätze oder die benötigten Elemente der Konvexen Analysis umgangen werden.
Anhand einer Vielzahl an Beispielen demonstrieren wir die erzielten Resultate.
Zu unseren wichtigsten Quellen zählen dabei die Lehrbücher von Feichtinger & Hartl [4],
Kamien & Schwartz [10] und Seierstad & Sydsæter [16].
Diese Lehrbücher sind nicht auf die Aufgaben mit freiem rechten Endpunkt beschränkt und
zum weiteren Studium der Theorie Optimaler Steuerungen wärmstens empfohlen.
Außerdem möchten wir den interessierten Leser auf die Arbeiten Pesch & Plail [12] und Plail [13] zur historischen Entwicklung
der Optimalen Steuerung zu einem eigenständigen mathematischen Fachgebiet hinweisen.
Wichtige Bezeichungen
Die Methode der einfachen Nadelvariation erlaubt es uns die Aufgaben in dem Rahmen der Räume von
stückweise stetigen und stückweise stetig differenzierbaren Funktionen zu betrachten.
Diese Funktionenklassen kennzeichnen wir mit
–
Raum der stückweise stetigen Funktionen,
–
Raum der stückweise stetig differenzierbaren Funktionen.
Für das Skalarprodukt der Funktionswerte von schreiben wir .
Der gewählte Rahmen dieser Ausarbeitung gestattet die auftretenden Differentationen und Integrationen im klassischen Sinn aufzufassen.
Weiterhin bezeichnen die Zeitableitung und das (für uneigentliche) Riemann-Integral.
Der Aufbau der Steuerungsprobleme, die wir behandeln werden,
stimmen grundsätzlich im Auftreten von Zielfunktional, Dynamik und Steuerungsbeschränkungen überein.
Deswegen verwenden wir meistens die Bezeichnungen
–
für das Zielfunktional,
–
für den Integranden im Zielfunktional,
–
für den Wiedergewinnungswert,
–
für die rechte Seite des dynamischen Systems,
–
für den Steuerbereich,
–
für den Zustand,
–
für die Steuerung.
Im Rahmen unserer Untersuchungen treten einseitige Grenzwert wiederholt auf. Für den links- bzw. rechtseitigen Grenzwert einer Abbildung an der Stelle schreiben wir
Die verschiedenen Aufgabentypen besitzen ihre eigenen Charakteristiken und erfordern teils individuelle Voraussetzungen.
Deswegen werden die Pontrjagin-Funktion und die Hamilton-Funktion , sowie die Annahmen an die Aufgabenklasse,
wie z. B. die Menge der zulässigen Steuerungsprozesse ,
durch einen zur Aufgabe gehörenden Index versehen:
tandardaufgabe
–
, ,
, ,
ultiprozesse
–
, ,
, ,
nendlicher Zeithorizont
–
, ,
, ,
,
eitverzögerte Systeme
–
, ,
, ,
ntegralgleichungen
–
, ,
, .
Stückweise Stetigkeit und Differenzierbarkeit
Die vorliegende Untersuchung von Steuerungsproblemen mit freiem rechten Endpunkt betten wir in den Rahmen stückweise stetiger und stückweise stetig differenzierbarer Funktionen ein. Der Begriff “stückweise” bezieht sich dabei auf das Vorhandensein von höchstens endlich vielen Unstetigkeiten in Form von Sprungstellen. Wir räumen diesen – für diese Ausarbeitung zentralen – Begriffen eigenständige Definitionen ein:
Definition 0.1 (Stückweise Stetigkeit).
Die Funktion heißt stückweise stetig, wenn sie in endlich vielen Stellen Sprünge besitzt, d. h. in diesen Stellen existieren beide einseitigen Grenzwerte von im eigentlichen Sinn. In den Stellen wählen die Werte der Funktion so, dass rechtsseitig stetig ist.
Definition 0.2 (Stückweise stetige Differenzierbarkeit).
Die Funktion heißt stückweise stetig differenzierbar, wenn sie auf stetig und in den endlich vielen Teilintervallen stetig differenzierbar ist, sowie ihre Ableitung eine stückweise stetige und in den Stellen rechtsseitig stetige Funktion über ist.
Unter den wichtigen Bezeichnungen haben wir die Funktionenräume
–
Raum der stückweise stetigen Funktionen,
–
Raum der stückweise stetig differenzierbaren Funktionen
über bereits aufgeführt.
In der Aufgabe mit unendlichem Zeithorizont wird das Intervall durch ersetzt.
Es ergeben sich die Funktionenräume
–
Raum der stückweise stetigen Funktionen,
–
Raum der stückweise stetig differenzierbaren Funktionen
über . In dem Fall des unbeschränkten Intervalls definieren wir:
Definition 0.3 (Stückweise Stetigkeit).
Die Funktion heißt stückweise stetig, wenn sie über beschränkt und über jedem endlichen Intervall stückweise stetig ist.
Definition 0.4 (Stückweise stetige Differenzierbarkeit).
Die Funktion heißt stückweise stetig differenzierbar, wenn sie über beschränkt und über jedem endlichen Intervall stückweise stetig differenzierbar ist.
1 Eine Standardaufgabe mit Wiedergewinnungswert
gIn diesem Abschnitt behandeln wir eine “einfache” Aufgabe der Optimalen Steuerung. Darin besteht das Optimierungskriterium aus einem Zielfunktional in Integralform und einem zusätzlichen Terminalfunktional im Endpunkt des Zustandes. Das Terminalfunktional bezeichnet in ökonomischen Anwendungen häufig einen Schrotterlös (“scrap value”) oder den Wert von wiederverwendbaren Materialien oder Teilen (“salvage value”) einer nicht weiter nutzbaren Maschine am Ende des Planungszeitraumes. Weiterhin liegt bezüglich dem Zustand “lediglich” eine Nebenbedingung in Form einer Differentialgleichung vorliegt. Diese nennen wir die Dynamik. Ferner weist die Aufgabenstellung Steuerbeschränkungen auf. Da keine weiteren Einschränkungen, insbesondere im Endzeitpunkt an den Zustand, vorliegen, ist die Methode der einfachen Nadelvariation zur Herleitung von notwendigen Optimalitätsbedingungen für ein starkes lokales Minimum dieser Aufgabe gut geeignet. Die vorliegende Herangehensweise ist Ioffe & Tichomirov [9] entnommen. Aber im Gegensatz zu [9] beschränken wir uns auf den sogenannten “normalen” Fall notwendiger Bedingungen, welcher in Aufgaben mit freiem Endpunkt vorliegt.
1.1 Die Aufgabenstellung und das Pontrjaginsche Maximumprinzip
Über dem gegebenen Intervall betrachten wir zu die Aufgabe
| (1.1) | |||
| (1.2) | |||
| (1.3) |
Die Aufgabe (1.1)–(1.3) untersuchen wir bezüglich dem Zustand
und der Steuerung .
Das Paar nennen wir einen Steuerungsprozess.
Mit bezeichnen wir die Menge aller Paare ,
für die es ein derart gibt,
dass die Abbildungen , auf der Menge aller mit
stetig in der Gesamtheit aller Variablen und stetig differenzierbar bezüglich sind.
Das Paar
heißt ein zulässiger Steuerungsprozess in der Aufgabe (1.1)–(1.3),
falls der Dynamik (1.2) zu genügt.
Mit bezeichnen wir die Menge der zulässigen Steuerungsprozesse.
Bemerkung 1.1.
Die Reduktion auf einen Umgebungsstreifen um eine Trajektrie ist angebracht, wenn die Abbildungen nicht willkürliche Werte für den Zustand annehmen dürfen. Dies ist im Beispiel 1.5 erforderlich, in dem die Abbildung mit nur für wohldefiniert und die Ableitung nur für mit einem gegebenen beschränkt sind.
Ein zulässiger Steuerungsprozess ist eine starke lokale Minimalstelle der Aufgabe (1.1)–(1.3), falls eine Zahl derart existiert, dass die Ungleichung
für alle mit gilt.
Es bezeichnet die Pontrjagin-Funktion
| (1.4) |
Theorem 1.2 (Pontrjaginsches Maximumprinzip).
Bemerkung 1.3.
Die nachstehenden Investitionsmodelle sind Seierstad & Sydsæter [16] entnommen:
Beispiel 1.4.
Es bezeichne das Kapital und die Investitions- bzw. die Konsumptionsrate zum Zeitpunkt . Wir betrachten das lineare Investitionsmodell
| (1.8) | |||
| (1.9) | |||
| (1.10) |
Um zu einem Minimierungsproblem überzugehen, multiplizieren wir den Integranden in (1.8) mit . Wir erhalten damit in der Aufgabe (1.8)–(1.10) die Abbildungen
Dann gilt für die Pontrjaginsche Funktion (1.4) für nach (1.7)
| (1.11) |
und ist die Lösung der adjungierten Gleichung zur Transversalitätsbedingung in (1.5):
| (1.12) |
Aus der Maximumbedingung (1.11) können wir unmittelbar
entnehmen. Für die adjungierte Gleichung (1.12) folgt damit sofort
Die Stelle mit ist wegen und eindeutig bestimmt.
Aus formalen Gründen betrachten wir zur Bestimmung von die Funktion mit
Also gibt es genau eine Lösung der Gleichung und es gilt
| (1.13) |
Da die adjungierte Funktion streng monoton fallend ist, folgt für diese
| (1.14) |
Mit der Steuerung
| (1.15) |
erhalten wir aus (1.9) für das Kapital
| (1.16) |
und für den Wert des Zielfunktionals (1.8)
| (1.17) |
In diesem Beispiel ist die optimale Steuerung unstetig und nimmt ausschließlich Werte auf dem Rand des kompakten Steuerbereiches an.
Beispiel 1.5.
Im Gegensatz zum vorherigen linearen Modell nehmen wir an, dass wir mit einer einprozentigen Erhöhung des Kapitals eine konstante prozentuale Erhöhung des Nutzens um erreichen:
Damit erhalten wir folgende Aufgabe mit der Cobb-Douglas-Funktion :
| (1.18) | |||
| (1.19) | |||
| (1.20) |
Wir multiplizieren den Integranden in (1.18) mit und erhalten
Dann gilt für die Pontrjaginsche Funktion (1.4) nach (1.7) für
| (1.21) |
und ist die Lösung der adjungierten Gleichung zur Transversalitätsbedingung (1.5):
| (1.22) |
Aus der Maximumbedingung (1.21) ergibt sich unmittelbar
Für die adjungierte Gleichung (1.22) folgt weiterhin
Die Adjungierte ist stetig und streng monoton fallend über mit .
Wir zeigen nun die Existenz einer Zahl mit .
Es sei mit
Für gilt und es ist auf konstant. Es bezeichne diesen konstanten Wert. Anstelle der Adjungieren betrachten wir mit Hilfe der Konstanten zunächst die Funktion mit
Es ergibt sich . Nun bestimmen wir . Für ist und damit . In der Dynamik (1.19) sei . Es ergibt sich die Funktion mit , und . Wir erhalten nach Trennung der Veränderlichen und anschließender Integration
Aus und ergibt sich für die Gleichung
Aus dieser Gleichung folgt zusammen mit der Annahme in (1.20)
| (1.23) |
Für die Analyse der Aufgabe liefert dies die Steuerung
| (1.24) |
Mit erhalten wir in (1.19) für die Änderung des Kapitalstocks
Wenden wir über wieder die Trennung der Veränderlichen wie für die Funktion an, so ergibt sich für die zeitliche Entwicklung des optimalen Kapitalstocks
| (1.25) |
Ferner liefert dies in der adjungierten Gleichung
Zur Berechnung von auf verwenden wir und erhalten wieder mit einer Trennung der Veränderlichen und anschließender Integration
Daraus folgt
auf . Auf gilt damit für die adjungierte Funktion
| (1.26) |
Für den Wert des Zielfunktionals (1.18) ergibt sich in diesem Beispiel
| (1.27) | |||||
Die Auswertung des Pontrjaginschen Maximumprinzip ist damit abgeschlossen.
Beispiel 1.6.
Wir betrachten nach Seierstad & Sydsæter [16] ein Zwei-Sektoren-Modell, das aus der Produktion von Investitons- und Konsumgüter besteht. Wir bezeichnen mit bzw. die Rate der Güterproduktion im Investitions- bzw. Konsumsektor und es beschreibe die Aufteilung der Investitionsgüter auf beide Sektoren zur Produktion. Es entsteht damit die Aufgabe
| (1.28) |
Wir gehen zu einem Minimierungsproblem über und wenden Theorem 1.2 an.
Die Pontrjagin-Funktion besitzt die Gestalt
Für die Adjungierten und ergeben sich die Gleichungen
Es folgt unmittelbar . Die Maximumbedingung ist äquivalent zu
und wir erhalten für die optimale Steuerung
Wegen und ist über einem gewissen Intervall .
Demzufolge gilt und über .
Zur Bestimmung des Zeitpunktes mit nutzen wir wieder eine Nebenrechnung.
Dazu betrachten wir die Funktion mit und .
Es ergeben sich
Die Adjungierten , sind streng monoton fallen und es gilt . Es sind damit für und über . Wir erhalten zusammenfassend für die adjungierten Funktionen
für die optimale Steuerung
für die zugehörigen Zustandstrajektorien
und für den Wert des Zielfunktionals
Unsere Untersuchung der Aufgabe ist abgeschlossen.
1.2 Der Beweis des Maximumprinzips
Der nachstehende Beweis ist [9] entnommen.
Wir haben lediglich die Transversalitätsbedingung (1.5) bezüglich dem Terminalfunktional hinzugefügt.
Da sämtliche Abbildungen stetig und stetig differenzierbar bezüglich sind, und die Funktion dem Raum angehört,
sind die Abbildungen und über lediglich stückweise stetig und nicht stetig.
Deswegen verweisen wir auf die Ergebnisse im Anhang B über Differentialgleichungen mit stückweise stetigen rechten Seiten.
Ferner erfüllt die adjungierte Gleichung (1.5) die Voraussetzungen von Lemma B.4 und Lemma B.6.
Daher gibt es eine eindeutige Lösung der Gleichung (1.5) zur Randbedingung ,
die dem Raum angehört.
Die behauptete Existenz einer Lösung der adjungierten Gleichung (1.5)
zur Transversalitätsbedingung (1.6) ist damit bereits gezeigt.
Es sei ein Stetigkeitspunkt der Steuerung .
Dann ist auch in einer gewissen hinreichend kleinen Umgebung von stetig und wir wählen ein festes
positiv und hinreichend klein, so dass sich in dieser Umgebung befindet.
Weiter sei nun ein beliebiger Punkt aus .
Wir setzen
und es bezeichne , , die eindeutige Lösung der Gleichung
![[Uncaptioned image]](/html/2503.07134/assets/Nadelvariation31.jpg) \captionof
figure[Einfache Nadelvariation der Steuerungstheorie]Variation .
\captionof
figure[Einfache Nadelvariation der Steuerungstheorie]Variation .
Dann ist für .
Für betrachten wir den Grenzwert
und werden zeigen, dass dieser existiert, die Funktion der Integralgleichung
| (1.31) |
zur Anfangsbedingung
| (1.32) |
genügt und die Beziehung
| (1.33) |
erfüllt ist.
Herleitung von (1.32): Nach Wahl des Punktes ist in einer Umgebung dieses Punktes stetig und für hinreichend kleine positive gelten
Hieraus folgt
D. h., dass der Grenzwert
existiert und gleich (1.32) ist.
Herleitung von (1.31):
Auf dem Intervall genügen sowohl als auch der Gleichung
Aus den Sätzen B.11 und B.13 über die Stetigkeit und Differenzierbarkeit der Lösung eines Differentialgleichungssystems in Abhängigkeit von den Anfangsdaten folgt, dass für hinreichend kleine positive die Vektorfunktionen auf definiert sind, dass sie für gleichmäßig gegen konvergieren und dass der Grenzwert
für jedes existiert. Weiterhin liefert Satz B.13, dass für alle der Gleichung
genügt, d. h. die Gleichung (1.31) zum Anfangswert (1.32) erfüllt.
Herleitung von (1.33):
Mit (1.5) und (1.31) erhalten wir für :
Daher gilt für die Gleichung
Für folgt (1.33) mit der Transversalitätsbedingung :
Beweisschluss: Da ein starkes lokales Minimum ist, ist für alle hinreichend kleine und positive
In diesem Ausdruck ergeben sich für
und für das Terminalfunktional
Für das Zielfunktional liefert der Grenzübergang dies den Ausdruck.
Nach (1.33) besteht in dieser Ungleichung der Zusammenhang
Bei Anwendung der Gleichungen (1.32) und (1.33) ergibt sich weiter
Damit folgt aus der Definition der Pontrjagin-Funktion:
Nun ist ein beliebiger Stetigkeitspunkt von und ein beliebiger Punkt der Menge . Demzufolge ist die Beziehung (1.7) in allen Stetigkeitspunkten von wahr und damit ist das Maximumprinzip bewiesen.
1.3 Ökonomische Deutung des Maximumprinzips
Die ökonomische Interpretation des Pontrjaginschen Maximumprinzips
wurde von Dorfman [3] angeregt.
Wir geben eine Variante an,
die sich auf den Beweis von Theorem 1.2 im letzten Abschnitt bezieht.
Der Kern des Beweises im letzten Abschnitt war,
die Auswirkungen der Nadelvariation
auf das Steuerungsproblem (1.1)–(1.3) zu untersuchen. Die erzeugte marginale Änderung
des optimalen Zustandes bewirkt nach (1.33) im Zielfunktional
| (1.34) |
wobei die Lösung der adjungierten Gleichung (1.5) ist. Außerdem gilt für den marginalen Profit die Beziehung
| (1.35) | |||||
Die Entscheidung zum Zeitpunkt mit dem Parameter statt zu steuern hat einen direkten und indirekten Effekt (Feichtinger & Hartl [4], S. 29):
-
–
Der unmittelbare Effekt besteht darin, dass die Profitrate erzielt wird.
-
–
Die indirekte Wirkung manifestiert sich in der Änderung der Kapitalbestände um . Der Kapitalstock wird durch die in getroffene Entscheidung transformiert, was bemessen mit der Adjungierten in (1.34) ausgedrückt wird.
Die Gleichung (1.34) beschreibt damit die Opportunitätskosten,
die sich durch die Entscheidung zum Zeitpunkt ergeben.
Wegen der Darstellung der Opportunitätskosten in der Form in (1.34),
wird die Adjungierte in der Ökonomie häufig als Schattenpreis bezeichnet.
Ferner bemisst die Funktion nach Gleichung (1.35) die Profitrate aus
direktem und indirektem Gewinn,
die sich aus der Änderung der Kapitalbestände ergibt.
Die Maximumbedingung sagt daher aus,
dass die Instrumente zu jedem Zeitpunkt so eingesetzt werden sollen,
dass die totale Profitrate maximal wird.
1.4 Hinreichende Bedingungen nach Arrow
Im Gegensatz zu notwendigen Bedingungen,
die Kandidaten für Optimalstellen liefern,
geben hinreichende Bedingungen Gewissheit über das Vorliegen eines Optimums.
Deswegen erweitern wir die notwendigen Optimalitätsbedingungen in Form des Pontrjaginschen Maximumprinzips
um die hinreichenden Bedingungen nach Arrow.
Unser
Vorgehen zur Herleitung der hinreichenden Bedingungen basiert auf der Darstellung in
Seierstad & Sydsæter [16],
die wir in der Beweisführung um Argumente in Aseev & Kryazhimskii [1] ergänzt haben.
Für führen wir die Menge ein.
Außerdem bezeichnet die Hamilton-Funktion
| (1.36) |
Theorem 1.7.
Beweis Es sei gegeben. Da die Abbildung auf konvex ist, ist die Menge konvex und besitzt ein nichtleeres Inneres. Wir setzen . Dann ist mit ein Randpunkt der Menge . Daher existiert nach dem Trennungssatz C.2 ein nichttrivialer Vektor mit
| (1.37) |
Es ist ein innerer Punkt der Menge .
Weiterhin folgt aus den elementaren Eigenschaften konvexer Funktionen,
dass in stetig ist,
da sie auf konvex und nach oben durch beschränkt ist.
Deswegen existiert ein mit und
für alle .
Aus (1.37) folgt daher für alle .
Dies zeigt und wir können ohne Einschränkung annehmen.
Wiederum (1.37) liefert damit
| (1.38) |
Es sei nun so gewählt, dass die Maximumbedingung (1.7) zu diesem Zeitpunkt erfüllt ist. Dann folgt aus (1.38), dass
für alle gilt. Wir setzen
Die Funktion ist stetig differenzierbar auf . Ferner gelten für alle und . Damit nimmt die Funktion in dem inneren Punkt der Menge ihr globales Maximum an. Also gilt , d. h.
| (1.39) |
Die Gleichung (1.39) wurde unter der Annahme erzielt, dass die Maximumbedingung (1.7) in dem Zeitpunkt erfüllt ist. Da (1.7) für fast alle gilt, stimmt mit der Ableitung überein. Also gilt auf die Ungleichung
| (1.40) |
für fast alle . Die Abbildung ist nach Voraussetzung (c) von Theorem 1.7 über . Deswegen gilt für alle die Ungleichung
| (1.41) |
Es sei mit . Dann erhalten wir
Wegen (1.6) ist erfüllt. Ferner betrachten wir Aufgaben mit festem Anfangswert, d. h. . Also gilt für alle mit .
Beispiel 1.8.
Im Beispiel 1.4 des linearen Investitionsmodells lautet die Pontrjagin-Funktion
Ferner ergab sich nach (1.14) die adjungierte Funktion
Dies führt auf die Hamilton-Funktion
die für alle konkav in der Variablen ist. Damit liefert der Steuerungsprozess , der in (1.15) und (1.16) angegeben ist, ein starkes lokales Maximum.
Beispiel 1.9.
In dem Beispiel 1.6 eines Zwei-Sektoren-Modells besitzt die Pontrjagin-Funktion die Gestalt
Ferner lieferte die Analyse der Aufgabe die Adjungierten
Daraus resultiert
Damit erhalten wir die Hamilton-Funktion
Für jedes ist linear in , also eine konkave Funktion in . Damit ist der im Beispiel 1.6 ermittelte Kandidat , der alle Bedingungen des Maximumprinzips erfüllt, ein starkes lokales Maximum.
1.5 Instandhaltungsmanagement
Vorbeugende Instandhaltung wirkt sich positiv auf Lebensdauer und Funktionalität von Produktionsanlagen aus,
woraus sich außerdem Einsparungen beim Ersatz von Anlagen ergeben.
Die Aufgabe besteht hier in der Ermittlung eines optimierten Zusammenspiels von Instandhaltungsintensität im Laufe der
Produktionsdauer und dem Verkaufswert bzw. dem Schrotterlös der Anlage am Ende der Produktionsdauer.
Das nachstehende Modell wurde durch die Betrachtungen in Feichtinger [4] angeregt.
Es sei der Zustand einer Maschine,
die im Produktionseinsatz den Erlös pro Zeiteinheit einbringt.
Der Einsatz der Maschine führt zum Verschleiß mit der Rate ,
welchem durch instandhaltende Maßnahmen entgegengewirkt werden kann.
Die Kosten für die Instandhaltung wird durch angegeben und die Effizienz der Maßnahmen durch .
Zusammenfassend bezeichnen:
| – | den Zustand der Maschine zur Zeit , | |
| – | den Erlös der Maschine pro Zeiteinheit aus dem Betrieb der Maschine, | |
| – | den Verschleiß der Maschine bei Produktion, | |
| – | den Wiederverkaufswert am Ende der Planungsperiode, | |
| – | die Instandshaltungskosten, | |
| – | die Effizienz der Instandhaltung zur Rate . |
Der zu erwartende Nettoerlös aus dem Betrieb der Maschine, den anfallenden Instandhaltungskosten und dem Barwert des Verkaufes berechnet sich gemäß
Die instandhaltenden Maßnahmen seien mit wachsendem Kostenaufwand weniger effizient. Daher besitze die Funktion die Eigenschaften:
Diese Eigenschaften spiegelt zum Beispiel die Funktion mit wider.
Über dem Planungszeitraum werden außerdem die instandhaltenden Maßnahmen durch den betrieblichen Verschleiß und durch wiederkehrende Reparaturen weniger effektiv.
Wir machen für diese Beobachtung den Ansatz .
Zusammenfassend ergibt sich für unser Instandhaltungsmodell die Aufgabe
| (1.44) |
Wir wenden Theorem 1.2 an: Die Pontrjagin-Funktion der Aufgabe (1.44) hat die Form
Sie ist linear in , womit die Hamilton-Funktion konkav ist. Daher sind die Bedingungen des Maximumprinzips hinreichend für ein starkes lokales Maximum. Die Maximumbedingung (1.7) lautet
Aufgrund der Eigenschaften der Funktion können nur positive Instandhaltungskosten optimal sein. Deswegen führt die Maximumbedingung nach Ausschluss der Randlösung auf die Gleichung
Wir beachten den Vorzeichenwechsel beim Übergang zu einem Minimierungsproblem in der Transversalitätsbedingung. Dann lautet die adjungierte Gleichung (1.5)
Für die adjungierte Funktion erhalten wir die Abbildung
Den Ausdruck in der letzten Klammer formen wir um und erhalten
für .
Daher nimmt die Adjungierte nur positive Werte über an und
die optimale Strategie ist durch sinnvoll festgelegt.
In ergibt sich für die Adjungierte der Wert
Im Sinne des Schattenpreises bemisst zu Beginn den gesamten Erlös unter Beachtung von Diskontierung und Verschleiß,
und nimmt am Ende des Planungszeitraumes den Barwert des Verkaufspreises an.
1.6 Optimale Werbestrategien
Es bezeichne den Bekanntheitsgrad eines Produktes, der auf skaliert sei. Den Umsatz, den das Produkt zum Zeitpunkt erbringt, sei . Der Einsatz von Werbung wird durch die Steuerung widergegeben. Es ergibt sich in Anlehnung an Feichtinger & Hartl [4] (vgl. Abschnitt 5.6) das Modell
| (1.45) | |||
| (1.46) | |||
| (1.47) |
Dabei sei stetig differenzierbar und konkav mit und für .
Die Auswirkungen der Werbestrategie auf den Bekanntheitsgrad wird durch (1.46) festgelegt.
Dabei sei über stetig, differenzierbar und streng monoton wachsend mit
Für genügen die Funktionen
diesen Bedingungen.
Im Fall bekommt die Differentialgleichung (1.46) die Gestalt
die die Form eines Ebbinghausenschen Vergessensmodell trägt.
Hermann Ebbinghausen (1850–1909) gilt als Begründer der experimentellen Gedächtnisforschung.
Der Fall überführt (1.46) in die Gestalt
zum Anfangswert und besitzt die Lösung
| (1.48) |
Die Popularität ergibt sich anhand Gleichung (1.48) durch das Zusammenspiel der Parameter und . Dabei spiegelt der Parameter einem der Natur der Sache innewohnenden Attraktivitätsverlust für das Produkt wider, während eine Faszination, d. h. einen eigendynamischen Erhalt der Popularität für das Produkt innerhalb der Interessengruppe, beschreibt. Speziell ergeben sich für und es liegt kein Attraktivitätsverlust für das Produkt vor. Im Fall stellt sich der Popularitätsverlust zum Parameter ein. Ferner liegt für eine unbegrenzte Faszination für das Produkt vor und es ist unabhängig vom Paramter .
In der Aufgabe (1.45)–(1.47) ohne Wiedergewinnungswert liefert das Pontrjaginsche Maximumprinzip in Form von Theorem 1.2 die adjungierte Gleichung
| (1.49) |
welche die Lösung
| (1.50) |
besitzt. Die Maximumbedingung führt nun weiter zur der Beziehung
| (1.51) |
aus der die Gültigkeit der Gleichung bzw.
| (1.52) |
resultiert.
Die Funktion ist über positiv und streng monton wachsend.
Im Grenzwert ergibt sich .
Aus den Eigenschaften von folgt,
dass über stetig, streng monoton fallend mit und ist.
In dem Modell (1.45)–(1.47) ist es nun vernünftig anzunehmen,
dass zum Abschluss der Werbekampagne für das Produkt ein weiterer Absatz mit Gesamtumsatz in
Abhängigkeit vom Bekanntheitsgrad erwartet werden darf.
Das Pontrjaginsche Maximumprinzip für die Aufgabe führt wieder
auf die adjungierte Gleichung (1.49), jedoch zur Transversalitätsbedingung :
| (1.53) |
Da eine Maximierungsaufgabe vorliegt, tritt in der Transversalitätsbedingung ein Vorzeichenwechsel ein. Es ergibt sich daraus die Adjungierte
| (1.54) |
Die Maximumbedingung führt erneut auf die Beziehung , d. h.
Die Werbestrategie ist erneut stetig, aber am Ende der Planungsperiode gilt
Da die Variable linear in den Integranden und in die Dynamik einfließt, und ferner die Abbildung konkav in ist, sind die Optimalitätsbedingungen des Maximumprinzips nach Theorem 1.7 hinreichend für ein starkes lokales Maximum.
1.7 Kapitalismusspiel
In vielen Problemstellungen sind verschiedene Entscheidungsträger involviert,
deren Interessen nicht im Einklang stehen müssen.
Eine derartige Situation bezeichnet man als mathematisches Spiel.
Unterliegen die Zielkriterien der Konfliktgruppen dynamischen Nebenbedingungen,
so spricht man von einem Differentialspiel.
Es liege ein dynamisches Spiel vor,
in dem die Steuerungen und die Einflussnahmen durch den ersten bzw. zweiten Spieler widergeben.
Durch die Einführung verschiedener Zielfunktionale in der Standardaufgabe,
welche die Zielstellungen der einzelnen Spieler darstellen,
gelangen zur dynamischen Spielsituation:
Ein Lösungskonzept zur Behandlung eines solchen Spiels ist das Nash-Gleichgewicht für nichtkooperative Spiele. In unserem Differentialspiel ist ein Nash-Gleichgewicht ein Tripel mit
Befindet sich das Spiel also im Nash-Gleichgewicht ,
so hat kein Spieler einen Anreiz seine Strategie zu ändern,
denn das bestmögliche Ergebnis zur Strategie des Konkurrenten wurde gefunden.
Ausführlich geschrieben ist das Nash-Gleichgewicht ein System von zwei gekoppelten Steuerungsproblemen.
Für den ersten Spieler ergibt sich das Steuerungsproblem
bei gegebener Strategie des zweiten Spielers; entsprechend für den zweiten Spieler:
Formal sind die Abbildungen , und
, nicht stetig bezüglich der Variablen
und verletzen die Anforderungen an die Standardaufgabe (1.1)–(1.3).
Sind die Steuerungen und zumindest stückweise stetig,
so besitzen diese Abbildungen für die gegebene Strategie des Gegenspielers höchstens endlich viele Unstetigkeiten in der Variablen .
Bei der Setzung der einfachen Nadelvariation im Beweis des Maximumprinzips sind für die Wahl von diese Stellen auszuschließen.
Auf diese Weise bleiben das Beweisschema und die Optimalitätsbedingungen in Form des Pontrjaginschen Maximumprinzips gültig.
Wir betrachten im Folgenden ein Differentialspiel zwischen Arbeitern und Unternehmern.
Beide Parteien sind bestrebt ihr Konsumverlangen zu befriedigen.
Zudem zeichnen sich die Unternehmer für Investitionen verantwortlich.
Für die Arbeiter stellt sich dabei das Problem,
inwieweit sie den produzierten Ertrag konsumieren oder den Unternehmern überlassen sollen,
damit eine künftige hohe Güterproduktion ermöglicht wird, von der auch die Arbeiter wieder profitieren.
Das Dilemma, das sich dem Arbeiter stellt, ist,
dass sie keine Garantien über ausreichende Neuinvestitionen seitens der Unternehmer haben.
Die Unternehmer stehen ihrerseits vor der Frage,
wie sie mit dem verbliebenen Teil des Ertrages, der nicht dem Arbeiter zugesprochen wird, umgehen:
Sollen sie diesen investieren oder konsumieren?
Die Spielsituation ensteht dadurch,
dass der Nutzen für den Arbeiter und den Unternehmern durch den aufgeteilten Ertrag miteinander gekoppelt ist.
D. h. der Gewinn eines jeden Spielers hängt von der Entscheidung des anderen Spielers ab.
In diesem Modell werden die Geld- und Güterwerte im Kapitalstock zusammengefasst.
Weiter bezeichne denjenigen relativen Anteil an der Produktion, der dem Arbeiter zum Zeitpunkt zugesprochen wird.
Von dem verbliebenen Teil kann der Unternehmer mit der Rate zur Zeit investieren.
Mit den Zielfunktionalen bzw. für den Arbeiter bzw. Unternehmer entsteht damit die folgende Aufgabe
| (1.55) | |||
| (1.56) | |||
| (1.57) | |||
| (1.58) |
Das Modell geht auf Lancaster [11] zurück. Wir folgen der Darstellung und untersuchen das Nash-Gleichgewicht und die Kollusionslösung, die wir abschließend miteinander vergleichen. Wir verweisen außerdem auf die umfassenden Ausführungen in Feichtinger & Hartl [4] und Seierstad & Sydsæter [16].
Wir platzieren die zwei Spieler Arbeiter und Unternehmer in einer Spielsituation und benutzen als Lösungskonzept das Nash-Gleichgewicht für nichtkooperative Spiele. Im vorliegenden Differentialspiel ist ein Nash-Gleichgewicht ein Tripel
für das die folgenden Gleichungen erfüllt sind:
Ausführlich geschrieben ist das Nash-Gleichgewicht das folgende System von zwei gekoppelten Steuerungsproblemen für den Arbeiter,
| (1.59) |
und für den Unternehmer,
| (1.60) |
Auf beide Steuerungsprobleme wenn wir die Optimalitätsbedingungen im Pontrjaginsche Maximumprinzip
unter Beachtung der Strategie des Gegenspielers an:
In der Aufgabe der Arbeiter (1.59) erhalten wir die Maximumbedingung
Da jede zulässige Trajektorie stets positiv ist, gilt
| (1.61) |
Weiter genügt der adjungierten Gleichung (1.5) und Transversalitätsbedingung (1.6):
| (1.62) |
In Gleichung (1.62) erkennt man unmittelbar für .
Daher gilt für .
Entsprechend ergibt sich in der Aufgabe des Unternehmers (1.60) die Maximumbedingung
und es gilt
| (1.63) |
Ferner genügt der adjungierten Gleichung zur Transversalitätsbedingung:
| (1.64) |
Zusammen erhalten wir aus (1.63) und (1.64)
Aufgrund der strengen Monotonie existiert eine eindeutig bestimmte Lösung von
Wegen (1.63) gilt für alle und aus (1.61) folgt nun auf . Auf erhalten wir daraus
Weiterhin folgt nach (1.58) und aus der Bedingung
| (1.65) |
Aufgrund in (1.58) ist .
Da streng monoton fallend ist,
erhalten wir und für alle .
Zusammenfassend lauten im Nash-Gleichgewicht die jeweiligen Strategien
zum Kapitalstock
Für die Zielfunktionale ergeben sich
| (1.66) |
Die Untersuchung des Nash-Gleichgewichtes ist damit abgeschlossen.
Im Gegensatz zur Spielsituation besprechen sich die Arbeiter und Unternehmer, wie sie gemeinsam am besten agieren können. Für das gemeinsame Zielfunktional ergibt sich
Führen wir die neue Steuerungsvariable durch
ein, so erhalten wir die Aufgabe
| (1.67) |
Die kooperative Lösung ist (sie ergibt sich analog zu Beispiel 1.4)
mit folgendem Optimalwert für das Zielfunktional:
| (1.68) |
Der Gesamtnutzen im Nash-Gleichgewicht nach (1.66) ist gleich
| (1.69) |
Zum Vergleich der Werte (1.68) und (1.69) verwenden wir die Beziehung
Damit erhalten wir
Benutzen wir die elementare Ungleichung für , so folgt abschließend
D. h. der Gesamtnutzen ist im sozialen Optimum größer als im Wettbewerb. An dieser Stelle bleibt aber die spannende Frage nach einer “gerechten” Aufteilung des Nutzens auf Unternehmer und Arbeiter offen.
2 Optimale Multiprozesse
Der Begriff des Multiprozesses lässt sich am Beispiel des Autofahrens illustrieren:
Neben den kontinuierlichen Steuerungen “beschleunigen” und “bremsen”
bildet die Wahl des konkreten Ganges einen wesentlichen Beitrag zur Minimierung des Treibstoffverbrauchs oder
zum Erreichen des Zielortes in kürzester Zeit.
Denn die Auswahl des jeweiligen Ganges beeinflusst maßgeblich das dynamische Beschleunigungsverhalten, den momentanen Benzinverbrauch
und die Geschwindigkeit.
Das Fahrverhalten und der Treibstoffverbrauch wird in jedem einzelnen Gang durch eine eigene Dynamik und Verbrauchsfunktion beschrieben.
Dementsprechend setzt sich dieses Optimierungsproblem aus verschiedenen,
dem jeweilig ausgewählten Gang zugeordneten Steuerungsproblemen zusammen.
Die Schaltfolge zwischen den einzelnen Gängen wird durch eine Wechselstrategie
beschrieben.
Das Beispiel des Autofahrens verdeutlicht dabei den speziellen Charakter der Wechselstrategie:
Im Vergleich zu den Pedalen, die stufenlos gesteuert werden können,
ist die Auswahl des Ganges eine rein diskrete Größe.
Ein Multiprozess besteht aus einer gewissen endlichen Anzahl von einzelnen Steuerungssystemen,
welche sich jeweils aus individuellen Dynamiken, Zielfunktionalen und Steuerungsbereichen zusammensetzen.
Neben der Suche nach der optimalen Steuerung für das jeweils gewählte Steuerungssystem
liegt das Hauptaugenmerk bei der Untersuchung von Multiprozessen auf der Bestimmung der optimalen Wechselstrategie.
Dabei wird eine Wechselstrategie durch die Anzahl der Wechsel zwischen den einzelnen Steuerungssystemen,
durch die konkrete Auswahl des jeweiligen Steuerungssystems und durch diejenigen Zeitpunkte,
zu denen diese Wechsel stattfinden, beschrieben.
Wir betrachten ausschließlich Multiprozesse mit stetigen Zuständen.
Außerdem dürfen keine Wechselkosten anfallen.
Im Vergleich zur Standardaufgabe liegt die besondere Charakteristik eines Multiprozesses in der Wechselstrategie.
Die wesentliche Herausforderung in der folgenden Untersuchung von Multiprozessen besteht somit darin,
die Wechselstrategien so in eine Form zu gießen,
dass die Aufgabe eines Multiprozesses die Gestalt eines Steuerungsproblems erhält.
2.1 Vorbereitende Betrachtungen
Es bezeichne die Anzahl an Steuerungssystemen, aus denen sich der Multiprozess zusammen setzt. Für ein bezeichnen den Integranden im Zielfunktional, die rechte Seite der Dynamik und den Steuerbereich des ten Steuerungssystems. Dann ist es naheliegend einen Multiprozess wie folgt aufzustellen: Wir zerlegen das Zeitintervall mit Hilfe der (gegebenen) Wechselzeitpunkte in Teilintervalle mit . Über einem Zeitabschnitt ist ein gewisses Steuerungsproblem ausgewählt, nämlich . Auf diese Weise ergeben sich über einem Teilabschnitt die Elemente
Über dem gesamten Zeitintervall erhält der Multiprozess dadurch die Gestalt
| (2.1) |
Die Darstellung (2.1) eines Multiprozesses ist für die Behandlung als Aufgabe der Optimalen Steuerung weniger geeignet,
denn die Folge der Indizes ,
welche Anzahl der Wechsel und die Abfolge der aktiven Steuerungssysteme beschreibt,
ist bereits determiniert.
Somit kann die wesentliche Charakteristik eines Multiprozesses, nämlich dessen optimale Wechselstrategie,
nicht in die Optimierung integriert werden.
Die Beschreibung einer Wechselstrategie als “echte” Steuerungsvariable wird in dieser Form nicht erreicht.
Unsere Zielstellung ist also eine Formulierung eines Multiprozesses zu finden,
so dass die Wechselstrategien die Form einer Steuervariablen erhalten und damit alle möglichen Abfolgen von aktiven
Steuerunssystemen mit beliebiger Anzahl an Wechseln und zu beliebigen Wechselzeitpunkten zur Konkurrenz zugelassen sind.
Dazu erarbeiten wir einen alternativen Ansatz, welcher auf den Zerlegungen des Zeitintervall beruht.
Definition 2.1.
Ein stückweise zusammengesetztes Intervall ist die endliche Vereinigung von rechtsseitig halboffenen und abgeschlossenen Intervallen bzw. mit .
Definition 2.2 (-fache Zerlegung).
Eine -fache Zerlegung des Intervalls ist ein endliches System von stückweise zusammengesetzten Intervallen mit
Es bezeichnet die Menge der -fachen Zerlegungen von .
In unserem nächsten Schritt verknüpfen wir die -fachen Zerlegungen mit den Steuerungssystemen des Multiprozesses. Dazu identifizieren wir ein Element mit der Vektorfunktion der charakteristischen Funktionen der Mengen :
Da die Mengen stückweise zusammengesetzte Intervalle sind, ist jede Funktion stückweise stetig und gehört zu der Menge
Weiterhin betrachten wir die Funktionen und fassen diese zur Vektorfunktion zusammen. Außerdem wurden darin die Variablen vereint. Die Verknüpfung der Funktion mit einer -fachen Zerlegung setzen wir wie folgt fest:
Sind die Funktionen nach differenzierbar, dann setzen wir für die Ableitung:
Die Verknüpfung hat zur Folge, dass die -fache Zerlegung zu jedem Zeitpunkt einerseits in eindeutiger Weise eine der Funktionen und außerdem die entsprechende Komponente des Vektors auswählt. Auf diese Weise erhält das Wesen einer Auswahlvariable. Die Herausforderung, einen Mulitiprozess unabhängig von einer Schaltfolge zu formulieren, wird damit durch -fache Zerlegung gemeistert. Damit sind wir bereit die Multiprozesse in eine geeignete Form zu gießen.
2.2 Die Aufgabenstellung und das Pontrjaginsche Maximumprinzip
Es sei die Anzahl der verschiedenen gegebenen Steuerungssysteme mit ihren Integranden , rechten Seiten und Steuerbereichen . Wir fassen die Steuerungssysteme durch die Setzungen
zusammen. Dann besitzt mit Hilfe der -fachen Zerlegungen die Aufgabe eines optimalen Multiprozesses die Form eines Steuerungsproblems:
| (2.2) | |||
| (2.3) | |||
| (2.4) |
Die Aufgabe (2.2)–(2.4) untersuchen wir bezüglich der Tripel
Mit bezeichnen wir die Menge aller Tripel ,
für die es ein derart gibt,
dass die Abbildungen , für auf der Menge aller Punkte mit
, ,
stetig in der Gesamtheit aller Variablen und stetig differenzierbar bezüglich sind.
Ein Tripel
ist ein zulässiger Steuerungsprozess der Aufgabe (2.2)–(2.4),
falls dem System (2.3) zu genügt.
Mit bezeichnen wir die Menge der zulässigen Steuerungsprozesse.
Ein zulässiger Steuerungsprozess ist eine
starke lokale Minimalstelle
der Aufgabe (2.2)–(2.4),
falls eine Zahl derart existiert, dass die Ungleichung
für alle mit gilt.
Es bezeichnen die Pontrjagin-Funktionen der einzelnen Steuerungssysteme:
Die Pontrjagin-Funktionen fügen wir zu der Vektorfunktion zusammen:
Damit definieren wir die Pontrjagin-Funktion auf folgende Weise:
Theorem 2.3 (Pontrjaginsches Maximumprinzip).
Beispiel 2.4.
Wir untersuchen ein Investitionsmodell, dass sich aus dem linearen und dem konkaven Beispielen 1.4 und 1.5 zusammensetzt:
| (2.8) |
In den einzelnen Steuerungssystemen sind
und es gelten für die Modellparameter
Da ist, unterscheiden wir nicht zwischen den Steuervariablen und schreiben . Wir wenden Theorem 2.3 an. Es gilt nach (2.7):
Dies können wir weiterhin in die Form
bringen. Daraus erhalten wir für die optimale Investitionsrate und Wechselstrategie
Die Funktion ist die Lösung der adjungierten Gleichung (2.5):
Betrachten wir die einzelnen Steuerungssysteme, so sind nach den Beispielen 1.4 und 1.5 durch bzw. die Zeitpunkte für den optimalen Wechsel von vollständiger Investition in komplette Kosumption gegeben. Außerdem ist für die Lösung der Differentiagleichung mit der Zeitpunkt , in dem gilt, durch bestimmt. Im Weiteren seien also
Wir diskutieren die möglichen Szenarien:
-
(a)
Sei : In diesem Fall lautet der Kandidat
-
(b)
Seien und : Dann ist und der Kandidat lautet
-
(c)
Seien und : Dann ist und wir erhalten den Kandidaten
-
(d)
Seien und : Wegen sind alle Bedingungen von Theorem 2.7 für die Multiprozesse und erfüllt.
Sei mit . Für betrachten wir die Steuerungendie wie im Fall (c) einen Wechsel des Steuerungssystems zum Zeitpunkt und eine verlängerte Investitionsphase vorgeben. Für den zugehörigen Kapitalbestand gilt und für den Wert des Zielfunktionals
Daher stellt in diesem Fall kein starkes lokales Maximum dar. Der Multiprozess ist der einzige der Kandidat.
Die Diskussion der notwendigen Optimalitätsbedingungen ist damit abgeschlossen.
2.3 Der Beweis des Maximumprinzips
Wir passen den Beweis für die elementare Standardaufgabe in Abschnitt 1.2 an die zusätzliche Steuerung an: Es sei ein Stetigkeitspunkt der Steuerungen und . Weiterhin seien , fest gewählt und es bezeichne diejenige Zerlegung, für die ist. Damit definieren wir die einfachen Nadelvariationen , durch
Dabei wählt über von den gegebenen Steuerungssystemen dasjenige zum Index aus. Weiter sei die eindeutige Lösung der Gleichung
Für untersuchen wir den Grenzwert . Auf die gleiche Weise wie im Abschnitt 1.2 zeigt sich, dass dieser Grenzwert für alle existiert, in die Gleichung
gilt und ferner über der Integralgleichung
genügt. Weiterhin ergibt sich die Beziehung
Abschließend zeigt sich
welche zur Gültigkeit der Maximumbedingung (2.7) führt.
2.4 Hinreichende Bedingungen nach Arrow
Die Aufgabe (2.2)–(2.4) eines Multiprozesses enthält den Steuerbereich ,
der die Wechselstrategien charakterisiert und keine konvexe Menge darstellt.
Es wird sich im Beispiel 2.6 zeigen,
dass die hinreichenden Arrow-Bedingungen im Fall optimaler Multiprozesse recht eingeschränkt anwendbar sind.
Für sei wieder .
Außerdem bezeichnet die Hamilton-Funktion
| (2.13) |
Theorem 2.5.
Beweis Auf die gleiche Weise wie die Ungleichungen (1.38), (1.40) im Beweis von Theorem 1.7 in Abschnitt 1.4 ergeben sich: Für alle und alle , in denen die Maximumbedingung (2.7) erfüllt ist, gelten
Es sei mit . Dann erhalten wir
Mit und ergibt sich
für alle
mit .
Die Aufgabe eines Multiprozesses enthält neben der üblichen Steuerung noch mittels der Wechselstrategie die Möglichkeit auf die Auswahl eines
bestimmten Steuerungssystems.
Diese Vermischung von kontinuierlichen und diskreten Steuervariablen erschwert den Nachweis der Konkavität der Hamilton-Funktion.
Beispiel 2.6.
Das Investitionsmodell im Beispiel 2.4 lauten die Pontrjagin-Funktionen zu den beiden Steurungssystemen
Wegen beachten wir nur eine Steuervariable . Dies führt zu der Hamilton-Funktion
welche die Funktion
enthält, die in nicht konkav ist.
Damit ist die Hamilton-Funktion bezüglich der Trajektorie
genau dann für jedes konkav in der Variablen auf ,
wenn für alle gilt.
Für die einzelnen Fälle im Beispiel 2.4 ergeben sich damit:
-
(a)
Theorem 2.5 ist nur dann anwendbar, wenn gilt. In diesem Fall ist der Kandidat optimal.
-
(b)
Da in diesem Fall auf gilt, ist Theorem 2.5 anwendbar und der Kandidat optimal.
-
(c)
Wegen ist Theorem 2.5 nicht anwendbar.
-
(d)
Wegen und ist Theorem 2.5 auf keinen der ermittelten Kandidaten , anwendbar. Die lokale Optimalität des Kandidaten wurde bereits ausgeschlossen.
3 Aufgaben mit unendlichem Zeithorizont
Steuerungsprobleme mit einem unendlichen Zeithorizont finden z. B. bei dynamischen System,
welche nur asymptotische Stabilität aufweisen,
oder in der Ökonomischen Wachstumstheorie Anwendung.
Die Einbindung dieser Klasse in die Wirtschaftstheorie geht auf Frank P. Ramsey (1903–1930) zurück,
der in der Arbeit [14] aus dem Jahr 1928 der Frage einer optimalen Sparquote nachgeht,
die einer Ökonomie langfristiges und wohlfahrtsoptimiertes Wachstum garantiert.
Das besondere an der Modellierung des Variationsproblems war die Einführung des unendlichen Zeithorizontes.
Die Philosophie dahinter ist die Vorstellung,
dass kein natürliches Ende für den Betrachtungszeitraum existiert.
Möchte man sämtlichen nachfolgenden Generationen Beachtung schenken, dann ist die Idealisierung in Form des
zeitlich unbeschränkten Rahmens die einzig mögliche Konsequenz.
In der Literatur werden die Steuerungsprobleme mit unendlichem Zeithorizont häufig als eine Folgerung
der Standardaufgabe dargestellt.
Dabei sind die Hürden, die das unbeschränkte Zeitintervall mit sich führt,
von grundlegender Natur und mit den bisher zur Verfügung gestellten Methoden nicht erfassbar.
Anhand der elementaren Aufgabe mit freiem Endpunkt lassen sich diese Schwierigkeiten bereits sehr gut verdeutlichen.
Letztendlich zeigt sich,
dass ohne zusätzliche Argumente mit der einfachen Nadelvariation kein vollständiger Beweis eines Pontrjaginschen Maximumprinzips
für die Aufgabe mit unendlichem Zeithorizont erbracht werden kann.
3.1 Pathologien und Variierbarkeit
Steuerungsprobleme mit unendlichem Zeithorizont werden häufig als Aufgabe über einem sehr langen Planungszeitraum aufgefasst.
Auf diese Weise wird die Aufgabenstellung mit unbeschränktem Zeitintervall auf eine Aufgabe mit endlichem Zeithorizont reduziert,
für die die bekannten Ergebnisse angewendet werden können.
Diese Methode der Approximation mit endlichem Horizont ist in der Literatur weit verbreitet.
Allerdings kann dieser Ansatz zu pathologischen Situationen führen.
Einige der entarteten Fälle sind bei Aseev & Kryazhimskii [1] dokumentiert.
Die wesentliche Ursache für das Auftreten von Pathologien besteht bei der Methode der Approximation mit endlichem Horizont in der Erwartung,
dass im Grenzübergang von endlichen zum unendlichen Zeithorizont die Struktur des optimalen Steuerungsprozesses und dessen Optimalwert,
aber auch die Optimalitätsbedingungen des Pontrjaginschen Maximumprinzips ein stetiges Verhalten aufweisen.
Im Allgemeinen darf auf diese Hoffnung nicht gebaut werden.
Um diese Schilderungen zu untermauern, betrachten wir illustrative Beispiele.
Wir beginnen mit einer Variante von Beispiel 1.4:
Beispiel 3.1.
Wir betrachten die Aufgabe
Für jedes feste erhalten wir mit den gleichen Argumenten wie im Beispiel 1.4 den global optimalen Steuerungsprozess
Betrachten wir den Grenzübergang , dann konvergiert die Familie , , punktweise gegen den Steuerungsprozess
Dieses Paar ist das globale Minimum der Aufgabe mit unendlichem Zeithorizont.
Im Beispiel 3.1 bleibt der Wert der Zielfunktionals für die optimalen Steuerungsprozesse
im Grenzwert für nicht endlich.
Die Aufgabe ist demnach im Unendlichen unstetig.
Deswegen erweist sich die Approximation mit endlichem Zeithorizont an dieser Stelle als ungeeignet.
Demgegenüber erfüllen die folgenden Beispiele gewisse Anforderungen an Endlichkeit und Stetigkeit im Unendlichen.
Trotzdem besitzen die notwendigen Optimalitätsbedingungen nicht die erwartete Form.
Im Vorwort zur Standardaufgabe (1.1)–(1.3) im Abschnitt 1 haben wir angekündigt,
uns lediglich auf den “normalen” Fall notwendiger Optimilitätsbedingungen zu beschränken.
In Verallgemeinerung zum normalen Fall besitzt die Pontrjagin-Funktion die Gestalt
mit dem zusätzlichen Faktor . In diesem Fall liefert das Pontrjaginsche Maximumprinzip für die Aufgabe ohne Terminalfunktional die Existenz nichttrivialer Multiplikatoren und derart, dass die adjungierte Gleichung
zur Transversalitätsbedingung und in fast allen Punkten die Maximumbedingung
erfüllt sind. In unseren Betrachtungen zu Aufgaben mit freiem rechten Endpunkt ergibt sich, dass stets der normale Fall mit vorliegt. Die nachfolgenden Beispiele von Halkin [6] zeigen nun, dass im Übergang zum unendlichen Zeithorizont einerseits der normale Fall mit annulliert werden kann und andererseits auf Basis von die erwartete Transversalitätsbedingung für nicht eintreten muss.
Beispiel 3.2.
Wir diskutieren nach Halkin [6] die Aufgabe
Die Dynamik lässt sich mittels der Trennung der Veränderlichen behandeln. Auf diese Weise ergibt sich für den Zustand des Steuerungsprozesses die Darstellung
Da ausfällt, existiert für jede uneigentlich integrierbare Funktion mit endlichem oder unendlichem Integralwert der Grenzwert der Zustandes für und besitzt einen Wert aus . Ferner ergibt sich im Zielfunktional
Daher stellt jeder zulässige Steuerungsprozess mit für ein globales Maximum dar.
Wir diskutieren die notwendigen Optimalitätsbedingungen für den optimalen Steuerungsprozess
mit und über :
In dieser Aufgabe besitzt die Pontrjagin-Funktion die Form .
Die Anwendung der Maximumbedingung (1.7) in Theorem 1.2 führt auf die Beziehung
Diese Bedingung kann für den inneren Wert nur dann erfüllt sein, wenn für alle gilt. Damit ergibt sich für und die Gültigkeit einer gleichartigen Transversalitätsbedingung zu (1.5) stellt sich nicht ein.
Beispiel 3.3.
In der folgenden Variante eines Beispieles nach Halkin [6],
erhalten wir für einen zulässigen Steuerungsprozess für den Zustand
Damit liefert der Steuerungsprozess das globale Maximum der Aufgabe. Denn für jeden anderen zulässigen Steuerungsprozess mit einer stückweise stetigen Steuerung, die nicht identisch verschwindet, besitzt das Zielfunktional den Wert .
Wir werten die Bedingungen des Pontrjaginschen Maximumprinzips im allgemeinen Fall aus: Die Pontrjagin-Funktion lautet . Für die Lösung der adjungierten Gleichung ergibt sich
und es gilt für . Die Maximumbedingung lautet
und ist äquivalent zu der Maximierungsaufgabe
Wäre nun , so fällt wegen der Ausdruck in der eckigen Klammer für alle hinreichend große positiv aus, und kann nicht der Maximumbedingung für fast alle genügen. Deswegen muss der anormale Fall der notwendigen Optimalitätsbedingungen mit eintreten.
Unsere Untersuchungen der elementaren Aufgaben auf starke lokale Optimalstellen basieren auf der einfachen Nadelvariation
Im Vergleich zum endlichen Zeitintervall ist die Variation mittels nicht in jedem Fall möglich. Zur Veranschaulichung betrachten wir die Dynamik
Die Trajektorie zur Steuerung ist nicht variierbar.
Denn jede Steuerung mit und liefert eine Trajektorie ,
die als Lösung der Differentialgleichung nicht über der gesamten Halbachse existiert.
Im Beweis des Pontrjaginschen Maximumprinzips für die elementare Aufgabe sind die Abhängigkeitssätze im Anhang B zentraler Bestandteil.
Auf das unbeschränkte Zeitintervall sind diese Resultate nicht unmittelbar übertragbar.
In der nachfolgenden Untersuchung legen wir uns auf beschränkte Steuerungsprozesse fest,
für die das Zielfunktional endlich ausfällt und beschränken uns außerdem auf Variationen ,
die gleichmäßig gegen über für konvergieren.
Die Existenz derartiger Variationen bleibt an dieser Stelle offen,
da wir auf adäquate Abhängigkeitssätze nicht zugreifen können.
3.2 Die Aufgabenstellung und das Pontrjaginsche Maximumprinzip
Die Aufgabe mit unendlichem Zeithorizont besitzt die Gestalt
| (3.1) | |||
| (3.2) | |||
| (3.3) |
Die Aufgabe (3.1)–(3.3) mit unendlichem Zeithorizont untersuchen wir bezüglich der Steuerungsprozesse
.
Dabei bezeichnen wir mit bzw. die Räume derjenigen Funktionen,
die über beschränkt und die über jedem endlichen Intervall stückweise stetig bzw. stückweise stetig differenzierbar sind.
Mit bezeichnen wir die Menge aller Paare ,
für die es ein derart gibt,
dass die Abbildungen , für jede kompakte Teilmenge
auf der Menge aller Punkte mit
, und
beschränkt, stetig in der Gesamtheit aller Variablen und stetig differenzierbar bezüglich
mit beschränkten Ableitungen , sind.
Das Paar
heißt ein zulässiger Steuerungsprozess in der Aufgabe (3.1)–(3.3),
falls über jedem endlichen Intervall der Dynamik (3.2) zu genügt und
die Steuerbeschränkungen (3.3) erfüllt.
Mit bezeichnen wir die Menge der zulässigen Steuerungsprozesse.
Ein zulässiger Steuerungsprozess ist eine
starke lokale Minimalstelle
der Aufgabe (3.1)–(3.3),
falls eine Zahl derart existiert, dass die Ungleichung
für alle mit gilt.
Eine wesentliche Herausforderung ist der Nachweis einer adjungierten Funktion,
die sowohl die adjungierte Gleichung als auch eine Transversalitätsbedingung im Unendlichen erfüllt.
Die Existenz der Adjungierten wird im Folgenden mit Hilfe der Bedingung
| (3.4) |
nach Lemma B.5 und B.7 gesichert.
Allerdings ist diese Bedingung nicht unkritisch,
da sie zum Beispiel lineare Dynamiken mit konstanten Koeffizienten ausschließt.
Außerdem wird durch (3.4) die Problematik der fehlenden Variierbarkeit einer Trajektorie nicht behoben.
Ungeachtet dessen bezeichnet die Menge aller Paare ,
welche der Bedingung (3.4) genügen.
Für die Aufgabe (3.1)–(3.3) bezeichnet
die Pontrjagin-Funktion
Theorem 3.4 (Pontrjaginsches Maximumprinzip).
Bemerkung 3.5.
Im Folgenden sind die Wohldefiniertheit von auf und die gleichmäßige Konvergenz von gegen nicht gesichert, da uns adäquate Abhängigkeitssätze über nicht zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist der nachstehende “Beweis” bezüglich diesem Argument unvollständig.
Beweis Da der Steuerungsprozess der Menge
angehört,
ist er beschränkt.
Ferner sind und
über integrierbar, beschränkt und stückweise stetig.
Damit sind die Voraussetzungen von Lemma B.5 und von Lemma B.7 erfüllt
und es existiert eine eindeutige stetige Lösung der adjungierten Gleichung (3.5)
zur Transversalitätsbedingung (3.6).
Wegen der stückweisen Stetigkeit der einfließenden Abbildungen ist ebenfalls stückweise stetig
und die Adjungierte gehört dem Raum an.
Ferner besitzt nach Lemma B.5 die Integralgleichung
| (3.8) |
für jedes und jedes eine eindeutige Lösung,
da über integrierbar ist.
Wir verwenden wieder die Nadelvariation des Beweises in Abschnitt 1.2:
und es bezeichne , , die eindeutige Lösung der Gleichung
Wir wählen . Mit den gleichen Argumenten wie in Abschnitt 1.2 folgt, dass für der Grenzwert
existiert und die Funktion der Integralgleichung
zur Anfangsbedingung
genügt. Da die Integralgleichung (3.8) eine eindeutige Lösung über besitzt, gilt für alle , und dies für beliebiges . Ferner ist die Beziehung
erfüllt. Da nach Lemma B.5 einen Grenzwert im Unendlichen besitzt, ergibt sich
| (3.9) |
Es sei die Variation von zur Steuerung , die auf gleichmäßig konvergent gegen sei. Es zeigt sich abschließend wie in Abschnitt 1.2
d. h. es ergibt sich zusammen mit (3.9) die Ungleichung
Da als ein Stetigkeitspunkt von und willkürlich ausgewählt wurden, folgt die Gültigkeit der Maximumbedingung (3.7).
3.3 Ein Fischerei-Differentialspiel
Wir betrachten nach Dockner et al. [2] das Differentialspiel
Im Vergleich zu [2] haben wir den Faktor in der Dynamik hinzugefügt, um die Stabilität des dynamischen Systems gemäß der Bedingungen (3.4) zu sichern. In dieser Aufgabe sei der Preis nicht konstant, sondern umgekehrt proportional zum Angebot :
Dieser Ansatz spiegelt die Ökonomie einer “Eskimo”-Gesellschaft wider,
in welcher der Fischbestand die wichtigste Nahrungsgrundlage darstellt und kein echtes Ersatzprodukt existiert.
Unter diesen Umständen führt eine prozentuale Preissteigerung zu einem Umsatzrückgang in gleicher Relation.
Wenden wir die Transformation an, so gilt
und wir erhalten das Spielproblem
Ein zulässiger Steuerungsprozess ist ein Nash-Gleichgewicht des Spiels, falls für alle anderen zulässigen Steuerungsprozesse , die Ungleichungen
gelten. Halten wir die optimale Strategie des Gegenspielers fest, dann ergeben sich für , , folgende miteinander gekoppelte Steuerungsprobleme:
Die zulässigen Steuerungen gehören dem Raum an. Deshalb sind im Ansatz des Nash-Gleichgewichtes die Abbildungen
nicht stetig bezüglich der Variable .
An dieser Stelle verweisen auf die Bemerkungen in der Analyse des Kapitalismusspiels in Abschnitt 1.7,
dass unter diesen Rahmenbedingungen Theorem 3.4 seine Gültigkeit behält.
Die Pontrjagin-Funktionen lauten
Mit Lemma B.7 ergibt sich die eindeutige Lösung der adjungierten Gleichung (3.5):
Die Maximumbedingung (3.6) liefert das Gleichungssystem
Aus der Summe beider Gleichungen ergibt sich
und wir erhalten die optimalen Steuerungen
Die optimale Trajektorie besitzt die Gestalt
Für diese gilt im Unendlichen
Die Funktion ist streng monoton und nimmt nur Werte zwischen und an. Somit ist über wohldefiniert, besitzt eine untere positive Schranke und liefert einen Kandidaten für das ursprüngliche Differentialspiel.
3.4 Hinreichende Bedingungen nach Arrow
Wir leiten nun für die Aufgabe (3.1)–(3.3)
die hinreichenden Bedingungen nach Arrow ab.
Das Vorgehen erschließt sich unmittelbar aus Abschnitt 1.4.
Für die Standardaufgabe (1.1)–(1.3) liefern die hinreichenden Bedingungen nach Arrow
Gewissheit über die Optimalität eines Kandidaten.
Für die Anwendung des Maximumprinzips 3.6 müssen die Einschränkungen (3.4) erfüllt sein.
In der Herleitung der Arrow-Bedingungen können wir auf diese Einschränkungen verzichten,
da sie wesentlich auf der Konkavität der Hamilton-Funktion basieren.
Dadurch erreichen wir eine deutlich umfassendere Anwendbarkeit der Bedingungen des (unvollständig bewiesenen) Maximumprinzips.
Für sei wieder .
Außerdem bezeichnet die Hamilton-Funktion
Theorem 3.6.
Beweis Wir wählen . Auf die gleiche Weise wie im Beweis von Theorem 1.7 in Abschnitt 1.4 ergibt sich die Beziehung
Im Anfangszeitpunkt gelten . Für sind die Trajektorien beschränkt und es gilt nach der Transversalitätsbedingung (3.6). Daher folgt die Beziehung
für alle zulässigen mit .
Beispiel 3.7.
In der Aufgabe eines linear-quadratischen Reglers,
| (3.10) |
ist die restrikitive Bedingung (3.4) nicht erfüllt und es ist das Pontrjaginsche Maximumprinzip 3.4 nicht anwendbar. Andererseits lautet die Pontrjagin-Funktion
welche für jedes und konvex in ist. Damit ist die Hamilton-Funktion
konvex, denn das Supremum wird durch angenommen.
Um die Lösung der Aufgabe (3.10) zu bestimmen,
müssen wir das Tripel ermitteln,
das die Bedingungen (3.5)–(3.7) in Theorem 3.4 erfüllt.
Da der Steuerbereich offen ist und die Pontrjagin-Funktion streng konvex in ist,
darf man in der Maximumbedingung zur Ableitung nach übergehen.
Damit liefern die Dynamik, die adjungierte Gleichung und die Maximumbedingung das Gleichungssystem
Das Ersetzen von durch und Ableiten der Dynamik führt auf
Die charakteristische Gleichung der Differentialgleichung für besitzt die Eigenwerte
Damit ergeben sich die Funktionen
Aufgrund der Transversalitätsbedingung für gilt . Damit führt die Anfangsbedingung zu . Wir erhalten das zulässige Tripel
welches die Bedingungen (3.5)–(3.7) in Theorem 3.4 erfüllt. Damit ist nach Theorem 3.6 der Steuerungsprozess ein starkes lokales Minimum der Aufgabe (3.10).
Beispiel 3.8.
Wir modifizieren das vorhergehende Beispiel und betrachten wir den linear-quadratischen Regler
| (3.11) |
Die Pontrjagin-Funktion der Aufgabe 3.11 lautet
Damit ist wie im vorgehenden Beispiel die Hamilton-Funktion
konvex und das Supremum wird durch angenommen. Die Dynamik, die adjungierte Gleichung und die Maximumbedingung führen auf das Gleichungssystem
und liefern die Differentialgleichung
welche die Eigenwerte
besitzt. Damit ergeben sich die Funktionen
Mit Hilfe der Transversalitätsbedingung für und der Anfangsbedingung erhalten wir den Steuerungsprozess
und die Adjungierte
welche die Bedingungen (3.5)–(3.7) in Theorem 3.4 erfüllen.
Der Steuerungsprozess ist über stetig und beschränkt und gehört damit
der Menge an – obwohl und im Unendlichen divergieren!
Dennoch ist nach Theorem 3.6 der Steuerungsprozess
ein starkes lokales Minimum der Aufgabe (3.11).
4 Zeitverzögerte dynamische Systeme
Dynamische Systeme mit Zeitverzögerungen sind wesentliche Elemente in der Modellierung und Auswertung
lebensnaher Phänomene.
Anwendungsfelder sind in der Biologie oder der Biomedizin zu finden.
So zählt zu den gängigen Beispielen einer retardierten Arznei der Typus,
bei dem der Wirkstoff zeitlich verzögert freigesetzt wird.
Das verzögerte System entsteht dadurch,
dass die Zustandsänderung nicht ausschließlich aus dem vorliegenden Zustand und
den simultanen Maßnahmen resultiert,
sondern gleichzeitig mit einer zeitlichen Verzögerungen auf den vorherigen Status und auf die getroffenen
Maßnahmen reagiert.
Dadurch erhält das dynamische System die Form
welche zentraler Gegenstand der Untersuchungen dieses Abschnitts ist.
Die Auswertung von Steuerungsproblemen mit einer Zeitverzögerung ist schwierig und erfolgt in der Literatur meistens numerisch.
Als eine Anwendung auf eine reale Problemstellung verweisen wir die Untersuchung einer Chemoimmuntherapie,
einer Kombination von Chemo- und Immuntherapie,
bei Rihan et. al. [15] oder bei Göllmann & Maurer in [5].
Bei einer Chemotherapie verwendet man verschiedene Medikamente (Zytostatika),
um Krebszellen abzutöten oder das Wachstum der Krebszellen zu verlangsamen.
Bei der Behandlung bösartiger Tumorerkrankungen nutzen die meisten Zytostatika die schnelle Teilungsfähigkeit der Tumorzellen,
da diese empfindlicher als gesunde Zellen auf Störungen der Zellteilung reagieren.
Auf gesunde Zellen mit ähnlich guter Teilungsfähigkeit üben sie allerdings eine ähnliche Wirkung aus,
wodurch sich Nebenwirkungen wie Haarausfall oder Durchfall einstellen können.
Immuntherapien beinhalten Behandlungen,
die das Immunsystem im Kampf gegen Krebs stimulieren oder stärken.
Effektorzellen wie B-Lymphozyten (kurz B-Zellen) gehören zu den Leukozyten (weiße Blutkörperchen),
die Plasmazellen bilden, die wiederum Antikörper bilden.
4.1 Die Aufgabenstellung und das Pontrjaginsche Maximumprinzip
Die Aufgabe eines verzögerten Steuerungsproblems besitzt die Form
| (4.1) | |||
| (4.2) | |||
| (4.3) |
Im Vergleich zur Aufgabe (1.1)–(1.3) ergänzen wir in den Abbildungen und die Variablen und bezüglich des verzögerten Zustandes bzw. der verzögerten Steuerung:
Bei der Behandlung von Steuerungsproblemen mit einer Zeitverzögerung stellt sich die Frage, wie das dynamische System (4.2) zu behandeln ist. Für den Teilabschnitt reduziert es sich auf die Gleichung
welche sich für eine stückweise stetige rechte Seite mit den Werkzeugen im Anhang B über Differentialgleichungen handhaben lässt.
Dieser Gedankengang kann anschließend schrittweise über den Teilabschnitten , , … wiederholt werden.
Daher kann die Dynamik mit Zeitverzögerung abschnittsweise wie eine Differentialgleichung mit stückweise stetigen rechten Seiten
aufgefasst werden.
In ähnlicher Weise verfährt man mit der adjungierten Gleichung in der umgekehrten Zeitrichtung.
Die Aufgabe (4.1)–(4.3) betrachten wir bezüglich der Paare
Mit bezeichnen wir die Menge aller Paare , für die es ein derart gibt, dass die Abbildungen , auf der Menge aller Punkte mit
stetig in der Gesamtheit aller Variablen und stetig differenzierbar bezüglich und sind.
Das Paar
ist zulässig in der Aufgabe (4.1)–(4.3),
falls dem System (4.2) genügt und die Steuerbeschränkungen (4.3) erfüllt.
Mit bezeichnen wir die Menge der zulässigen Steuerungsprozesse.
Ein zulässiger Steuerungsprozess ist eine
starke lokale Minimalstelle
der Aufgabe (4.1)–(4.3),
falls eine Zahl derart existiert, dass die Ungleichung
für alle
mit gilt.
Es bezeichnet die Pontrjagin-Funktion
Weiterhin führen wir die folgenden abkürzenden Bezeichnungen ein:
Theorem 4.1 (Pontrjaginsches Maximumprinzip).
In Theorem 4.1 sind die Bedingungen kompakt formuliert. Die adjungierte Gleichung (4.4) besitzt ausführlich aufgeschrieben die Gestalt
Ähnlich wie das System (4.2) besitzt die adjungierte Gleichung (4.4) über die “gewöhnliche” Form zur Transversalitätsbedingung (4.5) und lässt sich dann abschnittsweise über , , … behandeln. Ferner hat die Maximumbedingung (4.6) die Gestalt
Beispiel 4.2.
In Anlehnung an Beispiel 1.4 betrachten wir eine Aufgabe, in welcher sich die Investitionen mit der Verzögerung von einer Zeiteinheit auf den Kapitalbestand auswirken. Es ergibt sich das Investitionsmodell
| (4.7) | |||
| (4.8) | |||
| (4.9) |
In der Aufgabe (4.7)–(4.9) verwenden wir für die Variablenbezeichnungen . Damit lauten die Abbildungen der Aufgabe
und die Pontrjaginsche Funktion
Die Maximumbedingung (4.6) besitzt die Form
und ist äquivalent zu folgenden Maximierungen über Teilabschnitte:
| (4.10) |
Die adjungierte Gleichung (4.4) erhält die Gestalt
und lautet abschnittsweise
| (4.11) |
zur Transversalitätsbedingung .
Da und in gelten, führen (4.10) und (4.11) zu:
In der Aufgabe (4.7)–(4.9) mit verzögerten Investitionen konnten wir die Steuerung
ermitteln. Mit dieser ergeben sich für den Kaptialbestand und für die Adjungierte die dynamischen Entwicklungen
Zusammen mit und führt dies abschnittsweise auf die Darstellungen
Aufgrund der abschnittsweise rekursiven Bildung des optimalen Kapitalbestandes verzichten wir an dieser Stelle auf die Berechnung des Optimalwertes.
4.2 Der Beweis des Maximumprinzips
Im Zuge des Beweises gelangen wir zu Ausdrücken, welche Verzögerungen in verschiedene Zeitrichtungen aufweisen. Mit der Substitution gilt und es ergibt sich
| (4.14) |
Beachten wir die unsere Bemerkungen zur Lösung von Differentialgleichungen mit zeitlichen Verzögerungen,
so gibt es nach Lemma B.4 und Lemma B.6 eine eindeutige Lösung
der Gleichung (4.4) zur Randbedingung (4.5).
Für betrachten wir wieder die einfache Nadelvariation
und untersuchen für den Grenzwert (vgl. Abschnitt 1.2)
| (4.15) |
Im weiteren Vorgehen müssen wir beachten, dass in der Aufgabe (4.1)–(4.3) die Nadelvariation über den beiden Intervall und in die Abbildungen und einfließt. Für den Quotienten auf der rechten Seite in (4.15) ergeben sich für abschnittsweise über dem Intervall die folgenden Ausdrücke:
Wir erweitern diese Summe um die Terme
formen damit den zweiten und dritten Summanden um und bringen die gesamte Summe in die Gestalt
Nun ergänzen wir in dieser Summe die Terme
formen damit den zweiten und vierten Summanden um und bringen die Summe in diejenige Form, für die wir den Grenzübergang bilden wollen:
| (4.16) |
Um uns von den klobigen Ausdrücken der Art (4.16) zu lösen, verwenden wir im Weiteren die Kurzschreibweisen
Mit diesen Schreibweisen ergibt der Grenzübergang in (4.16):
Das erste Integral beschränken wir auf das Intervall und entfernen dafür die charakteristische Funktion im Integranden. Im zweiten Integral stimmt der Geltungsbereich mit überein. Ferner dürfen wir anstelle von schreiben. Es ergibt sich
| (4.17) | |||||
Es kann in unstetig sein und dann gilt
Wir werten nun die Ableitung aus. Es gelten für und nach (4.4) für die Adjungierte in :
Für die Terme mit Zeitverschiebung ergibt sich mit Hilfe von (4.14)
Da außerdem gilt, erhalten wir
Im zweiten Integral ebenso die Umformung (4.14) angewendet liefert dann
| (4.18) | |||||
| (4.19) | |||||
| (4.20) |
Die Auswertung der dynamischen Wirkung der Nadelvariation ist (endlich) abgeschlossen und wir kommen zum Abschluss des Beweises: Da ein starkes lokales Minimum ist, gilt für alle hinreichend kleine die Ungleichung
Den Quotienten auf der rechten Seite der Ungleichung formen wir auf die gleiche Weise wie zur Herleitung von (4.16) bzw. (4.17) um und erhalten im Grenzübergang :
| (4.21) | |||||
Die Bedingungen (4.18)–(4.21) und die Transversalitätsbedingung (4.4) ergeben
| (4.22) | |||||
Da als ein Stetigkeitspunkt der Steuerung und zudem beliebig gewählt waren, liefert (4.21) die Gültigkeit der Maximumbedingung (4.6). Der Beweis von Theorem 4.1 ist damit abgeschlosssen.
4.3 Hinreichende Bedingungen nach Arrow
Die Ableitung von hinreichenden Optimalitästbedingungen nach
Arrow
gestaltet sich durch das Auftreten der zeitlichen Verschiebung um schwieriger.
Dennoch führt uns das Vorgehen in Abschnitt 1.4 zum Ziel.
Im Rahmen der zeitverzögerten Systeme treten die Zustände und auf.
Aus diesem Grund verwenden wir für neben der aus Abschnitt 1.4
bekannten Menge
außerdem die Menge ,
Ferner bezeichnet die Hamilton-Funktion
Theorem 4.3.
Beweis Wie im Abschnitt 1.4 folgt, dass ein Randpunkt der konvexen Menge
ist. Daher existiert ein nichttrivialer Vektor mit
für alle . Wählen wir hierin , dann ergibt sich aus
mit der gleichen Argumentation wie in Abschnitt 1.4, dass wir annehmen können und erhalten
| (4.23) | |||||
Wählen wir in dieser Ungleichung nacheinander einerseits und andererseits , so ergeben sich aus (4.23) für alle und alle die Relationen
In der zweiten Ungleichung nehmen wir eine Zeitverschiebung um vor und überführen den Zeitpunkt in . Damit gehört der Menge an und wir dürfen nach der Verschiebung wählen. So ergibt sich für alle die Ungleichung
| (4.24) | |||||
Es sei in die Maximumbedingung (4.6) erfüllt. Mit Hilfe der Pontrjagin-Funktion können wir die Ungleichung (4.24) weiterführen und erhalten
| (4.25) | |||||
für alle . Mit Hilfe der rechten Seite von (4.25) bilden wir die Funktion
welche in dem inneren Punkt der Menge ihr globales Maximum annimmt. Also gilt , d. h.
| (4.26) | |||||
Die adjungierte Gleichung (4.4) zeigt nun
| (4.27) |
Es sei mit . Wir erhalten mit (4.23) und (4.27):
Abschließend können wir festhalten:
für alle mit .
Beispiel 4.4.
Die Hamilton-Funktion im Beispiel 4.2,
ist für konkav und die notwendigen Optimalitätsbedingungen sind in diesem Beispiel gleichzeitig hinreichend.
5 Steuerung Volterrascher Integralgleichungen
Integralgleichungen treten in natürlicher Weise in dynamischen Problemen auf,
in denen das System eine Form von “Erinnerungsvermögen” besitzt.
Da sich im Rahmen der Standardaufgabe und deren Erweiterungen der Einfluss einer Steuervariable stets
unmittelbar auf den Zustand auswirkt,
kann ein Effekt, der sich im Laufe der Zeit entwickelt, meist nicht modelliert werden.
Hier ist die Beschreibung des dynamischen Systems mit Hilfe einer Integralgleichung ein probates Mittel.
Ein Effekt über Zeit kann bei der Zusammenstellung der aggregierten Produktionskapazitäten vorliegen.
Die Kapazitäten ergeben sich als die gesamten Investitionen in Produktionsanlagen in den vorhergehenden Jahrgängen.
Durch Verschleiß, Wartung oder technologischen Fortschritt wird die Produktionsfähigkeit beeinflusst.
Zur Zeit sei die Effizienz der Anlagen des Jahrgangs durch eine Funktion beschrieben.
Zum Zeitpunkt ergeben sich demnach die gesamten vorliegenden Produktionskapazitäten durch
.
Im Rahmen der Werbeindustrie wird durch den strategischen Auf- und Ausbau der Produktbekanntheit dem Konsument ein gewisses
Produktimage und eine Verbundenheit zu dem Produkt suggeriert.
Dabei ist das Management mit der Problemstellung konfrontiert,
dass der Bekanntheitsgrad des Produktes durch Werbemaßnahmen über eine gewisse Zeit aufgebaut werden muss.
Andererseits lässt die Produktbekanntheit (in Folge dessen auch die Nachfrage) umso stärker nach,
je länger der Werbeimpuls in der Vergangenheit liegt.
Die aggregierte Auswirkung der Werbekampagne zum einem Zeitpunkt ist demnach das Resultat der gesamten Werbeanstrengungen,
die im Vorfeld unternommen wurden.
5.1 Vorbereitende Betrachtungen
Der wesentliche Unterschied zur Standardaufgabe besteht darin, dass die Dynamik
nicht nur die eine rechte Seite , sondern eine Familie rechter Seiten besitzt:
Anstelle der einen Zeitvariablen liegen nun eine “innere” Zeitvariable und eine “äußere” Zeitvariable vor. Die Konsequenz daraus ist, dass die Dynamik statt über dem Intervall nun über dem Zeitbereich agiert.
Bemerkung 5.1.
Damit man Ergebnisse für nicht von Beginn an ausschließt, z. B. in Satz B.8 das Teilintervall , ist es günstiger die Betrachtungen nicht auf den Zeitbereich einzuschränkungen.
Im Vergleichung zur Steuerung von Differentialgleichungen besitzt die Steuerung von Integralgleichungen
einen allgemeineren Charakter.
Insbesondere die vorliegende Situation eines dynamischen Systems mit einer Familie von rechten Seiten hat uns dazu bewegt,
die Lösungstheorie zu Differential- und Integralgleichungen im Anhang B ausführlich darzustellen.
Die Herleitung der Optimalitätsbedingungen führt uns zu Stieltjes-Integralen
mit dem Integranden und dem Integrator . Die Funktion ist dabei nur über dem halboffenen Intervall stetig und kann im Endpunkt unstetig sein. Die Zwischensummen für Stieltjes-Integrale besitzen mit den Zerlegungspunkten , den Zwischenpunkten die Gestalt
Da über stückweise stetig differenzierbar ist, gilt – bis auf endlich viele Stellen – mit den Zwischenstellen . Bei Verfeinerung ergibt sich
Zusammenfassend erhalten wir die Beziehung
| (5.1) |
Die Gleichung (5.1) führt zu zwei Varianten der Optimalitätsbedingungen,
wobei die Sprungbedingung im Endzeitpunkt beachtet werden muss:
Das Stieltjes-Integral auf der linken Seite der Beziehung (5.1) spiegelt den unverfälschten Charakter der Optimalitätsbedingungen wider.
Dabei ist die Sprungbedingung im Endzeitpunkt zentraler Bestandteil der Transversalitätsbedingungen.
Auf Grundlage dieser Darstellung geben wir eine ökonomische Interpretation des Maximumprinzips.
Die rechte Seite in (5.1) mit einem Riemann-Integral besitzt einen zusätzlichem Randterm.
Von diesem fließt lediglich in die Pontrjagin-Funktion und in die Transversalitätsbedingungen ein.
Da bei der nachfolgenden Festlegung der Pontrjagin-Funktion mittels des Riemann-Integrals die Sprungbedingung
im Endpunkt bereits Beachtung fand,
darf auf sie verzichtet werden.
5.2 Die Aufgabenstellung und das Pontrjaginsche Maximumprinzip
Die Steuerung einer Volterraschen Integralgleichung bezeichnet die Aufgabe
| (5.2) | |||
| (5.3) | |||
| (5.4) |
die wir bezüglich untersuchen.
Mit bezeichnen wir die Menge ,
für die es ein derart gibt,
dass die Abbildungen , auf der Menge aller mit
stetig in der Gesamtheit aller Variablen und stetig differenzierbar bezüglich sind.
Das Paar
heißt ein zulässiger Steuerungsprozess in der Aufgabe (5.2)–(5.4),
falls dem System (5.3) zu genügt.
Mit bezeichnen wir die Menge der zulässigen Steuerungsprozesse.
Ein zulässiger Steuerungsprozess ist eine
starke lokale Minimalstelle
der Aufgabe (5.2)–(5.4),
falls eine Zahl derart existiert, dass die Ungleichung
für alle
mit gilt.
Ausgehend von der Gleichung (5.1) werden wir zwei Varianten des Pontrjaginschen Maximumprinzips formulieren.
Die erste Variante spiegelt einen “unverfälschten” Charakter wider.
Aufgrund (5.1) entsteht in eine Sprung-Transversalitätsbedingung.
Daraus resultiert als eine Folgerung die zweite Variante.
Sie ermöglicht einen Vergleich mit Optimalitätsbedingungen in Standardreferenzen.
Für die Aufgabe (5.2)–(5.4) lautet die “unverfälschte” Pontrjagin-Funktion
Theorem 5.2 (Pontrjaginsches Maximumprinzip).
Da die Adjungierte stetig und stückweise stetig differenzierbar ist, sowie in die Sprung-Transversalitätsbedingung (5.6) erfüllt ist, ergibt sich mit der Beziehung (5.1) der Zusammenhang
Setzen wir in stetig fort, so erhalten wir die Pontrjagin-Funktion
Da in der Pontrjagin-Funktion die Sprung-Bedingung in bereits zur Anwendung kam, ergeben sich als Folgerung zu Theorem 5.2 die Bedingungen:
Theorem 5.3 (Pontrjaginsches Maximumprinzip).
5.3 Diskussion und Ökonomische Deutung
Die Pontrjagin-Funktion als Riemann-Integral mit Randterm
stellt eine Verallgemeinerung der Pontrjagin-Funktion dar,
was dem verallgemeinerten Charakter der Aufgabe (5.2)–(5.4)
zur Aufgabe (1.1)–(1.3) entspricht.
Tatsächlich liefert Theorem 5.3 eine Erweiterung von Theorem 1.2 in Abschnitt 1:
Mit der Abbildung ohne einer “äußeren” Zeitvariablen
besitzt die Aufgabe (5.2)–(5.4) die Gestalt
der Aufgabe (1.1)–(1.3).
Zusammen mit der Transversalitätsbedingung in erhält die Pontrjagin-Funktion die Form
und Theorem 5.3 liefert die notwendigen Bedingungen (1.5)–(1.7).
Der Randterm in der Pontrjagin-Funktion war die Konsequenz aus der Umformung (5.1) des Stieltjes-Integral.
Für die adjungierte Funktion steht sie im Bezug zur Transversalitätsbedingung in ,
über die wir nun Anmerkungen treffen:
In der Literatur, z. B. bei Feichtinger & Hartl [4] oder Kamien & Schwartz [10],
wird die adjungierte Gleichung (5.8) häufig in der Form
angegeben.
Bis auf den Randterm korrespondiert dabei die Funktion mit der Ableitung der Adjungierten in Gleichung (5.8).
Diese Fehlinterpretation von als Adjungierte anstelle der Ableitung der Adjungierten führt zu unzutreffenden Transversalitätsbedingungen.
Bei Kamien & Schwartz [10] wird keine Transversalitätsbedingung für angegeben.
Jedoch stellen Feichtinger & Hartl [4] bei einer Aufgabe mit dem gemischten Zielfunktional (5.2)
die Transversalitätsbedingung auf.
Da aber mit korrespondiert,
hat ein fehlender Wiedergewinnungswert die Transversalitätsbedingung zur Folge.
Im Abschnitt 5.6 über optimale Werbestrategien erweist sich die Transversalitätsbedingung für als fehlerhaft.
Die “unverfälschte” Pontrjagin-Funktion gibt Anlass zu der folgenden ökonomischen Deutung:
In Verallgemeinerung zu Abschnitt 1.3,
wo die Profitrate aus direktem
und indirektem Gewinn bemisst,
enthält den Erwartungswert
zum Gewicht über die gesamte künftige Entwicklung des indirekten Gewinnes.
5.4 Der Beweis des Maximumprinzips
Der folgende Beweis bezieht sich auf das Pontrjaginsche Maximumprinzip 5.2. Im Weiteren schreiben wir der Kürze halber
In Theorem 5.2 bringen wir mit Hilfe der Beziehung (5.1) die adjungierte Gleichung (5.5) zur Sprung-Transversalitätsbedingung (5.6),
| (5.11) |
in die Form
| (5.12) | |||||
Wir setzen . Dann erfüllt die adjungierte Gleichung (5.8) in Theorem 5.3:
Da sämtliche Abbildungen stetig und stetig differenzierbar bezüglich sind, und stückweise stetig ist,
existiert nach Lemma B.3 eine eindeutige Lösung der adjungierten Gleichung (5.8)
zur Transversalitätsbedingung (5.9).
Daher erfüllt die Funktion mit und , ,
die adjungierte Gleichung (5.5) zur Sprung-Transversalitätsbedingung (5.6).
Genauso wie im Abschnitt 1.2 betrachten wir die einfache Nadelvariation
und es bezeichne , , die eindeutige Lösung der Gleichung
Im Folgenden untersuchen wir für den Grenzwert
Nach den Sätzen B.9–B.13 über die Stetigkeit und Differenzierbarkeit der Lösung einer Integralgleichung in Abhängigkeit von den Anfangsdaten ergibt sich für im Grenzwert die lineare Integralgleichung
| (5.13) | |||||
Mit der adjungierten Gleichung (5.11) in der Form (5.12) erhalten wir für :
| (5.14) | |||||
Im ersten Term in (5.14) liefert (5.13) den Zusammenhang
Im zweiten Term in (5.14) ergibt sich durch Vertauschen der Integrationsreihenfolge und der Variablenbezeichnung von und
Damit lassen sich die ersten beiden Terme zusammenfassen und führen zu
In der Gleichung (5.13) gilt für
und es folgt für den dritten Term in (5.14) die Beziehung
Diese Umformungen ergeben für (5.14) die Darstellung
In dieser Gleichung bringen wir auf die linke Seite. Beachten wir nun die Transversalitätsbedingung , dann folgt
| (5.15) |
Da ein starkes lokales Minimum ist, gilt (vgl. Abschnitt 1.2)
Mit (5.15) und der Setzung von in (5.13) ergibt sich hieraus die Ungleichung
| (5.16) | |||||
Unter Verwendung von und der Beziehung (5.1) gelten
Damit ist (5.16) gleichbedeutend mit der Ungleichung
Da ein beliebiger Stetigkeitspunkt von und ein beliebiger Punkt der Menge war, zeigt diese Ungleichung die Gültigkeit der Maximumbedingung (5.10).
5.5 Hinreichende Bedingungen nach Arrow
Wir gehen nun auf hinreichende Bedingungen nach Arrow
für die Aufgabe (5.2)–(5.4) ein.
Dabei geben wir zwei Varianten an, die sich auf die Darstellungen der Optimalitätsbedingungen der Theoreme
5.2 und 5.3 beziehen.
Für sei wieder .
Die erste Variante der hinreichenden Bedingungen bezieht sich auf Theorem 5.2.
Hier lautet die zugehörige “unverfälschte” Pontrjagin-Funktion
und es ergibt sich die Hamilton-Funktion
Theorem 5.4.
Die zweite Variante der hinreichenden Bedingungen beruht auf Theorem 5.3. In diesem Fall hat die Pontrjagin-Funktion die Form
und die Hamilton-Funktion erhält die Gestalt
Theorem 5.5.
Mit den Anmerkungen in Abschnitt 5.2,
die mittels der Beziehung 5.1 die Verbindungen zwischen den Pontrjagin-Funktionen
und herstellen,
ist es ausreichend den Nachweis der hinreichenden Bedingungen für das Theorem 5.4 zu führen.
Beweis Es sei so gewählt,
dass die Maximumbedingung (5.7) zu diesem Zeitpunkt erfüllt ist.
Mit den gleichen Argumenten wie im Abschnitt 1.4 folgt aus der Konkavität der
Hamilton-Funktion die Gültigkeit der Ungleichung
für alle . Weiterhin besitzt die Funktion
in dem inneren Punkt ein globales Maximum über und deswegen gilt
Nach der adjungierten Gleichung (5.5) stimmt mit für fast alle überein und es gilt damit über der Menge die Ungleichung
| (5.17) |
Ferner ist für einen zulässigen Steuerungsprozess nach (5.3):
| (5.18) |
Es sei mit . Dann gilt
Wir ändern im zweiten Ausdruck die Integrationsreihenfolge:
Ferner folgt aus der Konvexität der Abbildung für alle die Ungleichung
Unter Verwendung von (5.17) und (5.18) erhateln wir
| (5.19) | |||||
Nach Theorem 5.2 ist stückweise stetig differenzierbar und erfüllt in die Sprung-Transversalitätsbedingungen (5.6). Demnach ergeben sich mit Formel (5.1):
Unter Beachtung dieser Gleichungen führt die Beziehung (5.19) zu der Ungleichung
Da ferner der Anfangswert in (5.3) fest vorgegeben ist, ergibt sich
für alle mit . Somit ist ein starkes lokales Minimum der Aufgabe (5.2)–(5.4).
5.6 Optimale Werbestrategien
Werbekampagnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Absatz nicht unmittelbar, sondern mit einer zeitlichen Verzögerung beeinflussen. In Anlehnung an Feichtinger & Hartl [4] betrachten wir das Modell (vgl. Abschnitt 1.6):
| (5.20) | |||
| (5.21) | |||
| (5.22) |
Dabei sei über stetig, differenzierbar und streng monoton wachsend mit
Für diese Aufgabe stellen wir die Optimalitätsbedingungen (5.8)–(5.10) von Theorem 5.3 auf. Da die Zustandsvariable linear in die Aufgabe einfließt, sind die Bedingungen des Maximumprinzips hinreichend. Die Pontrjagin-Funktion besitzt die Form
| (5.23) | |||||
Mit (5.23) erhalten wir für die adjungierte Gleichung
| (5.24) |
Ferner führt die Maximumbedingung
zu der Beziehung
Damit gelangen wir zu der Gleichung
| (5.25) |
Zur Auswertung der Optimalitätsbedingungen (5.24) und (5.25) stellen wir den Bezug zur Aufgabe (1.45)–(1.47) her:
Die Differentation der Integralgleichung (5.21) nach ergibt
und die Aufgabe (5.20)–(5.22) ist äquivalent zu dem Modell (1.45)–(1.47) über optimale Werbestrategien in Abschnitt 1.6. Wir nutzen im Weiteren die Lösungstruktur der Aufgabe (1.45)–(1.47), in welcher nach (1.52)–(1.54) die adjungierte Gleichung
| (5.26) |
die Lösung
| (5.27) |
besitzt und aus der Maximumbedingung die Beziehung
| (5.28) |
resultiert.
Der Vergleich von (5.25) und (5.28) ergibt den Zusammenhang
Durch Differentation der ersten Gleichung nach erhalten wir weiter
Es gilt damit , was der adjungierten Gleichung (5.24) mit Transversalitätsbedingung entspricht. Unter Verwendung von (5.27) liefert die Berechnung von
die explizite Darstellung der Adjungierten .
Abschließend entnehmen wir dem Abschnitt 1.6 über die Steuerung die Ergebnisse
Damit ist unsere Untersuchung der Aufgabe (5.20)–(5.22) beendet.
Anhang A Funktionalanalytische Hilfsmittel
A.1 Banachräume und Räume stetiger Funktionen
Es sei ein reeller Vektorraum.
Definition A.1 (Normierter Raum).
Eine Abbildung heißt eine Norm,
falls sie für alle und alle folgende Eigenschaften besitzt:
(1)
Definitheit:
,
(2)
absolute Homogenität:
,
(3)
Dreiecksungleichung:
.
Das Paar bildet einen normierten Raum.
Definition A.2 (Cauchyfolge).
Die Folge des normierten Raumes ist eine Cauchyfolge, falls es zu jedem eine Zahl gibt mit für alle .
Definition A.3 (Konvergente Folge).
Die Folge konvergiert in gegen , falls es zu jedem eine Zahl gibt mit für alle .
Definition A.4 (Banachraum).
Ein normierter Raum, in dem jede Cauchyfolge konvergiert, heißt vollständig. Ein vollständiger normierter Raum heißt Banachraum.
Lemma A.5.
Ein abgeschlossener Unterraum eines Banachraumes ist vollständig.
Beweis Es seien der Unterraum des Banachraumes und eine Cauchyfolge in .
Da vollständig ist, besitzt die Folge einen Grenzwert .
Wegen der Abgeschlossenheit von muss in liegen.
Wir geben nun Beispiele von normierten Räumen und von Banachräumen an.
Dabei verwenden wir die Schreibweise statt , um den Charakter als Funktionen hervorzuheben.
Ferner seien die Definitionsbereiche der Funktionsklassen stets nichtleere Mengen.
(1.) Der Raum der über dem Intervall beschränkten Funktionen
ist versehen mit der Supremumsnorm
ein Banachraum.
Bezüglich der Supremusnorm gilt für alle .
Es sei eine Cauchyfolge in .
Dann bildet für jedes die Folge eine Cauchyfolge in und besitzt damit einen Grenzwert .
Nun ist zu zeigen, dass die resultierende Funktion beschränkt und Grenzwert der Cauchyfolge ist.
Es sei gegeben. Dann existiert eine Zahl mit für alle .
Für gibt es eine Zahl mit . Damit ergibt sich
für alle . Da beliebig war, gilt
d. h. ist beschränkt. Ferner liefert die Argumentation für alle ,
d. h. ist Grenzwert der Folge .
(2.) Der Raum der über dem Intervall beschränkten stetigen Funktionen ist versehen mit der Supremumsnorm
ein Banachraum.
Nach Lemma A.5 ist die Abgeschlossenheit von im Raum zu zeigen:
der Grenzwert einer gleichmäßig konvergenten Folge stetiger Funktionen liefert eine stetige Funktion.
Es bezeichne den Grenzwert der gleichmäßig konvergenten Folge aus .
Zu wählen wir ein mit .
Sei . Wegen der Stetigkeit von gibt es ein mit
für alle mit .
Damit folgt
für alle mit , also die Stetigkeit von in .
(3.) Der Raum der stetigen Funktionen
über dem kompakten Intervall ist versehen mit der Supremumsnorm ein Banachraum.
Nach dem Satz von Weierstraß ist jede stetige Funktion über einer kompakten Menge beschränkt.
Also ergibt sich die Vollständigkeit wie im vorhergehenden Beispiel.
(4.) Der Raum der stetigen und im Unendlichen konvergenten Funktionen ist versehen mit der Supremumsnorm
ein Banchraum.
Eine Funktion konvergiert im Unendlichen gegen ,
wenn es zu jedem eine Zahl gibt mit für alle .
Der erweiterte reelle Halbstrahl ist unter der stetigen und bijektiven Abbildung
topologisch gleichwertig zu dem kompakten Intervall .
Damit ist topologisch äquivalent zu bzw. ,
und nach vorherigem Beispiel versehen mit der Supremumsnorm ein Banachraum.
(5.) Der Raum der stückweise stetigen Funktionen
über dem Intervall ist versehen mit der Supremumsnorm
nicht vollständig.
Nach Definition 0.1 besitzen die Elemente des Raumes höchstens endlich viele Unstetigkeitsstellen.
Wir betrachten über die Funktionen und mit
Die Funktionen sind stückweise konstant und besitzen Sprungstellen , ,
wohingegen abzählbar viele Sprungstellen aufweist.
Für gilt , sowie .
Daher ist eine Cauchyfolge in , die gegen konvergiert.
(6.) Der Raum der über dem Intervall stückweise stetig differenzierbaren Funktionen
ist bezüglich
der Norm nicht vollständig.
Dazu betrachte man lediglich für die Ableitung die Folge in letztem Punkt.
A.2 Fixpunktsätze
Satz A.6 (Fixpunktsatz von Weissinger).
Es sei eine nichtleere abgeschlossene Teilmenge des Banachraumes ,
ferner seien die Glieder einer konvergenten Reihe positiver Zahlen und
eine Selbstabbildung von mit für alle und .
Dann besitzt genau einen Fixpunkt , d. h. einen Punkt mit .
Dieser Fixpunkt ist Grenzwert der Iterationsfolge bei beliebigem Startwert .
Schließlich gilt die Fehlerabschätzung
.
Beweis Wir betrachten die Folge . Für diese gilt
und folglich für
Da die Reihe mit Folgengliedern konvergiert, wird die Summe für jedes kleiner als ein beliebig vorgegebenes wird, wenn nur hinreichend groß ist. Dies zeigt, dass die Iterationsfolge eine Cauchyfolge bildet. Wegen der Vollständigkeit von konvergiert diese Folge gegen ein , und gehört zur Menge , da abgeschlossen ist. Es ist der gesuchte Fixpunkt. Denn einerseits ist und andererseits folgt wegen , dass gilt. Daher muss sein. Ist ein weiterer Fixpunkt von , so ist
mit einem beliebigem . Da notwendig eine Nullfolge sein muss, ergibt sich . Führen wir abschließend in obiger Ungleichung den Grenzübergang aus,
so ergibt sich die behauptete Fehlerabschätzung.
Satz A.7 (Banachscher Fixpunktsatz).
Es sei eine nichtleere abgeschlossene Teilmenge des Banachraumes und eine kontraktive Selbstabbildung von , d. h. für alle mit einer Zahl . Dann besitzt genau einen Fixpunkt .
Beweis Es gilt und der Banachsche Fixpunktsatz erweist sich als Spezialfall des Fixpunktsatzes von Weissinger mit .
A.3 Stetige lineare Abbildungen
Es seien normierte Räume. Dann bezeichnet die Menge der stetigen linearen Abbildungen . Eine Abbildung erfüllt eine der folgenden äquivalenten Bedingungen:
-
(i)
Aus folgt .
-
(ii)
Zu jedem und jedem existiert ein mit
-
(iii)
Für alle offenen ist das Urbild offen in .
Die Bedingung (i) beschreibt die Folgenstetigkeit, (ii) das Kriterium und (iii) die Stetigkeit in der Topologie.
Lemma A.8.
Insbesondere sind für lineare Abbildungen äquivalent:
-
(a)
ist stetig, d. h. ist in jedem Punkt stetig.
-
(b)
ist in stetig.
-
(c)
ist beschränkt, d. h. es existiert eine Zahl mit für alle .
Beweis Die Beweiskette (c)(a)(b) ist offensichtlich:
Ist (c) erfüllt, so ergibt sich wegen für alle die Stetigkeit von ,
und die Stetigkeit in (a) impliziert unmittelbar die Stetigkeit in jedem Punkt .
Um den Implikationskreis zu schließen, zeigen wir (b)(c):
Angenommen, (c) würde nicht gelten.
Dann gibt es eine Folge in mit .
Wir setzen .
Dann gelten und .
Obwohl eine Nullfolge ist, gilt , im Widerspruch zur Stetigkeit von in .
Definition A.9.
Für wird die kleinste Zahl , mit der Lemma A.8 erfüllt ist, mit bezeichnet:
Satz A.10.
Die Zahl definiert eine Norm auf dem Raum und es gelten
Definition A.11 (Operatornorm).
Für wird die Zahl als die Operatornorm von bezeichnet.
A.4 Differenzierbarkeit in normierten Räumen, implizite Funktionen
Es seien normierte Räume, offen und eine Abbildung.
Definition A.12 (Fréchet-differenzierbare Abbildung).
Existiert in der gleichmäßige Grenzwert
| (A.1) |
mit einer stetigen linearen Abbildung , dann heißt die Abbildung in Fréchet-differenzierbar und die Fréchet-Ableitung von in .
Der Grenzwert (A.1) konvergiert gleichmäßg, falls es zu jedem ein gibt mit
Lemma A.13.
Eine Abbildung ist in genau dann Fréchet-differenzierbar, falls ein und eine Abbildung mit
Definition A.14 (Stetig differenzierbare Abbildung).
-
(a)
Die Abbildung ist in stetig differenzierbar, wenn für alle Punkte einer offenen Umgebung des Punktes die Ableitung existiert und die Abbildung bezüglich der Operatornorm des Raumes in stetig ist.
-
(b)
Die Abbildung ist auf der offenen Menge stetig differenzierbar, wenn für alle die Ableitung existiert und die Abbildung bezüglich der Operatornorm des Raumes auf stetig ist.
In Folgenden bezeichnet die Bildmenge der Abbildung .
Definition A.15 (Reguläre Abbildung).
Die Abbildung nennen wir im Punkt regulär, wenn sie in diesem Punkt Fréchet-differenzierbar ist und gilt.
Satz A.16 (Satz über implizite Funktionen).
Es seien , und Banachräume, eine Umgebung des Punktes und
eine stetig differenzierbare Abbildung.
Ferner sei und es sei die partielle Ableitung ein linearer Homöomorphismus.
Dann gibt es auf einer Umgebung von eine stetig differenzierbare Abbildung nach derart,
dass erfüllt ist, sowie für jedes die Gleichung und die Beziehung
gelten.
Anhang B Differentialgleichungen, Volterrasche Integralgleichungen
Die Lehrbücher zu gewöhnlichen Differentialgleichungen behandeln vorrangig den Fall stetiger rechter Seiten.
Da in Steuerungsproblemen die rechte Seite der Dynamik für einen Steuerungsprozess typischerweise nicht stetig,
sondern stückweise stetig in der Zeitvariablen ist, und somit die Rahmenbedingungen von der Standardtheorie abweichen,
stellen wir die benötigten Resultate ausführlich dar.
Die Ideen zu den grundlegenden Sätzen für Differentialgleichung mit stückweise stetigen rechten Seiten und für Volterrasche Integralgleichungen
sind eng verknüpft mit der bekannten Theorie zu gewöhnlichen Differentialgleichungen.
Deswegen halten wir uns eng an das Lehrbuch zu gewöhnlichen Differentialgleichungen von Heuser [7] und
an der Monographie [9] von Ioffe & Tichomirov.
B.1 Lineare Gleichungen
Es sei eine Vektorfunktion und eine matrixwertige Abbildung. Im Weiteren betrachten wir lineare Integralgleichungssysteme der Form
| (B.1) | |||||
| (B.2) |
und das lineare Differentialgleichungssystem
| (B.3) |
Offensichtlich sind (B.3) ein Spezialfall von (B.2) und (B.2) ein Spezialfall von (B.1). Demzufolge basiert die eindeutige Lösbarkeit der Gleichungen (B.2) und (B.3) auf den Betrachtungen zur Gleichung (B.1). In die Gleichung (B.1) fließt in die Abbildung die Integrationsvariable und die obere Integrationsgrenze ein. Die Konsequenz daraus ist der zweidimensionale Zeitbereich
| (B.4) |
Aufgrund ihrer Einflüsse nennen wir die äußere und die innere Zeitvariable. In den Gleichungen (B.2), (B.3) tritt die äußere Zeitvariable nicht auf und die innerere Variable bezeichnet schlicht die Zeit. Im Fall der Steuerung von Integralgleichungen besteht weiterhin der Umstand stückweiser Stetigkeit, und zwar bezüglich der inneren Zeitvariablen. Wir werden diese Eigenschaft für die Abbildung genauer beschreiben. Es seien die Zeitpunkte gegeben. Dann setzen wir
| (B.5) |
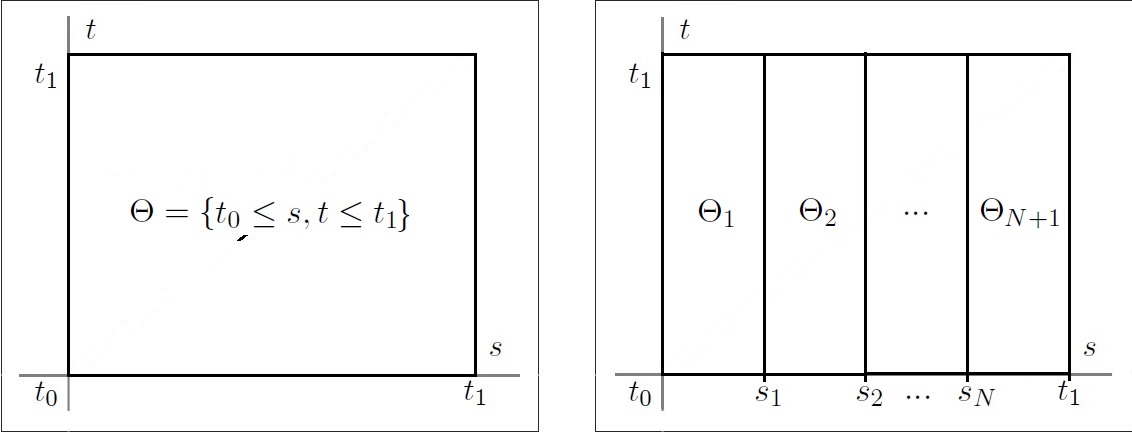
und die disjunkte Zerlegung des Zeitbereichs mit den Mengen
| (B.6) |
Definition B.1 (Stückweise stetige Abbildung).
Die Abbildung heißt über dem Zeitbereich stetig in und stückweise stetig in , wenn es endlich viele Stellen derart gibt, dass für jedes über der kompakten Mengen eine stetige Abbildung existiert mit für alle .
Satz B.2.
Es sei die Abbildung stetig in und stückweise stetig in . Weiter sei . Dann existiert zu jedem und jedem eine eindeutig bestimmte Lösung der Gleichung
Beweis Wir bemerken zunächst,
dass zu der stetigen und stückweise stetigen Abbildung für jedes
der Wert existiert.
Weiterhin folgt aus der Stetigkeit der Abbildungen über den Mengen in Definition B.1,
dass die Funktion stückweise stetig über ist.
Im Folgenden werden wir zeigen,
dass die Fixpunktgleichung , wobei der Operator durch
gegeben wird, stets eine eindeutige Lösung besitzt. Der Operator bildet den Raum in sich ab. Mit der Funktion setzen wir zur abkürzenden Schreibweise
Bei mehrfacher Anwendung des Operators ergeben sich für die Beziehungen
In der Topologie des Raumes gilt daher
Die Zahlen liefern eine Folge, deren Reihe konvergiert. Nach dem Fixpunktsatz von Weissinger (Satz A.6) existiert daher genau ein mit .
Lemma B.3.
Unter den Annahmen in Satz B.2 besitzt die Gleichung
zu jedem und jedem eine eindeutig bestimmte Lösung .
Beweis In Abschnitt A.1 haben wir bemerkt,
dass der Raum bezüglich der Supremumsnorm nicht vollständig ist.
Um auf die gleiche Weise wie bei Satz B.2 vorgehen zu können,
betten wir die Situation in den Raum der messbar und beschränkten Funktionen ein.
Da dies die einzige Stelle in dieser Ausarbeitung ist,
an der wir auf diesen Rahmen zurückgreifen,
verweisen wir hier bezüglich einer Einführung der Räume auf die Lehrbücher [8] von Heuser oder [17] von Werner.
Der Raum ist versehen mit der wesentlichen Supremumsnorm vollständig.
Ersetzt man im Beweis von Satz B.2 die Norm durch ,
so ergibt sich wortwörtlich die eindeutige Lösung der Gleichung
Darin sind die Abbildungen stetig und stückweise stetig. Demzufolge muss über stückweise stetig sein.
Lemma B.4.
Es seien und . Dann existiert zu jedem und jedem eine eindeutig bestimmte Lösung der Gleichung
Beweis Dies folgt unmittelbar aus Satz B.2.
Lemma B.5.
Es seien und über jedem endlichen Intervall stückweise stetig, und es sei und über integrierbar. Dann existiert zu jedem und jedem eine eindeutig bestimmte Lösung der Gleichung
Beweis Da für jedes der Grenzwert im Unendlichen existiert, können wir mit dem Banachraum der stetigen Funktionen über dem Abschluss identifizieren (vgl. Abschnitt A.1). Wir ersetzen im Beweis von Satz B.2 das Intervall durch . Ferner seien der Operator wie dort definiert und
Bei mehrfacher Anwendung des Operators ergibt sich für :
Die Zahlen liefern eine Folge, deren Reihe konvergiert. Nach dem Fixpunktsatz von Weissinger existiert daher genau ein mit .
Lemma B.6.
Es seien die Voraussetzungen in Lemma B.4 erfüllt. Dann existiert zu jedem und jedem eine eindeutige Lösung der Gleichung
Beweis Wir merken an, dass in Lemma B.4 der Integrand stückweise stetig ist. Daher folgt unmittelbar aus Lemma B.4 mit .
Lemma B.7.
Es seien die Voraussetzungen in Lemma B.5 erfüllt. Dann existiert zu jedem und jedem eine eindeutige Lösung der Gleichung
Beweis Die Behauptung folgt aus Lemma B.5, wenn wir setzen.
B.2 Existenz und Eindeutigkeit, Abhängigkeit von Anfangsdaten
Wir widmen unser Interesse nun den nichtlinearen Differentialgleichungen der Form
| (B.7) |
und den nichtlinearen Volterraschen Integralgleichungen der Gestalt
| (B.8) |
Da sich die Differentialgleichung (B.7) in der äquivalenten Form
| (B.9) |
als Spezialfall von (B.8) erweist, konzentrieren wir uns auf die Integralgleichung.
Dementsprechend sind für die Gleichung (B.9) die nachstehenden Resultate lediglich ohne der äußeren Zeitvariablen
zu formulieren und zu übernehmen.
Wir treffen für die weiteren Untersuchungen folgende Festlegungen:
-
(1)
Für und sei der kompakte Umgebungsstreifen
Ferner bezeichne die offene Kugel .
-
(2)
Die Abbildung sei auf der Menge in der Variablen gleichmäßig stetig und gleichmäßig stetig differenzierbar, d. h. es gibt eine positive Konstante mit
für alle .
-
(3)
Die Abbildungen und seien auf der Menge in der Variablen stetig und in der Variablen stückweise stetig (vgl. Definition B.1).
-
(4)
Die Abbildungen und seien über beschränkt und es gelten über mit der positiven Konstanten .
Satz B.8 (Lokaler Fixpunkt).
Zu jedem inneren Punkt der Menge gibt es Zahlen und derart, dass über dem Intervall die Abbildung
für jedes mit genau einen Fixpunkt besitzt. Unter diesen Voraussetzungen gilt ferner für die Fixpunkte der Abbildung zu den Funktionen die Ungleichung
Beweis Wir wählen die positiven Zahlen und so, dass
| (B.10) |
gelten und weiterhin die Beziehungen und erfüllt sind.
Wir betrachten im Raum die abgeschlossene und konvexe Teilmenge
Es sei mit . Für und gilt dann
d. h., die Abbildung bildet die Menge in sich ab. Ferner gilt für
d. h., die Abbildung ist wegen kontrahierend.
Nach dem Banachschen Fixpunktsatz besitzt die Abbildung einen eindeutigen Fixpunkt .
Es seien die Funktion mit
, und
es seien die zugehörigen Fixpunkte der Abbildung .
Dann gilt
Daraus ergibt sich abschließend
Der Satz B.8 ist damit vollständig nachgewiesen.
Satz B.9 (Lokaler Existenz-, Eindeutigkeits- und Stetigkeitssatz).
Zu jedem inneren Punkt der Menge gibt es Zahlen und ,
so dass zu jedem genau eine stetige Lösung der Gleichung (B.8) zur Anfangsbedingung
auf dem Intervall existiert.
Ist ferner eine Folge aus , die gegen konvergiert,
so gilt
und konvergiert auf gleichmäßig gegen .
Beweis Nach Satz B.8 können wir und so wählen, dass die Abbildung
für jedes genau einen Fixpunkt besitzt, d. h.
Die Existenz und Eindeutigkeit der Lösung ist damit gezeigt.
Weiter sei so gewählt, dass (B.10) erfüllt ist.
Es seien nun .
Dann existieren die Lösungen , der Gleichung (B.8)
über und nehmen Werte in der Menge an.
Nach Satz B.8 ist die Ungleichung
erfüllt,
welche die gleichmäßige Konvergenz von gegen für bedeutet.
Satz B.9 ist somit vollständig bewiesen.
Ist über eine Lösung der Gleichung (B.9),
so lässt sich formal durch
zu einer Lösung über fortsetzen. Im Fall von Gleichung (B.8) führt
im Allgemeinen nicht zu der gewünschten Fortsetzung. Stattdessen erfolgt eine Fortsetzung der Gleichung (B.8) an der Stelle nicht mit dem Anfangswert , sondern mit einer Funktion , für die gilt. Dieser Sachverhalt ist der Gegenstand der nachstehen Untersuchung:
Lemma B.10 (Lokale Fortsetzbarkeit).
Beweis Als Lösung der Gleichung (B.8) gilt für in die Beziehung
Damit bringen wir die Abbildung in die Form
| (B.12) |
Nun sieht man unmittelbar, dass für hinreichend kleine auf stetig ist und gilt. Daher kann zu jedem ein gewählt werden, dass über erfüllt ist. Nach Satz B.8 besitzt die Abbildung
für hinreichend kleine und genau einen Fixpunkt . Es gilt . Setzen wir zudem für , so ist eine Fortsetzung der Lösung von (B.8). Denn offenbar erfüllt für jedes die Gleichung (B.8). Für folgt
Damit löst die Gleichung für alle .
Ist umgekehrt eine fortgesetzte Lösung der Gleichung (B.8) von ,
d. h. für alle ,
so gilt für :
Damit wird nur durch die eindeutige Lösung von (B.11) fortgesetzt.
Satz B.11 (Globaler Existenz-, Eindeutigkeits- und Stetigkeitssatz).
Über sei eine stetige Lösung der Gleichung (B.8) zum Anfangswert ,
für die die Menge dem Inneren der Menge angehört.
Dann existiert ein derart,
dass für jedes die Gleichung
| (B.13) |
eine eindeutige stetige Lösung über besitzt und die Funktionen gleichmäßig gegen über für konvergieren.
Beweis Nach Satz B.9 gibt es ein und ein derart,
dass für jedes die Gleichung (B.13)
eine Lösung über besitzt und die Funktionen gleichmäßig gegen über für
konvergieren.
Im Weiteren sei durch das Supremum über alle mit dieser Eigenschaft definiert.
D. h. es gibt ein derart,
dass für jedes eine Lösung von (B.13) über existiert und
die Funktionen gleichmäßig gegen über für konvergieren.
Zum Beweis des Satzes ist es ausreichend, die Beziehung nachzuweisen.
Angenommen, es ist .
Dann ist ein innerer Punkt der Menge .
Nach Satz B.9 lässt sich zu jedem ein derart angeben,
dass für alle gilt.
Insbesondere konvergiert gegen gleichmäßig für
und es ist .
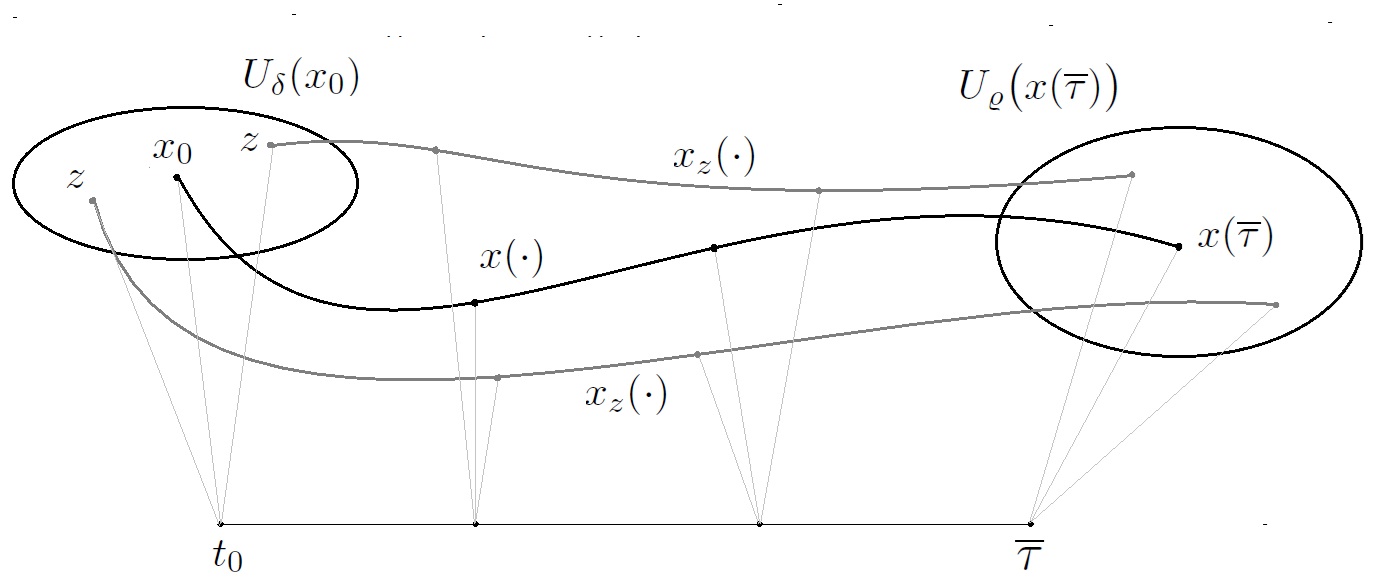
Sei zunächst die stetige Lösung von (B.13) über zu einem festen . Dann gibt es nach Lemma B.10 eine Zahl und eine stetige Fortsetzung von , welche die Gleichung (B.13) über löst. Die Fortsetzung ist für die Lösung der Gleichung
Es ist nun zu zeigen, dass zu jedem eine Kugel und ein so angeben lassen, dass für alle sich die Lösungen durch auf fortsetzen lassen und die Ungleichung
erfüllt ist. Denn dann konvergiert zusammen mit der zugehörigen Fortsetzung gleichmäßig über gegen die Lösung und deren Fortsetzung .
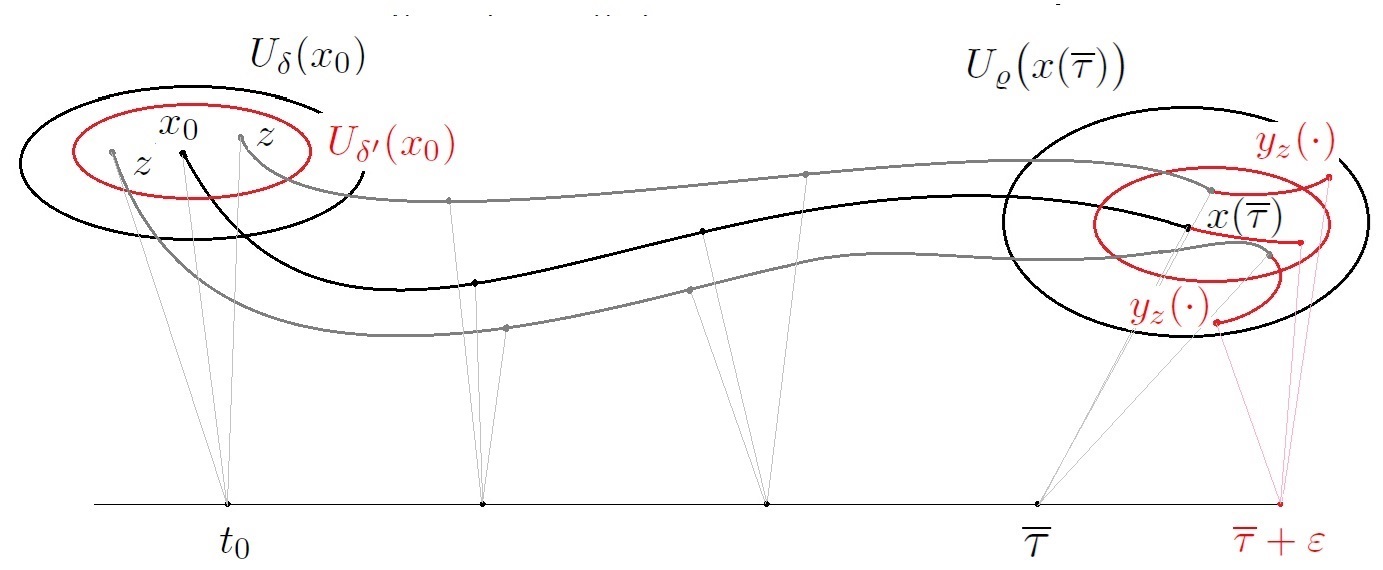
Nach Satz B.8 existieren und derart, dass die Abbildung für jedes stetige mit für alle genau einen Fixpunkt über besitzt. Weiterhin wählen wir mit und den Radius der Kugel mit
Die positiven Zahlen seien im Weiteren so vorgegeben. Ferner bezeichnen bzw. die Funktion, mit deren Hilfe die Fortsetzungen für gebildet werden:
Für ergeben sich mit den Darstellungen von und in der Form (B.12):
Mit Hilfe von Satz B.8 ergibt sich für die Fortsetzungen nun der Abstand
Dies zeigt, dass sich zu jedem positive Zahlen und so angeben lassen, dass über die Ungleichung für alle erfüllt ist; also die fortgesetzten Lösungen gleichmäßig gegen über für konvergieren. Daher muss gelten. Der Satz B.11 ist damit bewiesen.
Lemma B.12.
Es bezeichnet weiterhin . Ferner seien . Dann ist die Abbildung
über der offenen Menge stetig differenzierbar und es gilt für jedes und jedes :
Beweis Nach Voraussetzung ist die Abbildung für jedes auf einer Umgebung wohldefiniert. Weiterhin ist der lineare Operator wegen
beschränkt und somit stetig. Da nach unseren Annahmen die Abbildung in gleichmäßig stetig differenzierbar ist, gibt es zu und eine Zahl mit
für alle , für alle und alle . Weiter nutzen wir
Damit erhalten wir für alle und alle :
d. h., die Abbildung ist über der Menge Fréchet-differenzierbar. Wir zeigen noch die Stetigkeit der Abbildung über der Menge . Für gilt
Damit ist über der Menge stetig differenzierbar.
Satz B.13 (Differenzierbarkeitssatz).
Beweis Wir betrachten die Abbildung , die durch
definiert ist. Diese ist nach Lemma B.12 in einer Umgebung des Punktes nach stetig differenzierbar und besitzt die Ableitung
Es gilt , da Lösung (B.13) zum Anfangswert ist. Ferner stellt nach Lemma B.2 der Operator eine lineare homöomorphe Abbildung des Raumes in sich dar. Gemäß Satz A.16 über implizite Funktionen wird in einer hinreichend kleinen Umgebung des Punktes eine stetig differenzierbare Abbildung in den Raum definiert, für die gilt. Diese Abbildung ist in stetig differenzierbar. Die Bedingung bedeutet
d. h., dass diese Abbildung jedem Anfangswert die Lösung von (B.13) zuordnet. Demnach wird dadurch die Abbildung beschrieben und ist in stetig differenzierbar. Ihre Ableitung ordnet nach Satz A.16 jedem die Vektorfunktion
zu, wobei die Funktion mit liefert. Weiter lässt sich die Beziehung in die Form
bringen. Der Satz ist damit bewiesen.
Anhang C Konvexe Mengen und Funktionen
Definition C.1 (Konvexe Menge).
Die Menge heißt konvex, wenn für alle und der Punkt ebenfalls zu gehört.
Satz C.2 (Trennungssatz).
Es sei eine abgeschlossene und konvexe Menge. Ferner sei ein Randpunkt der Menge . Dann exisitiert ein nichttrivialer Vektor mit für alle .
Definition C.3 (Epigraph).
Es sei eine Funktion. Dann heißt die Menge der Epigraph der Funktion .
Definition C.4 (Konvexe Funktion).
Die Funktion ist konvex, wenn der Epigraph eine konvexe Menge ist.
Lemma C.5 (Jensensche Ungleichung).
Eine Funktion ist genau dann konvex, wenn die Ungleichung für alle und alle gilt.
Satz C.6 (Stetigkeit konvexer Funktionen).
Es sei eine konvexe Funktion über der offenen Menge . Die Funktion ist genau dann in dem Punkt stetig, wenn sie auf einer Umgebung dieses Punktes nach oben beschränkt ist.
Beweis: Ist in stetig, so ist sie nach Definition der Stetigkeit auf einer Umgebung von beschränkt.
Umgekehrt nehmen wir zur Vereinfachung und an.
Es sei eine offene Kugel mit Radius um ,
auf der nach oben durch beschränkt ist:
für alle .
Wir wählen hinreichend klein und betrachten
Wir zeigen nun für alle .
Da beliebig klein sein kann, bedeutet dies die Stetigkeit von in .
Es sei .
Dann ist und wegen der Konvexität von folgt mit der Jensenschen Ungleichung einerseits
Andererseits ist , da als eine Kugel mit Radius um den Nullpunkt gewählt wurde. Es ergibt sich die Beziehung
also
und damit die Stetigkeit von in .
Literatur
- [1] Aseev, S.M., Kryazhimskii, A.V.: The Pontryagin Maximum Principle and Optimal Economic Growth Problems. Proc. Steklov Inst. Math., 257, 1–255 (2007).
- [2] Dockner E., Feichtinger, G., Mehlmann, A.: Noncooperative Solutions for a Differential Game Model of Fishery. Journal of Economic Dynamics and Control 13, 1–20 (1989).
- [3] Dorfman, R.: An economic interpretation of optimal control theory. AER 59 (1969).
- [4] Feichtinger, G., Hartl, R.F.: Optimale Kontrolle ökonomischer Prozesse. de Gruyter; Berlin - New York (1986).
- [5] Göllmann, L., Maurer, H.: Optimal control problems with time delays: Two case studies in biomedicine. Mathematical Biosciences & Engineering 15(5), 1137–1154 (2018).
- [6] Halkin, H.: Necessary conditions for optimal control problems with infinite horizons. Econometrica 42, 267–272 (1974).
- [7] Heuser, H.: Gewöhnliche Differentialgleichungen. 3. Auflage. Teubner Stuttgart 1995.
- [8] Heuser, H.: Funktionalanalysis. 3. Auflage. B. G. Teubner Stuttgart 1992.
- [9] Ioffe, A.D., Tichomirov, V.M.: Theorie der Extremalaufgaben. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin, (1979).
- [10] Kamien, M.I., Schwartz, N.L.: Dynamic Optimization: The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management. North-Holland, New York (1981).
- [11] Lancaster, K.: The dynamic inefficiency of capitalism. Journal of Political Economy 81, 1092–1109 (1973).
- [12] Pesch, H.J., Plail, M.: The Maximum Principle of optimal control: A history of ingenious ideas and missed opportunities. Control and Cybernetics 38 (2009).
- [13] Plail, M.: Die Entwicklung der optimalen Steuerungen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (1998).
- [14] Ramsey F.P.: A Mathematical Theory of Saving. Econ. J. 38, 543–559 (1928).
- [15] Rihan, F., Abdelrahman, D.H., Al-Maskari, F., Ibrahim, F.,Abdeen, M.A.: Delay differential model for tumour-immune-response with chemoimmunotherapy and optimal control. Computational and Mathematical Methods in Medicine, Hindawi Publishing Corporation, Vol. 2014, Article ID 982978, (2014).
- [16] Seierstad, A., Sydsæter, K.: Optimal Control Theory with Economic Applications. North-Holland Amsterdam-New York-Oxford-Tokyo, (1987).
- [17] Werner, D.: Funktionalanalysis. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York, (1995).