Suszeptibilitätseffekte in der Kernspinresonanzbildgebung
Dissertation zur Erlangung des
naturwissenschaftlichen Doktorgrades
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
vorgelegt von
Christian H. Ziener
aus Weimar
Würzburg 2008
Vorwort
Aufgabe der Naturwissenschaft ist es nicht nur die Erfahrung zu erweitern,
sondern in diese Erfahrung eine Ordnung zu bringen.
Niels Bohr
Die Prinzipien der Kernspinresonanz haben sich in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen Werkzeug für verschiedene Naturwissenschaften entwickelt. Die Anwendungsgebiete reichen heute von der Physik über die Chemie und die Biologie bis hin zur Medizin. Grundlage zum Verständnis der NMR-Techniken sind physikalische Modelle, die den relevanten Fragestellungen angepasst und gegebenenfalls erweitert werden müssen. Daher ist es unverzichtbar, dass sowohl numerische Simulationen und analytische Rechnungen als auch experimentelle Untersuchungen das entwickelte physikalische Modell bestätigen und neue Aspekte eröffnen. So konnten in dieser Arbeit interdisziplinäre Fragestellungen der Biophysik durch Analogieschlüsse zu anderen Gebieten der Physik bearbeitet und schließlich in einem allgemeinen Kontext dargestellt werden.
An dieser Stelle möchte ich mich bei denen bedanken, die direkt oder indirekt zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Insbesondere danke ich meinem Betreuer Prof. Dr. Dr. Wolfgang Bauer für die sehr gute Betreuung. Die Diskussionen mit ihm, seine Anregungen und Ideen waren mir eine große Hilfe. Ganz besonders möchte ich mich bei Prof. Dr. Peter Jakob dafür bedanken, dass er meine Arbeit stetig unterstützt hat, viele Ideen und Anregungen geliefert hat und jederzeit für Diskussionen zur Verfügung stand. Für viele Hinweise und Ratschläge bezüglich einiger mathematisch interessanter Fragestellungen möchte ich Prof. Dr. Georg Reents vom Institut für Theoretische Physik und Astrophysik danken.
Besonderer Dank gebührt der Schering-Stiftung, die einen wesentlichen Teil zum Gelingen dieser Arbeit beitrug. Als Stipendiat der Schering-Stiftung bot sich mir die Möglichkeit, mit anderen Wissenschaftlern in Kontakt zu treten, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam über Probleme zu diskutieren. Erforderliches interdisziplinäres und vernetztes Denken und Arbeiten wurde dadurch nachhaltig gestärkt. Besonders möchte ich ganz herzlich Frau Dr. Monika Lessl und Frau Ines Stöhr von der Schering-Stiftung danken.
Dem Berufsverband Deutscher Internisten, insbesondere Herrn Dr. Wolfgang Wesiack danke ich für die Aufnahme in das studentische Förderprogramm.
Im Rahmen des an der Universität Würzburg neu etablierten Sonderforschungsbereiches 688 „Mechanismen und Bildgebung von Zell-Zell-Wechselwirkungen im kardiovaskulären System“ war es möglich, die Ergebnisse in ein umfassenderes Konzept zu integrieren und so die Grenzen herkömmlicher Disziplinen und Traditionen aufzubrechen.
Der Arbeitsgruppe Medizinische Physik des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der Fiedrich-Schiller-Universität Jena, insbesondere Jan Sedlacik, Dr. Alexander Rauscher und Prof. Dr. Jürgen Reichenbach danke ich für die Zusammenarbeit und die wertvollen Diskussionen bezüglich Fragen der Signalentstehung und Frequenzverteilung im Kapillarnetzwerk.
Für die weitreichende Unterstützung bei der Behandlung vieler numerischer Probleme danke ich Dr. Stephan Glutsch, der schon als Betreuer meiner Diplomarbeit viel Hilfestellung gab, Zusammenhänge erklärte und wesentlich zu meinem bisherigen wissenschaftlichen Werdegang beitrug.
Weiterhin bedanke ich mich bei meinen Eltern für Ihre Unterstützung, bei meinen Großeltern, die mir die Ferienkurse am Forschungszentrum Jülich ermöglichten, sowie meinen Arbeitskollegen vom Lehrstuhl für Experimentelle Physik 5 der Universität Würzburg für die stetige Motivation und Hilfe.
Würzburg, im September 2008 Christian H. Ziener
Kapitel 1 Einleitung
Methoden, die unter Verwendung von NMR-Signalen räumliche Abbildungen oder Zeugmatogramme (griechisch: Zeugma = das Joch, die Zusammenführung, die Verbindung) der Verteilung von Kernspinmomenten in einer makroskopischen Probe erstellen, werden mit dem Begriff Zeugmatographie bezeichnet [1, 2]. Speziell bei medizinischen Anwendungen wurde der Begriff Kernspinresonanztomographie eingeführt. Dabei besitzt die zeugmatographische Abbildung Ähnlichkeiten mit optischen Experimenten, bei denen Phasendifferenzen infolge unterschiedlicher Weglängen einer Abbildung der Objekte zugrunde liegen. Im zeugmatographischen Experiment entstehen die Phasendifferenzen durch die unterschiedlichen Präzessionsfrequenzen, welche die Kernmomente an verschiedenen Stellen des äußeren Magnetfeldes mit einem definierten Feldgradienten besitzen.
Einen wichtigen Einfluss auf die Abbildung biologischen Gewebes haben mikroskopische Magnetfeldinhomogenitäten, die z. B. durch endogene oder exogene Kontrastmittel erzeugt werden. Ausschlaggebend für die intensive Befassung mit der Auswirkung von Magnetfeldinhomogenitäten auf das NMR-Signal war die Entdeckung des BOLD-Effekts (BOLD=Blood Oxygenation Level Dependent) von Ogawa im Jahre 1990 [3]. Ogawa untersuchte die Auswirkungen eines im Jahre 1936 von Pauling studierten interessanten Phänomens der unterschiedlichen Eigenschaften von oxygenierten und desoxygenierten Hämoglobin [4]. Der BOLD-Effekt basiert auf diesen unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften von oxygenierten und desoxygenierten Hämoglobin und erlaubt es, Blut selbst als endogenes Kontrastmittel für die funktionelle Bildgebung zu nutzen. Blutgefüllte Kapillaren können demnach als mikroskopische magnetisierte Körper aufgefasst werden, deren Suszeptibilitätskontrast zum umgebenden Gewebe vom Oxygenierungsgrad des enthaltenen Blutes abhängt. Diese Suszeptibilitätsdifferenz erzeugt die charakteristischen Eigenschaften des NMR-Signals. Nun besteht die Aufgabe darin, aus dem gemessenen NMR-Signal Rückschlüsse auf den Oxygenierungsgrad des Blutes oder noch allgemeiner auf die geometrischen Eigenschaften des untersuchten Gewebes zu ziehen. Dazu müssen jedoch zuerst physikalische Modelle entwickelt werden, welche die Signaleigenschaften des untersuchten Gewebes und die darin enthaltenen Feldinhomogenitäten ausreichend beschreiben. So wird z. B. als Gewebeeigenschaft die Frequenzverteilung um eine Kapillare in der vorliegenden Arbeit untersucht. Aus der mit NMR-Methoden gemessenen Frequenzverteilung kann dann die Suszeptibilitätsdifferenz zwischen Kapillare und umgebenden Medium sowie die Kapillardichte ermittelt werden. Anordnung der Kapillaren und Oxygenierungsgrad des Blutes bestimmen auch die Relaxationseigenschaften des untersuchten Gewebes. Dadurch ist es beispielsweise möglich, aus der messbaren transversalen Relaxationszeit das regionale Blutvolumen des Herzmuskelgewebes zu ermitteln und so die eventuellen Auswirkungen eines Myokardinfarktes zu quantifizieren [5].
In Analogie zum endogenen Kontrastmittel Blut stellen sich die Verhältnisse bei exogenen Kontrastmitteln dar, die von Zellen aufgenommen werden und einen Suszeptibilitätskontrast zum umgebenden Gewebe erzeugen. Bei den exogenen Kontrastmitteln handelt es sich um sehr kleine paramagnetische Partikel (USPIO=Ultra Small Paramagnetic Iron Oxide), bestehend aus einem paramagnetischen Kern (Durchmesser ) und einer Dextranhülle (Durchmesser ). Durch Phagozytose nehmen Zellen diese Partikel auf und werden danach als magnetisch markierte Zellen bezeichnet. Diese magnetisch markierten Zellen erzeugen eine charakteristische Frequenzverteilung im Voxel, die von der Konzentration des Kontrastmittels und weiteren Parametern, wie z. B. dem Diffusionskoeffizienten des umgebenden Gewebes, abhängt. Diese Parameter haben auch Einfluss auf die transversale Relaxationszeit. Die physikalischen Modelle sollen nun helfen, von der Relaxationszeit auf die Parameter des Gewebes, wie z. B. die Kontrastmittelkonzentration (oder besser die Konzentration der Zellen) zu schließen.
Das Fundament zur Lösung dieser Aufgaben ist ein tiefgreifendes Verständnis des Einflusses von Magnetfeldinhomogenitäten auf die Entstehung des NMR-Signals. Im Verlauf dieser Arbeit wird genutzt werden, dass sich der aus der statistischen Physik bekannte Formalismus der Zustandsdichten auf das von den magnetisierten Körpern erzeugte lokale Magnetfeld übertragen lässt, und dass dieser Formalismus ein wichtiges Werkzeug zur Beschreibung der Suszeptibilitätseffekte darstellt.
Eine grundlegende Arbeit zur Beschreibung von Magnetfeldinhomogenitäten stellt die Arbeit „Theory of NMR signal behavior in magnetically inhomogeneous tissues: the static dephasing regime“ von Yablonskiy und Haacke aus dem Jahre 1994 dar [6], in der die Signaleigenschaften untersucht werden, die von lokalen inhomogenen Feldern hervorgerufen werden. Allerdings wird in der Arbeit der Einfluss der Diffusion im umgebenden Medium nicht berücksichtigt. Solange es sich um Objekte mit großen Abmessungen (mm-Bereich) bzw. um starke Suszeptibilitätssprünge zwischen Objekt und umgebenden Medium handelt, ist die Vernachlässigung der Diffusionseffekte gerechtfertigt. In dem Fall spricht man vom Static-Dephasing-Regime, d. h. die signalgebenden Spins des umgebenden Mediums können als unbeweglich angesehen werden. Sobald es sich jedoch um relativ kleine Objekte wie Kontrastmittelteilchen oder um geringe Suszeptibilitätsdifferenzen – wie sie z. B. durch die magnetischen Eigenschaften des Hämoglobins hervorgerufen werden – handelt, haben Diffusionseffekte einen wesentlichen Einfluss auf das NMR-Signal und können nicht mehr vernachlässigt werden. Der andere Grenzfall, in dem die Suszeptibilitätseffekte vernachlässigt werden können und in dem hauptsächlich Diffusionseffekte die NMR-Signalentstehung bestimmen, ist das Motional-Narrowing-Regime, das bereits in den frühen Jahren der Kernspinresonanzforschung ausführlich untersucht wurde [7]. Bauer et al. gelang es 1999, die aus der Theorie der Linienform bekannte Strong-Collision-Approximation auf Fragestellungen der Signalentstehung in magnetisch inhomogenen Gewebe anzuwenden [8]. Mit diesem Formalismus ist es möglich, den gesamten Dynamikbereich vom Static-Dephasing-Regime bis zum Motional-Narrowing-Regime zu beschreiben, wobei die beiden Grenzfälle selber enthalten sind. Mit Hilfe dieser Näherung konnte die Relaxationszeit des Myokards in Abhängigkeiten vom Oxygenierungsgrad des Blutes, vom regionalen Blutvolumen und von der Diffusion des umgebenden Mediums bestimmt werden [9]. In der vorliegenden Arbeit wird die Strong-Collision-Approximation angewandt, um das Relaxationsverhalten von Gewebe zu untersuchen, in dem sich magnetisch markierte Zellen befinden, die lokale Magnetfeldinhomogenitäten erzeugen. Des Weiteren wird der Formalismus der Zustandsdichten angewandt, um die Frequenzverteilungen um magnetisierte Objekte zu beschreiben. Mittels der Strong-Collision-Approximation kann auch deren Diffusionsabhängigkeit untersucht werden.
Eine Übersicht über die physikalischen Grundlagen der Beschreibung von Kernspins im Magnetfeld, die biologischen Grundlagen zur Charakterisierung von Geweben sowie die mathematischen Grundlagen der Strong-Collision-Näherung werden in Kapitel 2 gegeben.
Basierend auf einfachen Annahmen zur Anordnung von magnetisierten Objekten in einem äußeren Magnetfeld wird in Kapitel 3 die Korrelationszeit , die den Diffusionsprozess um diese Objekte beschreibt, untersucht. Die Korrelationszeit ist abhängig vom charakteristischen Durchmesser des Objektes, vom Diffusionskoeffizienten des umgebenden Mediums, vom Volumenanteil des Objektes am gesamten Voxel und von der Permeabilität der Oberfläche. Ein einfaches Verfahren zur Ermittlung der Korrelationszeit wird vorgestellt. Aufgrund seiner mathematischen Einfachheit kann dieses Verfahren für weitere Anwendungen genutzt werden. Für den Spezialfall von Kugeln und Zylindern werden analytische Ausdrücke angegeben, die zur Charakterisierung des Diffusionsprozesses oder zur Beschreibung von Relaxationsraten genutzt werden können.
Zur allgemeinen Beschreibung von NMR-Signalen, die durch die Anwesenheit von magnetisierten Objekten beeinflusst werden, wird in Kapitel 4 ein Formalismus zur Beschreibung der Frequenzverteilung in einem Voxel entwickelt. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Voxel ein magnetisiertes Objekt enthält, welches ein lokales inhomogenes Magnetfeld erzeugt. Das Objekt, welches das inhomogene Magnetfeld erzeugt, wird vom Dephasierungsvolumen umgeben, in dem sich die diffundierenden Spins befinden. Der Diffusionsprozess wird durch den Diffusionskoeffizienten charakterisiert. Es kann gezeigt werden, dass allein die Form des magnetischen Körpers, die Stärke der Suszeptibilitätsdifferenz zwischen Körper und umgebenden Medium und der Diffusionskoeffizient die Frequenzverteilung festlegen.
Weitere Verfahren zur Untersuchung der Diffusionseffekte auf das NMR-Signal wurden in der letzten Zeit von verschiedenen Autoren entwickelt. Kiselev und Posse erarbeiteten eine Erweiterung des Static-Dephasing-Regimes, basierend auf einem Störungsansatz im lokalen Magnetfeld [10]. Sukstanskii und Yablonskiy nutzten die Gaußsche Näherung zur Beschreibung der Signaldephasierung [11, 12, 13]. Jedoch beruht diese Gaußsche Näherung auf dem aus der Festkörperphysik bekannten Anderson-Weiss-Modell [14], dessen Anwendbarkeitskriterien für die NMR-Relaxationstheorie erst in dieser Arbeit genauer untersucht werden. Die oben beschriebenen Anwendbarkeitskriterien des Anderson-Weiss-Modells führten auf die Problematik der Nicht-Gaußschen Dephasierung und werden in Kapitel 5 erarbeitet.
Zur Charakterisierung von Geweben werden oft die transversalen Relaxationszeiten genutzt, die sich experimentell bestimmen lassen. Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Stammzellen stellte sich die Frage, wie diese Zellen mit Hilfe der Kernspinresonanzbildgebung sichtbar gemacht werden können. In Analogie zum oben beschriebenen BOLD-Effekt, der die Eigenschaften des endogenen Kontrastmittels Blut ausnutzt, werden die zu untersuchenden Zellen vor der Injektion in das zu untersuchende Gewebe mit kleinen paramagnetischen Kontrastmittelteichen (USPIOs) markiert. Abhängig von den Parametern dieser Kontrastmittelteilchen und abhängig von den Eigenschaften des umgebenden Mediums ändern sich die Dephasierungseigenschaften der die Zellen umgebenden Wassermoleküle, was zu einer Veränderung der Relaxationseigenschaften führt. In Kapitel 6 wird dieser Zusammenhang zwischen der Relaxationszeit, den Parametern der Kontrastmittelteilchen und dem Diffusionseffekt der umgebenden Wassermoleküle untersucht.
Ausgehend von einfachen Annahmen über die Verteilung magnetischen Materials innerhalb eines Voxels werden in Kapitel 7 einfache Skalierungsgesetze für die transversalen Relaxationszeiten und abgeleitet. Dabei werden schon bekannte Ergebnisse verallgemeinert. Mit den hergeleiteten Gesetzen kann man die Auswirkung der Veränderung von Suszeptibilitätsdifferenz, äußerem Magnetfeld, charakteristischer Größe des Objekts oder Diffusionseigenschaften des umgebenden Mediums auf die transversalen Relaxationszeiten vorhersagen. Von Bedeutung ist dabei, dass das Skalierungsverhalten der Relaxationszeiten für jede beliebige Form einer Feldinhomogenität gilt. Das heißt, im Gegensatz zu früheren Ergebnissen können diese Skalierungsgesetze auf beliebige Geometrien unabhängig von der Form der Magnetfeldinhomogenität angewandt werden. Damit können verschiedene Parameter eines Experiments in einer einfachen Weise miteinander verknüpft werden, ohne die gesamte Komplexität des Systems betrachten zu müssen.
Kapitel 2 Grundlagen
2.1 Kernspin im Magnetfeld
Betrachtet wird ein System von isolierten Spins in einem äußeren Magnetfeld mit der Flussdichte in -Richtung, die das Volumen einnehmen. Das magnetische Moment eines Kernes ist proportional zum Drehimpuls des Kerns:
| (2.1) |
wobei das für den betrachteten Kern spezifische gyromagnetische Verhältnis darstellt:
| (2.2) |
Der g-Faktor ist vom betrachteten Kern abhängig und das Kernmagneton ist definiert durch
| (2.3) |
wobei die Elementarladung, die Plancksche Konstante und die Masse des Kerns darstellt. Für die Komponenten des Drehimpulses gelten die Vertauschungsregeln sowie : . Seien die gemeinsamen Eigenfunktionen der Operatoren und mit den Quantenzahlen und ( ), so gilt
| (2.4) | ||||
| (2.5) |
Der Hamilton-Operator für die Zeeman-Energie
| (2.6) |
erfüllt demnach die Eigenwertgleichung
| (2.7) |
mit den Eigenwerten
| (2.8) |
wobei die Werte annehmen kann. Diese Gleichung beschreibt die Energieaufspaltung aufgrund der Richtungsquantelung des magnetischen Moments. Beim Übergang zwischen zwei benachbarten Zuständen wird ein Photon mit der Energie ausgesandt. Damit ergibt sich die als Larmor-Relation bekannte Resonanzbedingung
| (2.9) |
In dieser Arbeit werden nur Protonen mit einem g-Faktor von untersucht. Damit ergibt sich ein gyromagnetisches Verhältnis von .
Die Wechselwirkung zwischen den Spinmomenten führt zum Aufbau einer makroskopischen Magnetisierung, deren Gleichgewichtswert durch
| (2.10) |
gegeben ist. Der Erwartungswert für die Komponente des magnetischen Moments in Magnetfeldrichtung ergibt sich zu
| (2.11) |
mit der Brillouin-Funktion
| (2.12) |
und dem dimensionslosen Argument
| (2.13) |
Die Wechselwirkung zwischen dem Spinsystem und dem äußeren Hochfrequenzfeld , wird durch den Hamilton-Operator
| (2.14) |
beschrieben, der sich als kleine Störung zum Hamilton-Operator der Zeeman-Energie (2.7) addiert. Um den Einfluss dieser Störung zu beschreiben, werden in Analogie zu Gleichung (2.10) die Erwartungswerte der Komponenten der Magnetisierung () mit Hilfe des Dichteoperators durch die Gleichung
| (2.15) |
beschrieben. Die Bewegungsgleichung des Dichteoperators
| (2.16) |
enthält den Hamilton-Operator , der die Wechselwirkung mit dem konstanten äußeren -Feld und dem hochfrequenten Wechselfeld beschreibt. Die Zeitentwicklung des Dichteoperators kann nun z. B. im Dirac-Bild geschehen. Allerdings lassen sich für die betrachteten Systeme mit hinreichend hoher thermischer Beweglichkeit, für die sich die Umorientierungen und Translationen der spintragenden Teilchen in Zeiträumen abspielen, die sehr kurz gegenüber der Beobachtungszeit im Kernresonanzexperiment sind, die magnetischen Eigenschaften eines Ensembles von Kernspins in einem äußeren Magnetfeld gut durch die phänomenologischen Bloch-Gleichungen beschreiben:
| (2.17) |
Dabei charakterisieren die Relaxationszeiten und den Übergang des Spinsystems vom angeregten Zustand in das Gleichgewicht. Hierbei beschreibt die longitudinale Relaxationszeit die Wechselwirkung der Spins mit der Umgebung (Spin-Gitter-Relaxation oder Energierelaxation), und die transversale Relaxationszeit die Wechselwirkung der Spins untereinander (Spin-Spin-Relaxation oder Entropierelaxation). Nach einem Anregungspuls in Form eines hochfrequenten -Felds ergibt sich als Lösung dieser Gleichung der freie Induktionsabfall (FID) der transversalen Komponente, sowie ein exponentieller Anstieg der longitudinalen Komponente:
| (2.18) | ||||
| (2.19) |
wobei die Gleichgewichtsmagnetisierung nach Gleichung (2.10) darstellt. Bisher wurden allerdings nur isochromatische Spins betrachtet, d. h. es wurde angenommen, dass alle Spins bei der Frequenz präzedieren. Werden jedoch magnetisierte Körper berücksichtigt, die eine lokale Resonanzfrequenz in der Probe erzeugen, führt dies zu einer zusätzlichen Dephasierung der Spins. Die lokale Resonanzfrequenz erzeugt die Frequenzverteilung , die angibt, wie oft jede Resonanzfrequenz anzutreffen ist. Dies führt zu einem zusätzlichen Relaxationsterm für die transversale Komponente der Magnetisierung:
| (2.20) |
Für diese Frequenzverteilung wird oft ein lorentzförmiges Profil von der Form
| (2.21) |
angenommen, wobei die Stärke der Magnetfeldinhomogenität charakterisiert [15], was sich in der Breite der Lorentz-Linie niederschlägt. Unter der Annahme dieser lorentzförmigen Frequenzverteilung lässt sich das Integral in obiger Gleichung auswerten. Für den freien Induktionszerfall ergibt sich der Zusammenhang
| (2.22) |
Im Fall einer gaußförmigen Frequenzverteilung der Form ergibt sich für den Signal-Zeit-Verlauf eine Mischung aus exponentiellem und gaußförmigem Abfall der Form . In Kapitel 5 wird der zugrunde liegenden Dephasierungsmechanismus betrachtet und die Form des freien Induktionszerfalls genauer untersucht.
Die Frequenzverteilung wurde bisher als lorentzförmig angenommen, damit sich ein exponentieller Signalzerfall ergab. Die genaue Form dieser Frequenzverteilung wird in Kapitel 4 untersucht. Dazu wird der aus der statistischen Physik bekannte Formalismus der Zustandsdichten auf das von den magnetisierten Objekten erzeugte Frequenzfeld angewandt.
Die bisherigen Darstellungen konzentrierten sich auf die Untersuchung des freien Induktionszerfalles nach einem Anregungspuls, durch den die Magnetisierung, welche ursprünglich keine transversale Komponente besaß, aus der -Richtung ausgelenkt wurde. Sequenzen, bei denen jedes Mal die transversale Magnetisierung direkt vor der Hochfrequenzanregung zerstört wird, werden als FLASH-Sequenzen (Fast-Low-Angle-Shot) bezeichnet [16]. Um ein Verschwinden der transversalen Komponente der Magnetisierung vor jedem weiteren Anregungspuls zu realisieren, können Spoilergradienten die verbleibende transversale Magnetisierung dephasieren [17, 18] oder es können spezielle Zyklen der Pulsphase gewählt werden [19]. Durch die Anregung mit dem Flipwinkel entstehen die longitudinale Komponente und die transversale Komponente (siehe Abbildung 2.1).
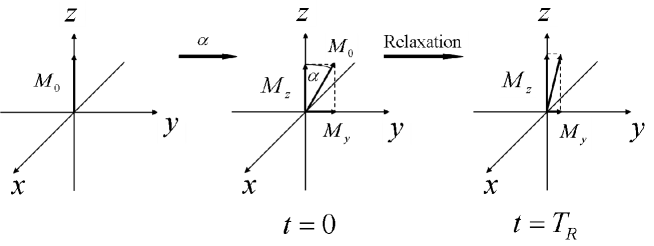
Die jetzt stattfindende Relaxation bringt die Gesamtmagnetisierung wieder in das Gleichgewicht. Dabei wird die transversale Komponente kleiner, die longitudinale Komponente nimmt zu und stellt sich parallel zum äußeren Magnetfeld ein. Der nächste Hochfrequenzpuls wird nach der Wiederholzeit eingestrahlt. Im Gleichgewicht wird durch die -Relaxation genau so viel longitudinale Magnetisierung erzeugt, wie durch den Anregungspuls verloren geht. Für den Betrag der transversalen Komponente, der letztlich eine messbare Spannung in der Empfängerspule induziert, gilt in diesem Fall die Ernst-Gleichung [20]
| (2.23) |
wobei diese transversale Komponente das Maximum annimmt, wenn die Anregung mit dem Ernst-Winkel erfolgt.
Die freie Präzession im stationären Zustand (SSFP) ist dadurch gekennzeichnet, dass direkt vor dem Hochfrequenzpuls auch transversale Magnetisierung vorliegt. Für die transversale Komponente nach dem Hochfrequenzpuls ergibt sich der Ausdruck
| (2.24) |
wobei der Flipwinkel und die Repetitionszeit zwischen zwei Anregungspulsen ist [21]. Die Parameter und sind gegeben durch [22]
| (2.25) | ||||
| (2.26) |
mit den Abkürzungen und . Man sieht, dass in diesem Fall die transversale Magnetisierung von der Resonanzfrequenz abhängt. Da sowohl im Falle einer FLASH-Sequenz als auch einer SSFP-Sequenz die entstehende transversale Magnetisierung nur von Sequenzparametern ( und ) sowie von intrinsischen Parametern der Probe ( und ) abhängt, wird die Größe oft auch als Responsefunktion der verwendeten Sequenz bezeichnet.
Das Voxel, aus dem das Signal kommt, kann man gedanklich in viele kleine Subvoxel zerlegen. Jedes Subvoxel kann als homogen ansehen werden und diesem Subvoxel wird die lokale Resonanzfrequenz zugeordnet. Im Sinne eines Histogrammes kann nun ermittelt werden, wie viele Subvoxel die gleiche lokale Resonanzfrequenz besitzen. Somit erhält man eine Wahrscheinlichkeitsverteilung , die der Frequenzverteilung in Gleichung (2.20) entspricht. Jede lokale Resonanzfrequenz kommt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vor. Des Weiteren erzeugt die gewählte Pulssequenz für jede lokale Resonanzfrequenz die Magnetisierung . Um das Signal vom gesamten Voxel zu erhalten, muss man jede Magnetisierung mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit multiplizieren und über alle Subvoxel summieren. Im Riemannschen Sinne geht die Summe über alle Subvoxel in ein Integral über alle Frequenzen über und es folgt [23, 24, 25]:
| (2.27) |
Das Signal, das in einem NMR-Experiment entsteht, wird eindeutig durch die untersuchte Probe oder das zu untersuchende Gewebe (charakterisiert durch die Frequenzverteilung ) und die benutzte Sequenz (charakterisiert durch die Responsefunktion ) festgelegt. Im Spezialfall einer FLASH-Sequenz [16] ist die Responsefunktion konstant () und deshalb ist das entstehende Signal die Fourier-Transformierte der Frequenzverteilung, wie aus Gleichung (2.27) zu erkennen ist. In Abbildung 2.2 sind die zur Signalentstehung beitragenden Größen dargestellt.
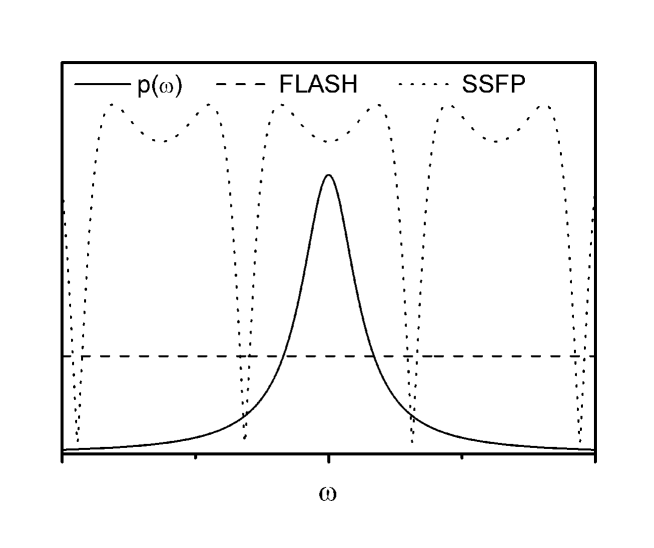
2.2 Körper im Magnetfeld
2.2.1 Allgemeines Modell
Zur Beschreibung der Diffusion und der damit verbundenen Relaxationsprozesse in den zu betrachtenden Geweben werden Modelle benötigt, die einerseits die physiologischen Gegebenheiten richtig darstellen, andererseits aber auch eine mathematische Beschreibung ermöglichen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird ein magnetischer Körper in einem Voxel betrachtet (siehe Abbildung 2.3). Diese beliebige Verteilung magnetischen Materials innerhalb eines Voxels verursacht einen Suszeptibilitätssprung zum umgebenden Medium mit dem Volumen . Der Volumenanteil magnetischen Materials innerhalb des Voxels ist . Die Dephasierung findet im verbleibenden Volumen des Voxels um den magnetischen Störkörper herum statt. Die Diffusion der Spins wird durch den Diffusionskoeffizienten beschrieben.
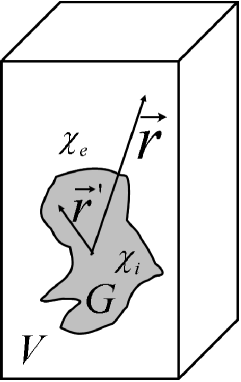
Das lokale inhomogene Magnetfeld, das durch den Körper erzeugt wird, berechnet sich nach den Gesetzen der Elektrodynamik [26, 27]. Im Körper sollen keine Ströme fließen, d. h. die Stromdichteverteilung verschwindet (). Die magnetischen Momente im Körper erzeugen die Magnetisierung . Ausgangspunkt der Berechnung des lokalen Magnetfeldes um den Körper sind die beiden Maxwell-Gleichungen für die magnetische Flussdichte und die magnetische Feldstärke :
| (2.28) | ||||
| (2.29) |
Aufgrund der verschwindenden Rotation in der zweiten Maxwell-Gleichung ist es möglich, ein skalares Potential zu definieren, so dass die magnetische Feldstärke als
| (2.30) |
geschrieben werden kann. Die magnetische Flussdichte setzt sich aus der magnetischen Feldstärke und der Magnetisierung zusammen:
| (2.31) |
Aus der ersten Maxwell-Gleichung ergibt sich nun
| (2.32) |
Mit der Darstellung der magnetischen Feldstärke durch das skalare Potential ergibt sich ein Zusammenhang zwischen der vorgegebenen Magnetisierung und dem gesuchten Potential :
| (2.33) |
Diese Gleichung ist analog zur Poisson-Gleichung der Elektrostatik. Das gesuchte Potential lässt sich durch das Poisson-Integral ausdrücken:
| (2.34) |
Der Integrant kann noch entsprechend den Regeln der Vektoranalysis umgeformt werden:
| (2.35) | ||||
| (2.36) |
Der erste Summand führt mit Hilfe des Gaußschen Satzes in Gleichung (2.34) zu einem Oberflächenintegral, das wegen der Lokalisation von verschwindet. Es bleibt
| (2.37) |
Betrachtet werden Körper, die homogen in -Richtung, d. h. parallel zum äußeren magnetischen Feld magnetisiert sind. Deshalb lässt sich die Magnetisierung in der Form schreiben, und folglich bleibt nur die Ableitung in -Richtung erhalten:
| (2.38) |
Die magnetische Feldstärke ergibt sich nun nach Gleichung (2.30). Die magnetische Flussdichte an einem Punkt im Voxel ergibt sich zu . Es wird also durch den Körper eine lokale Flussdichte mit Komponenten in alle drei Raumrichtungen erzeugt. Die Komponente in -Richtung überlagert sich mit dem äußeren Magnetfeld zu . Die gesamte Flussdichte an einem Ort ergibt sich zu
Aus dieser Ableitung wird ersichtlich, dass nur die -Komponente des lokalen inhomogenen Feldes einen wesentlichen Beitrag zur Präzession der umgebenden Spins leistet. Deshalb braucht nur die -Komponente des Nabla-Operators in Gleichung (2.30) berücksichtigt werden:
| (2.40) |
Mit dem Ausdruck für das Potential aus Gleichung (2.38) ergibt sich
| (2.41) |
wobei alle Punkte innerhalb des Körpers und alle Punkte im umgebenden Volumen sind (siehe Abbildung 2.3). Es wird also nur das durch den Körper erzeugte inhomogene Magnetfeld und dessen Einfluss auf die Dephasierung der Spins im restlichen Volumen betrachtet. Die Effekte der benachbarten Voxel auf das Magnetfeld im signalgebenden Voxel werden vernachlässigt. Entsprechend der Larmor-Relation (2.9) erzeugt dieses ortsabhängige lokale Magnetfeld im Voxel die lokale Resonanzfrequenz , die in der Form
| (2.42) |
dargestellt werden kann. Die charakteristische Frequenz, welche die Suszeptibilitätseigenschaften des Körpers und die Stärke des äußeren Magnetfeldes enthält, kann als
| (2.43) |
geschrieben werden, während die Geometriefunktion
| (2.44) |
die Form der Magnetfeldinhomogenität charakterisiert. Damit können Suszeptibilitätseigenschaften und die räumliche Anordnung des Körpers innerhalb des Voxels voneinander separiert werden. Dadurch ist es möglich, den Einfluss des jeweiligen Anteiles unabhängig vom anderen Anteil zu untersuchen.
2.2.2 Kugel
Ein kugelförmiges Objekt in einem äußeren Magnetfeld dient als physikalisches Modell für einige biologische Gewebe bzw. Gegebenheiten. So betrachtet man beispielsweise die Lunge als Gewebe, das aus kleinen kugelförmigen Alveolen zusammengesetzt ist. Jede Alveole ist eine luftgefüllte Kugel, die von Blut umgeben ist. Der Suszeptibilitätsunterschied zwischen Luft und Blut erzeugt das lokale inhomogene Magnetfeld. Des Weiteren können durch das Kugelmodell Gewebe beschrieben werden, die magnetisch markierte Zellen enthalten. Die von den Zellen durch Phagozytose aufgenommenen Kontrastmittelteilchen bilden einen kugelförmigen magnetischen Kern vom Radius , der konzentrisch vom Dephasierungsvolumen mit dem Radius umgeben wird. Dieser Radius ist allerdings nicht mit dem Zellradius zu verwechseln, da das magnetische Störfeld der Kontrastmittelteilchen auch im Interzellularraum wirkt. Der Volumenanteil ist durch definiert.
In vielen Situationen kann also als physikalisches Modell eine Kugel mit dem Radius angenommen werden, die von einem kugelförmigen Relaxationsvolumen mit dem Radius umgeben wird (siehe Abbildung 2.4). Dabei werden zwei Näherungen gemacht. Erstens erzeugen die anderen umliegenden Kugeln auch ein lokales Magnetfeld, das sich auch auf die Resonanzfrequenz des Spins auswirkt, der sich im Dephasierungsvolumen der betrachteten Kugel bewegt. Zweitens wird nur die Diffusion zwischen zwei konzentrischen Kugeln betrachtet, obwohl der umgebende Spin keine Grenzen hat und in seiner Bewegung nicht behindert wird. Diese Einschränkung wird durch die Annahme reflektierender Randbedingungen an der äußeren Begrenzung des Dephasierungsvolumens gerechtfertigt. Berührt also ein Spin die äußere Begrenzung (siehe Abbildung 2.4), wird er reflektiert und die Bewegung setzt sich im Dephasierungsvolumen fort.
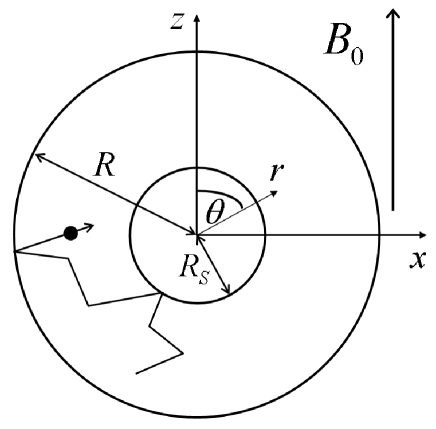
Das inhomogene Magnetfeld um eine homogen magnetisierte Kugel ergibt sich nach Gleichung (2.41) als das Feld eines magnetischen Dipols, d. h. in Kugelkoordinaten [28]:
| (2.45) |
wobei die Differenz der Magnetisierungen zwischen dem magnetischen Kern und dem umgebenden Gewebe ist. Der charakteristische äquatoriale Frequenzshift
beschreibt die Stärke der Magnetfeldinhomogenität, und die Formfunktion
| (2.47) |
charakterisiert die Abhängigkeit von den Koordinaten. Damit ergibt sich die lokale Resonanzfrequenz zu
| (2.48) |
2.2.3 Zylinder
Als Modell, beispielsweise für eine Kapillare, wird ein dünner Zylinder mit dem Radius angenommen, der einen Neigungswinkel zum äußeren Magnetfeld hat (siehe Abbildung 2.5). Dabei wird das aus der Physiologie bekannten Kroghsche Zylindermodell zugrunde gelegt, das ursprünglich zur Beschreibung des Sauerstoffpartialdrucks in vaskularisiertem Gewebe entwickelt wurde [29]. Dazu wird ein Gefäß als ein blutgefüllter Zylinder (mit Radius ) betrachtet, der konzentrisch von einem zylinderförmigen Versorgungsgebiet (mit Radius ) umgeben wird (siehe linke Seite der Abbildung 2.5). Der Volumenanteil ist definiert als . Im Raum zwischen den beiden konzentrischen Zylindern findet die Diffusion der Spins statt, deren Dephasierung untersucht wird. Deshalb wird dieses Gebiet als Dephasierungsvolumen bezeichnet. An der Oberfläche dieses Dephasierungsvolumens werden reflektierende Randbedingungen angenommen, d. h., jede Trajektorie eines Spins, welche die Oberfläche des Dephasierungsvolumens an der Stelle berührt, wird durch eine symmetrische Trajektorie ersetzt, die wieder innerhalb des ursprünglich betrachteten Dephasierungsvolumens liegt (siehe rechte Seite der Abbildung 2.5).
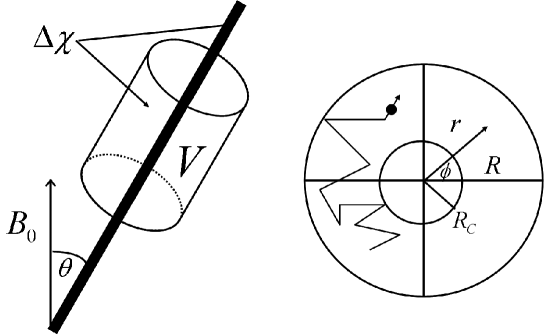
An der Oberfläche der Kapillare können sowohl reflektierende als auch strahlende Randbedingungen betrachtet werden. Dabei kann im Falle strahlender Randbedingungen auch die Permeabilität der Kapillare berücksichtigt werden. Der Einfluss der Randbedingungen wird in Kapitel 3 ausführlich untersucht.
Der Zylinder erzeugt zum umgebenden Gewebe die Suszeptibilitätsdifferenz , was zu dem lokalen inhomogenen Magnetfeld
| (2.49) |
führt, wobei für Polarkoordinaten in einer Ebene senkrecht zur Zylinderachse stehen [30]. Auf der Oberfläche des Zylinders nimmt das lokale Magnetfeld für den Winkel das Maximum an. Die lokale Resonanzfrequenz ist durch die Larmor-Beziehung gegeben:
| (2.50) |
Der äquatoriale Frequenzshift
charakterisiert die Stärke des Suszeptibilitätseffekts, und die Funktion
| (2.52) |
beschreibt die räumliche Form des lokalen Magnetfelds. Damit kann man die lokale Resonanzfrequenz in der Form
| (2.53) |
schreiben.
2.3 Diffusion
2.3.1 Bloch-Torrey-Gleichung
Das NMR-Signal entsteht durch die transversale Komponente der Magnetisierung innerhalb eines Voxels, die in der Empfängerspule eine Spannung induziert. Um die Zeitentwicklung dieses Signals zu beschreiben, wird wie in Abbildung 2.3 veranschaulicht ein einzelnes Voxel betrachtet, in dem sich ein Körper befindet. Das durch den Körper erzeugte lokale Magnetfeld (2.41) induziert die dazugehörige Larmor-Frequenz . In diesem inhomogenen Magnetfeld findet die Diffusion der Spins statt.
Um den Einfluss der Diffusion auf den Signalverlauf bzw. die Frequenzverteilung zu beschreiben, wurde von Torrey ein zusätzlicher Diffusionsterm in die Bloch-Gleichungen eingeführt [31]. Für die transversale Magnetisierung in polarer Form ergibt sich somit die folgende Bewegungsgleichung:
| (2.54) |
wobei die lokale Larmor-Frequenz des inhomogenen Magnetfeldes ist und der Diffusionskoeffizienten des umgebenden Mediums ist. Mathematisch gesehen handelt es sich um eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung vom Typ der Schrödingergleichung mit rein imaginärem Potential. Eine formale Zeitintegration der Bloch-Torrey-Gleichung liefert
| (2.55) |
Das resultierende Signal aus dem gesamten Voxel ist demnach
| (2.56) |
2.3.2 Strong-Collision-Näherung
Um die Bloch-Torrey-Gleichung zu lösen, wird der Diffusionsprozess im lokalen inhomogenen Magnetfeld um den magnetisierten Körper im Sinne von Übergangsdynamiken als stochastischer Prozess beschrieben. Aufgrund der Diffusion durch das lokale inhomogene Magnetfeld ist der betrachtete Spin verschiedenen Larmor-Frequenzen zu verschiedenen Zeiten ausgesetzt. Durch Einführung einer Sprungdynamik zwischen den verschiedenen lokalen Larmor-Frequenzen kann man den Diffusionsprozess diskretisieren. Dies kann realisiert werden, indem der Diffusionsoperator durch die Ratenmatrix ersetzt wird, wobei die Übergangsrate eines Spins von einem Ort mit der lokalen Larmor-Frequenz zu einem Ort mit der lokalen Larmor-Frequenz beschreibt. Unter der Annahme, dass diese Übergangswahrscheinlichkeit nur von der aktuellen Position des Spins abhängt, kann der Diffusionsprozess durch einen Markov-Prozess ersetzt werden, der durch den Generator beschrieben wird. In dieser Näherung wird die Zeitentwicklung der transversalen Magnetisierung des Spins in der Form geschrieben, wobei die transversale Magnetisierung eines Spins an einem Ort mit der lokalen Larmor-Frequenz ist. Die durch den magnetisierten Körper verursachten lokalen Resonanzfrequenzen können in Matrixform geschrieben werden. Mit dem Vektor , dessen -tes Element die transversale Magnetisierung bei der Larmor-Frequenz beschreibt, ergibt sich eine Verallgemeinerung der Bloch-Torrey-Gleichung in Operatorform:
| (2.57) |
In der Originalarbeit von Torrey [31] wurden reine Diffusionsprozesse betrachtet, also und , mit der lokalen Larmor-Frequenz und dem lokalen Diffusionskoeffizienten . Demzufolge ist die ursprüngliche Bloch-Torrey-Gleichung (2.54) ein Spezialfall der allgemeinen Gleichung (2.57). Die formale Lösung von Gleichung (2.57) ist durch gegeben. Damit kann man den Zeitverlauf der über das gesamte Dephasierungsvolumen gemittelten Magnetisierung berechnen:
| (2.58) |
Um diesen allgemeinen Ausdruck zu lösen, wird die Strong-Collision-Näherung verwendet [8, 41]. Der Ausdruck „Strong-Collision“ wurde von verschiedenen Autoren in unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt. Hier wird das Strong-Collision-Modell im Sinne von Dattagupta und Blume [42] angewandt, welches mit dem Modell übereinstimmt, dass auch von Lynden-Bell [43] benutzt wurde. Diese Approximation wurde von der statistischen Physik adaptiert und zur Charakterisierung ergodischer Markov-Prozesse genutzt. Dies sind Prozesse, bei denen Anfangs- und Endzustand stochastisch unabhängig sind und die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen Anfangs- und Endzustand proportional zur Gleichgewichtswahrscheinlichkeit des Endzustandes ist.
In der Strong-Collision-Approximation wird der Generator des stochastischen Prozesses in folgender Weise ersetzt:
| (2.59) |
wobei ein Projektionsoperator auf einen Unterraum ist, der von dem Gleichgewichtseigenvektor des Generators aufgespannt wird. Der identische Operator wird mit bezeichnet. Der Magnetisierungsvektor zum Zeitpunkt ist dem Gleichgewichtseigenvektor proportional: . Der in der Approximation (2.59) eingeführte Fluktuationsparameter ist derjenige Parameter, der die Zeitskala der Übergänge des Markov-Prozesses beschreibt. Er verdeutlicht, wie schnell die Diffusion abläuft. Um diesen Parameter zu bestimmen, wird die Korrelationsfunktion des ursprünglichen Diffusionsprozesses betrachtet, welcher der Bloch-Torrey-Gleichung (2.54) folgt. Diese Korrelationsfunktion ist folgendermaßen definiert:
| (2.60) |
Wie in früheren Arbeiten gezeigt wurde [8, 44], kann eine Korrelationszeit eines diffundierenden Spins eingeführt werden, die im Sinne einer Mean-Relaxation-Time-Approximation [32] bestimmt werden kann [8, 44]:
| (2.61) | ||||
| (2.62) |
Diese Korrelationszeit charakterisiert die Zeitskala der durch die molekulare Bewegung induzierten Feldfluktuationen. Um einen Ausdruck für die Korrelationszeit zu erhalten wird angenommen, dass die Diffusion im Dephasierungsvolumen zwischen der Oberfläche des Körpers und der Oberfläche des Voxels stattfindet. Wie in den Arbeiten [33, 44, 45] gezeigt wurde, ist die Integration problemlos ausführbar und ergibt , wobei eine charakteristische Länge des Körpers ist, wie z. B. der Radius einer Kapillare oder eines Zylinders. In der Arbeit [45] konnte dargestellt werden, dass die Form der Funktion auch nur von der Gestalt der Körpers abhängt. Der Ausdruck ist die Lösung der inhomogenen Laplace-Gleichung mit den gleichen Randbedingungen wie die der ursprünglichen Bloch-Torrey-Gleichung (2.54). Dies ist möglich, da beides Differentialgleichungen zweiter Ordnung sind. Die beiden Randbedingungen an der Oberfläche des Voxels und der Oberfläche des Körpers liefern die beiden Integrationskonstanten der Differentialgleichung zweiter Ordnung. Auf diese Weise gelingt es, die Randbedingungen des ursprünglichen Problems in die Strong-Collision-Näherung einzuarbeiten. Ausführlich wird dies in Kapitel 3 sowie in den Gleichungen (6) und (7) in [44] diskutiert.
Um den Fluktuationsparameter mit der Korrelationszeit zu verknüpfen, wird die Ratenmatrix durch den Operator in der Definition der Korrelationsfunktion ersetzt: . Das Einsetzen dieses Ausdruckes für die Korrelationsfunktion in die Definition der Korrelationszeit nach Gleichung (2.61) ergibt
| (2.63) |
Demzufolge kann man den Zeitverlauf der Magnetisierung durch Anwendung der Strong-Collision-Approximation (2.59) mit auf die allgemeingültige Gleichung (2.58) erhalten:
| (2.64) |
Zur weiteren Auswertung der Frequenzverteilung ist es zweckmäßig, die Laplace-Transformierte des Magnetisierungs-Zeit-Verlaufes in der Form
| (2.65) |
zu betrachten. Berechnet man die Laplace-Transformierte von Gleichung (2.64) mit Hilfe der Definitionsgleichung (2.65), ergibt sich
| (2.66) |
Anwendung der Operatoridentität mit den Abkürzungen und auf Gleichung (2.66) ergibt für die Laplace-Transformierte des Magnetisierungszerfalls
wobei der Index Null die Größen im Static-Dephasing-Regime, in dem die Diffusionseffekte vernachlässigt werden (), kennzeichnet. Demzufolge ist die Magnetisierung im Static-Dephasing-Regime durch gegeben. Auflösen von Gleichung (2.3.2) ergibt den Zusammenhang
| (2.68) |
der für die Erweiterung des Static-Dephasing-Grenzfalles auf alle Diffusionsregime wichtig ist. Dabei vermittelt die Korrelationszeit den Bezug zur Diffusion.
Die Aussage über die stochastische Unabhängigkeit von Anfangs- und Endzustand ist eng mit der Annahme eines ergodischen Systems verbunden. Für ergodische Markovprozesse gilt, dass während der Korrelationszeit alle möglichen Resonanzfrequenzen von einem Spin mit der gleichen Wahrscheinlichkeit besucht werden. Nur unter dieser Annahme ist sichergestellt, dass die Trajektorie des Spins nahezu alle möglichen lokalen Larmor-Frequenzen erfasst, was zur geforderten stochastischen Unabhängigkeit von Anfangs- und Endzustand führt. Offensichtlich erfordert dies eine starke Diffusion, die durch einen großen Diffusionskoeffizienten charakterisiert ist. Deshalb funktioniert die Strong-Collision-Näherung auch im Motional-Narrowing-Regime. Andererseits wurde bei der Berechnung der Korrelationszeit der ursprüngliche komplette Diffusionsoperator berücksichtigt. Das führt zur korrekten Abhängigkeit der Korrelationszeit vom Diffusionskoeffizienten für alle Diffusionsregime. Dadurch wird auch das korrekte Verhalten für kleine Diffusionskoeffizienten eingearbeitet und deshalb können die Ergebnisse der Strong-Collision-Approximation auf das Static-Dephasing-Regime erweitert werden.
2.3.3 Diffusionsregime
Basierend auf dem Bild diffundierender Spins in einem lokalen inhomogenen Magnetfeld um einen magnetisierten Körper wird der zugrunde liegende Relaxationsmechanismus durch zwei Frequenzskalen gekennzeichnet. Die dynamische Frequenzskala charakterisiert den Diffusionsprozess durch die Korrelation der sich bewegenden Spins. Die magnetische Frequenzskala wird von der Stärke des lokalen Magnetfeldes bestimmt, die durch die äquatoriale Frequenz charakterisiert ist. Ein Vergleich beider Frequenzen bestimmt das zugrunde liegende Diffusionsregime [46]. Wenn Diffusionseffekte vernachlässigt werden können (d. h. ), gilt das Static-Dephasing-Regime; im entgegengesetzten Fall werden die Näherungen des Motional-Narrowing-Regimes angewandt. Je nach relativer Stärke dieser beiden charakteristischen Frequenzen können fünf Diffusionsregime eingeführt werden, die den Relaxationsprozess beschreiben:
-
1.
Motional-Narrowing-Regime,
-
2.
Fast-Diffusion-Regime,
-
3.
Intermediate Regime,
-
4.
Slow-Diffusion-Regime und
-
5.
Static-Dephasing-Regime.
Die charakteristischen Parameter des zu untersuchenden Gewebes, insbesondere der Frequenzsprung und die dynamische Frequenz entscheiden nun, welches Diffusionsregime das zugrunde liegende ist. In Abbildung 2.6 ist der qualitative Unterschied zwischen den beiden Grenzfällen dargestellt. Im Motional-Narrowing-Grenzfall besucht der Spin fast alle möglichen lokalen Frequenzen, die durch den magnetischen Körper erzeugt werden. Im Static-Dephasing-Regime bleibt der Spin fast immer an einem Ort und präzediert daher auch nur mit einer konstanten Larmor-Frequenz.
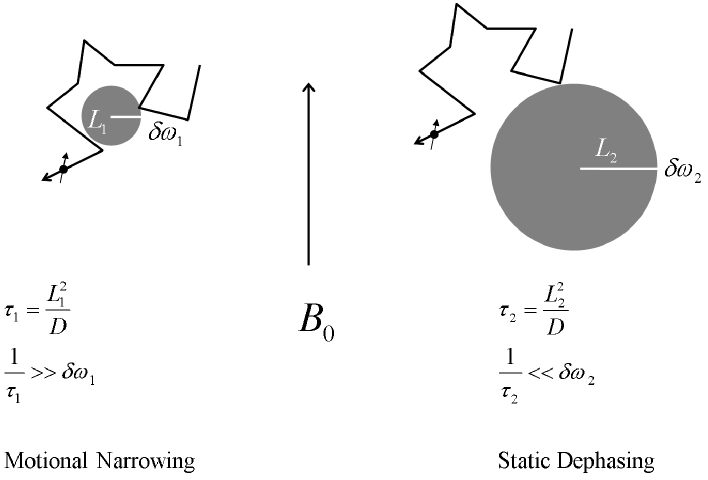
Auf qualitativen Argumenten basierend konnten Yablonskiy und Haacke [6] das folgende Kriterium für die Anwendbarkeit des Static-Dephasing-Regime angeben:
| (2.69) |
wobei eine für den magnetisierten Körper charakteristische Länge und die zugrunde liegende Dimension ist. In Kapitel 3 werden Korrelationszeiten, welche die Diffusion in inhomogenen Magnetfeldern charakterisieren, untersucht. Damit kann dann auch quantitativ eingeteilt werden, in welchem Diffusionsregime man sich gerade befindet.
2.4 Signalformation in einem Voxel
2.4.1 Allgemeine Theorie zur Signalentstehung
Um die Zeitentwicklung der transversalen Magnetisierung zu beschreiben, wird ein einzelnes Voxel betrachtet in dem sich ein Körper befindet (siehe Abbildung 2.3). Der Körper wird von Gewebe mit konstantem Diffusionskoeffizienten umgeben. Das umgebende Gewebe, in dem Diffusion stattfinden, hat das Volumen . Deshalb ist es möglich, den Volumenanteil in der Form einzuführen. Der Körper mit der Magnetisierung erzeugt das inhomogene Magnetfeld und somit die räumlich variierenden Larmor-Frequenz innerhalb des Voxels. Wie in Abschnitt 2.2.1 gezeigt wurde, ist die lokale Resonanzfrequenz durch
| (2.70) |
gegeben, wobei den Frequenzshift charakterisiert, der durch den magnetisierten Körper erzeugt wird. Auf der anderen Seite wird die Signalentwicklung durch die Diffusion der Spins beeinflusst, die durch die Korrelationszeit veranschaulicht werden kann, wobei eine charakteristische Länge des Körpers und der Diffusionskoeffizient ist. Das Inverse der Korrelationszeit beschreibt eine Frequenz, die mit dem Frequenzshift der Feldinhomogenität verglichen werden muss [46]. Wenn die Diffusion vernachlässigt werden kann (d. h. ), dann gilt das Static-Dephasing-Regime; im anderen Grenzfall kann die Näherung des Motional-Narrowing-Regimes angewandt werden.
Wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben, kann die Zeitentwicklung der transversalen Magnetisierung in allen Diffusionsregimen durch die Bloch-Torrey-Gleichung [31] beschrieben werden: , wobei die lokale Frequenz aus Gleichung (2.70) darstellt. Hierbei ist die Notation der Magnetisierung in Polarform, die am Punkt erzeugt wird. Die über das gesamte Voxel gemittelte Magnetisierung kann als Integral über alle beitragenden Punkte ausgedrückt und deshalb entsprechend Gleichung (2.56) geschrieben werden. Die formale Zeitintegration der Bloch-Torrey-Gleichung kann numerisch ausgewertet werden. Die Zeitabhängigkeit, wie sie in Gleichung (2.56) beschrieben wird, ist im Gradientenecho-Experimenten beobachtbar [16]. Ein äquivalenter Weg zur Beschreibung des Magnetisierungs-Zeit-Verlaufes für diese Art von Experimenten ist die Benutzung der Frequenzverteilung :
| (2.71) |
Um die Signal-Formation bei der Anwendung komplizierterer Sequenzen zu beschreiben (z. B. SSFP-Sequenzen [47, 48]), muss Gleichung (2.71) im Sinne von Gleichung (2.27) verallgemeinert werden [21].
2.4.2 Static-Dephasing-Regime
Dieses Diffusionsregime ist anwendbar, wenn Diffusionseffekte im Vergleich zu den Suszeptibilitätseffekten vernachlässigbar sind, d. h. zur quantitativen Untersuchung kann in Gleichung (2.56) der Diffusionskoeffizient zu gesetzt werden und es resultiert folgender Ausdruck zur Beschreibung des Signals:
| (2.72) |
wobei das Relaxationsvolumen, die lokale Larmor-Frequenz und die Spindichte [6, 21, 49, 50] sind. Um zwischen dem Static-Dephasing-Regime und den anderen Diffusionsregimen unterscheiden zu können, wird der Index Null zur Kennzeichnung des Static-Dephasing-Regimes verwendet. Wird die Dirac-Funktion in die obige Gleichung eingeführt, kann die Magnetisierung in folgender Form geschrieben werden:
| (2.73) | ||||
| (2.74) |
In Analogie zu Methoden der Statistischen Physik [49, 51, 52] kann die Zustandsdichte für die lokale Frequenz wie folgt definiert werden:
| (2.75) |
wobei diese Zustandsdichte sämtliche Eigenschaften einer Wahrscheinlichkeitsdichte
| (2.76) |
besitzt. Wird die Fourier-Darstellung der Diracschen--Distribution genutzt, kann das Integral (2.75) im Prinzip für jede beliebige lokale Larmor-Frequenz analytisch berechnet werden. Für kompliziertere Geometrien kann die Frequenzverteilung numerisch bestimmt werden, indem das Dephasierungsvolumen in kleine Subvoxel aufgeteilt und für jedes Subvoxel die mittlere Larmor-Frequenz bestimmt wird. Die Frequenzverteilung ergibt sich dann als Histogramm der Anzahl der Subvoxel, dargestellt über der zugehörigen Larmor-Frequenz. Jedoch können durch diese Methode keine Diffusionseffekte berücksichtigt werden. Deshalb wird in den nächsten Kapiteln ein anderer Weg zur Beschreibung der Diffusionsabhängigkeit der Frequenzverteilung aufgezeigt.
Kapitel 3 Korrelationszeiten
3.1 Diffusion in lokal inhomogenen Magnetfeldern
Die in Abschnitt 2.2.1 betrachteten Körper im Magnetfeld erzeugen lokale inhomogene Magnetfelder. In diesen lokalen Magnetfeldern findet die Diffusion der signalgebenden Spins statt. Zur Beschreibung der Diffusionsbewegung nutzt man die Korrelationsfunktion, die den zeitlichen Verlauf der Korrelation eines sich bewegenden Spins beschreibt. Die Korrelationsfunktion wurde bereits in Abschnitt 2.3.2 benutzt, um die Diffusion um magnetische Körper im Magnetfeld zu beschreiben. Die Korrelationsfunktion wird von der Form der magnetisierten Körper und den Diffusionseigenschaften des umgebenden Mediums bestimmt. Die Korrelation nimmt mit zunehmender Zeit ab und kann ähnlich wie der Magnetisierungszerfall durch eine exponentielle Funktion approximiert werden, deren charakteristische Abklingkonstante die Korrelationszeit ist [33, 34]. Auch die Einteilung der Diffusionsregime, die in Abschnitt 2.3.3 vorgestellt wurde, basiert auf der Korrelationszeit . Der Spin, der um den Körper im Magnetfeld diffundiert, besucht während seiner Bewegung viele verschiedene Orte und damit präzediert er auch mit vielen verschiedenen Larmor-Frequenzen. Anschaulich beschreibt die Korrelationszeit nun diejenige Zeitspanne, in der sich die Larmor-Frequenz des Spins merklich ändert. Betrachtet man die linke Seite der Abbildung 2.6, so erkennt man, dass im Motional-Narrowing Grenzfall der Spin sich sehr schnell um den kleinen Körper bewegt und somit viele verschiedene Frequenzen besucht. Die Korrelationszeit ist in diesem Fall also sehr klein, da nur für einen kurzen Zeitraum eine nahezu konstante Resonanzfrequenz herrscht. Im Gegensatz dazu befindet sich im Static-Dephasing-Grenzfall der Spin fast immer am gleichen Ort, wie auf der rechten Seite der Abbildung 2.6 verdeutlicht ist. Dadurch präzediert der Spin auch fast immer mit der gleichen Larmor-Frequenz und demzufolge ist die Korrelationszeit sehr lang.
Gewöhnlicherweise wird die transversale Relaxationszeit genutzt, um Gewebeparameter wie die Zelldichte oder den Oxygenierungszustand von Blut zu bestimmen. Die Angabe des Parameters beruht auf der Annahme eines exponentiellen Magnetisierungszerfalls der Form . Wird jedoch der nicht-Gaußsche Charakter der Spindephasierung [35] beachtet, führt eine genauere Betrachtung des Relaxationsprozesses zu dem Ergebnis, dass der exakte Zeitverlauf der Magnetisierung während des freien Induktionszerfalls von der Relaxationszeit im Motional-Narrowing-Grenzfall und von der Korrelationszeit abhängig ist:
| (3.1) |
wobei die Relaxationsrate im Motional-Narrowing Regime nur von der Form des lokalen Magnetfeldes abhängt. So wird z. B. der Magnetisierungszerfall, der vom inhomogenen Magnetfeld um Erythrozyten erzeugt wird, als nicht-gaußförmig beschrieben [36].
Nun stellt sich die Frage, wie die Korrelationszeit von der lokalen Frequenzverteilung und den charakteristischen Dimensionen des magnetisierten Körpers abhängt. Sphärische Objekte wurden zuerst in [37] untersucht, wobei auch eine Korrelationsfunktion gefunden wurde. Die exakte Form der Korrelationsfunktion wurde ausführlich sowohl von Sukstanskii und Yablonskiy [12] als auch von Jensen und Chandra [38] untersucht. Sie konnten zeigen, dass die Zeitabhängigkeit der Korrelationsfunktion nicht exponentiell, sondern algebraisch ist. Sukstanskii und Yablonskiy [12] gaben einen Ausdruck für die Korrelationsfunktion an, wobei auch beliebig geformte Körper beschrieben werden können.
Da in Bildgebungsexperimenten kurze Echozeiten relevant sind, ist ein exponentieller Zerfall der Korrelationsfunktion eine ausreichend genaue Beschreibung. Deshalb wird in der Magnetresonanzbildgebung üblicherweise ein exponentiellen Zerfall der Korrelationsfunktion der Form vorausgesetzt [33]. Die Korrelationszeit wird nun in Abhängigkeit von der lokalen Resonanzfrequenz und den Randbedingungen auf der Oberfläche des Körpers ermittelt. Ein einfacher Ausdruck für die Korrelationszeit, der leicht zu implementieren ist, wird im Folgenden angegeben, und für den Spezialfall von Kugeln und Zylindern können sogar analytische Ausdrücke ermittelt werden.
3.2 Allgemeiner Ansatz
Betrachtet wird ein kompakter, homogen magnetisierter Körper in einem äußeren Magnetfeld (siehe Abbildung 2.3). Die Trajektorie eines um den Körper diffundierenden Spins wird verfolgt. Außerhalb des magnetischen Körpers werden homogene Diffusionseigenschaften angenommen, d. h. äußere Potentiale oder Einschränkungen durch Membranen oder andere Strukturen werden vernachlässigt. Anstatt die Diffusion im gesamten Gewebe zu betrachten, wird nur das Relaxationsvolumen um das magnetische Objekt betrachtet (Abbildung 2.3). Die Form dieses Relaxationsvolumens ist abhängig von der Form des Objektes, d. h. im Falle einer homogen magnetisierten Kugel mit dem Radius ist das Relaxationsvolumen der Raum zwischen zwei konzentrischen Kugeln mit den Radien und , wie in Abbildung 2.4 dargestellt. Der Volumenanteil ist dann gegeben durch . Analog dazu ist im Falle von Zylindern das Relaxationsvolumen der Raum zwischen zwei konzentrischen Zylindern mit den Radien und , und der Volumenanteil ist (siehe Abbildung 2.5). Die Diffusion wird damit eingeschränkt auf den Raum zwischen zwei konzentrischen Objekten mit den Radien und , d. h. periodische Randbedingungen werden an der äußeren Oberfläche des Relaxationsvolumens angenommen. Es ist wichtig zu betonen, dass die äußere Begrenzung mit dem Radius nur eine mathematische Grenze ist und nicht mit irgendwelchen biologischen Membranen verwechselt werden darf. Die Gründe für diese Einschränkungen und die daraus folgenden mathematischen Implikationen wurden bereits im Detail diskutiert [39].
Die Zweipunktkorrelationsfunktion der stochastischen Feldfluktuationen, denen ein Spin unterliegt, ist definiert als
| (3.2) |
wobei die Wahrscheinlichkeitsdichte dafür ist, einen Spin an der Position nach der Zeit zu finden, wenn die ursprüngliche Position zur Zeit angenommen wurde. Die Wahrscheinlichkeitsdichte der Gleichgewichtsverteilung ist in unserem Fall identisch mit der Spindichte, welche als homogen angenommen wird, d. h.
| (3.3) |
wobei das Dephasierungsvolumen ist (im Falle von Kugeln ist dieses das Volumen zwischen zwei konzentrischen Kugeln mit den Radien und ). Die Wahrscheinlichkeit erfüllt die Smoluchowski-Gleichung , mit dem zugehörigen Wahrscheinlichkeitsstrom . Unter der Annahme freier Diffusion innerhalb der Grenzen ist die Wahrscheinlichkeit die Greensche Funktion der Diffusionsgleichung
| (3.4) | ||||
| (3.5) |
wobei der Diffusionskoeffizient ist.
Während an der äußeren Oberfläche des Relaxationsvolumens (im dreidimensionalen Fall die Kugel mit dem Radius oder im zweidimensionalen Fall der Zylinder mit dem Radius ) reflektierende Randbedingungen angenommen werden, wird an der inneren Oberfläche zwischen reflektierenden und strahlenden Randbedingungen unterschieden. Im Falle einer impermeablen inneren Oberfläche werden die Trajektorien der diffundierenden Spins durch eine symmetrische Trajektorie fortgesetzt, sobald der Spin die innere Oberfläche berührt, d. h. reflektierende Randbedingungen werden angenommen:
| (3.6) |
Die reflektierenden Randbedingungen an der äußeren Oberfläche umhüllen das System und verhindern das Entweichen der Spins ins Unendliche. Deshalb verschwindet der korrespondierende Strom an dieser Oberfläche: . Wenn der Austausch von signalgebenden Protonen zwischen dem Relaxationsvolumen und dem magnetisierten Objekt berücksichtigt werden soll, müssen an der inneren Oberfläche strahlende Randbedingungen in der Form
| (3.7) |
angenommen werden, wobei eine mikroskopische Reflexionsrate ist, welche die Permeabilität der inneren Oberfläche beschreibt [40].
Das Einsetzen der Wahrscheinlichkeitsdichten, die in den Gleichungen (3.5) und (3.3) gegeben sind, in die Definition der Korrelationsfunktion aus Gleichung (3.2) liefert
| (3.8) |
Im Allgemeinen zeigt die Korrelationsfunktion keinen einfachen exponentiellen Abfall, wie oft angenommen wird [34]. Dies erschwert eine einfache Bestimmung der Korrelationszeit. Eine geeignete Definition der Korrelationszeit besteht darin, sie gemäß [32] als mittlere Relaxationszeit der Korrelationsfunktion zu definieren:
| (3.9) |
Eine übliche Näherung für die Korrelationsfunktion ist ein einfacher exponentieller Abfall der Form . Im Falle uneingeschränkter Diffusion konnte von Jensen und Chandra [38] gezeigt werden, dass die Korrelationsfunktion durch eine algebraische Funktion besser approximiert werden kann. Einsetzen von Gleichung (3.8) in Gleichung (3.9) ergibt
| (3.10) |
wobei die Varianz des lokalen Magnetfeldes durch
| (3.11) |
gegeben ist, mit als dem Volumenanteil des magnetischen Materials innerhalb des Voxels. Die Relation stimmt mit dem allgemeinen Ergebnis, wie es in Gleichung (1) in [12] angegeben wird, überein. Wird der allgemeine Ausdruck in Gleichung (3.10) genutzt, kann ein Zusammenhang zwischen der Korrelationszeit , dem Volumenanteil , dem Radius des Störkörpers und dem Diffusionskoeffizienten gefunden werden. Dies führt zu einer Relation, wie sie auch in Gleichung (15) der Veröffentlichung von Stables et al. [33] angegeben wird.
3.3 Spezielle Geometrien
Der oben erhaltene allgemeine Ausdruck (3.10) zur Quantifizierung der Korrelationszeit wird auf zwei Formen von magnetischen Objekten angewandt, nämlich auf Kugeln und Zylinder. Um das Integral (3.10) zu lösen, muss zuerst eine Funktion gefunden werden, welche die Beziehung
| (3.12) |
erfüllt. Im Falle von Kugeln und Zylindern kann diese Funktion analytisch gefunden werden. Für komplizierter geformte Objekte muss die Laplace-Gleichung numerisch gelöst werden. Des Weiteren muss die Funktion die reflektierenden Randbedingungen nach Gleichung (3.6)
| (3.13) |
an der äußeren Oberfläche des Relaxationsvolumens erfüllen. Im Falle strahlender Randbedingungen an der inneren Oberfläche genügt die Funktion der Beziehung
| (3.14) |
wobei die Permeabilität der Oberfläche beschreibt. Wenn die Oberfläche des magnetischen Körpers impermeabel ist (), wird der Spin an der Oberfläche reflektiert, d. h. im Falle reflektierender Randbedingungen an der inneren Oberfläche gilt für der Zusammenhang
| (3.15) |
3.3.1 Kugel
Die lokale Resonanzfrequenz um eine homogen magnetisierte Kugel ist in Gleichung (2.48) gegeben. Die Stärke der Feldinhomogenität wird durch den charakteristischen äquatorialen Frequenzshift beschrieben. Der Erwartungswert des lokalen Magnetfeldes wird durch Einsetzen des lokalen Magnetfeldes in die Gleichung (3.11) erhalten:
| (3.16) |
Das Ergebnis ist identisch mit dem von Jensen und Chandra [38], Gleichung (18), oder dem von Stables et al. [33], Gleichung (8). Zur Lösung der Laplace-Gleichung (3.12) für ein Dipolfeld, wird der Ansatz
| (3.17) |
genutzt. Die Anwendung des Laplace-Operators in Kugelkoordinaten auf die Funktion ergibt für die radiale Funktion die Differentialgleichung . Diese Differentialgleichung vom Eulerschen Typ kann in eine inhomogene Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten transformiert werden. Zur Lösung wird die Substitution genutzt und damit ergibt sich für die radiale Funktion
| (3.18) |
wobei die Integrationskonstanten und durch die Randbedingungen an der inneren und äußeren Oberfläche festgelegt sind. Wird der Ausdruck (3.17) zur Lösung der inhomogenen Laplace-Gleichung (3.12) genutzt, reduziert sich der Ausdruck für die Korrelationszeit (3.10) auf die einfache Form
| (3.19) |
Im Falle strahlender Randbedingungen an der inneren Grenzfläche ergibt sich mit der Gleichung (3.14) für die Integrationskonstanten
| (3.20) |
mit der Abkürzung
| (3.21) |
Mit Gleichung (3.15) ergibt sich bei reflektierenden Randbedingungen an der inneren Grenzfläche für die Integrationskonstanten:
| (3.22) |
Die Korrelationszeit im Falle strahlender Randbedingungen wird also durch den Ausdruck
| (3.23) |
beschrieben. Ist die innere Kugel impermeabel, hängt die Korrelationszeit nur vom Volumenanteil, vom Kugelradius und vom Diffusionskoeffizienten ab. Mit der Abkürzung
| (3.24) |
ergibt sich für die Korrelationszeit der Ausdruck:
| (3.25) |
Gleichung (3.25) erhält man auch, wenn in der Gleichung für strahlende Randbedingungen der Koeffizient gesetzt wird. Eine Taylor-Entwicklung in führt zu einem einfachen Zusammenhang zwischen der Korrelationszeit und dem Volumenanteil im Falle eines permeablen Kerns, nämlich zu
| (3.26) |
Wird in dieser Gleichung den Koeffizienten gesetzt oder eine Taylor-Entwicklung von Gleichung (3.25) durchgeführt, erhält man
| (3.27) |
für die Korrelationszeit im Falle eines impermeablen Kerns.
Zur Veranschaulichung der Ergebnisse ist in Abbildung 3.1 die Korrelationszeit in Abhängigkeit vom Volumenverhältnis für verschiedene Werte des Permeabilitätskoeffizienten dargestellt. Bei vorgegebenem Volumenverhältnis ist die Korrelationszeit am größten, wenn die Kugel impermeabel ist (). In diesem Fall wird der Spin an der Oberfläche der Kugel reflektiert und der Spin bewegt sich kurz nach der Reflexion in einem lokalen Magnetfeld, dessen Wert fast genau so groß ist, wie kurz vor der Reflexion. Der Spin präzediert also länger mit der nahezu gleichen Resonanzfrequenz, und deshalb ist in diesem Fall die Korrelationszeit auch länger. Ist die Kugel hingegen durchlässig, wird der Spin nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit reflektiert, ein gewisser Anteil dringt auch in die Kugel ein und trägt dann nicht mehr zum Signal bei. Mit steigender Permeabilität nimmt also die Korrelationszeit ab.
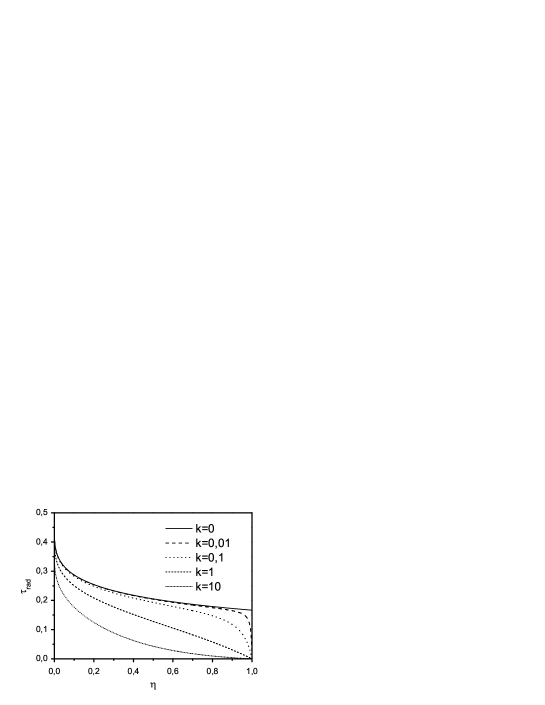
3.3.2 Zylinder
Wird ein homogen magnetisierter Zylinder untersucht, muss dessen Orientierung zum äußeren Magnetfeld berücksichtigt werden. Die lokale Resonanzfrequenz ist abhängig vom Neigungswinkel zwischen der Zylinderachse und der Richtung des äußeren Magnetfeldes . Auf der linken Seite der Abbildung 2.5 ist der Querschnitt durch den Zylinder und durch das Dephasierungsvolumen zu sehen, wobei zweidimensionale Polarkoordinaten genutzt werden. Die lokale Resonanzfrequenz um den Zylinder ist in Gleichung (2.53) gegeben. Die Varianz dieser lokalen Resonanzfrequenz folgt direkt aus Gleichung (3.11) als
| (3.28) |
was mit dem Ergebnis von Stables at al. [33] übereinstimmt. Wird der vom Winkel abhängige Anteil der lokalen Frequenz (2.53) betrachtet, kann in Analogie zum Ansatz (3.17) im Falle von Zylindern der Ausdruck verwendet werden, was zu der Differentialgleichung mit der Lösung führt. Nach Ausführung der gleichen Schritte wie im sphärischen Fall ergibt sich ein analoger Ausdruck für die Korrelationszeit, und zwar
| (3.29) |
für strahlende Randbedingungen und
| (3.30) |
für reflektierende Randbedingungen, was mit dem Ergebnis von Bauer et al. [8] übereinstimmt.
3.4 Anwendungen
3.4.1 Diffusionsregime
In Abschnitt 2.3.3 wurde gezeigt, dass die Korrelationszeit eine wesentliche Größe ist, die zur Einteilung der Diffusionsregime notwendig ist. So gaben Yablonskiy und Haacke in ihrer Gleichung (55) der Arbeit [6] die empirische Bedingung
| (3.31) |
an, die erfüllt sein muss, damit die Diffusion um die Kugel vernachlässigt werden kann. Anhand der Ungleichung (3.31) lässt sich somit feststellen, ob das Static-Dephasing-Regime das zu Grund liegende Diffusionsregime ist. In diese Betrachtungen geht jedoch die Permeabilität des Körpers nicht mit ein. Mit den oben erhaltenen Resultaten kann nun die exakte Einteilung der Diffusionsregime auf mathematischer Basis erfolgen. Werden die Ergebnisse für die Korrelationszeit und deren Abhängigkeit vom Volumenanteil genutzt, können ähnliche Ausdrücke wie die von Yablonskiy und Haacke empirisch gefundenen ableitet werden. Im Falle von kugelförmigen Objekten ergibt sich aus Gleichung (3.27) für das Static-Dephasing-Regime () das Kriterium
| (3.32) |
Analog dazu kann für zylindrische Objekte ein ähnliches Kriterium für die Gültigkeit des Static-Dephasing-Regimes angegeben werden.
Die Korrelationszeit kann nun zur Beantwortung konkreter Fragestellungen angewandt werden. Sie kann beispielsweise genutzt werden, um magnetisch markierte Zellen zu beschreiben. In der Arbeit „Application of the static dephasing regime theory to superparamagnetic iron-oxide loaded cells“ untersuchten Bowen et al. [53] das Relaxationsverhalten eisenbeladener Zellen. Typische Parameter waren in dieser Arbeit ein Volumenanteil von , ein Diffusionskoeffizient und ein Frequenzshift von . Die zum Markieren benutzten Kontrastmittelteilchen wurden von Lymphozyten phagozytiert, die einen mittleren Radius von hatten. Aus Gleichung (3.27) ergibt sich für die Korrelationszeit der Wert , was der dynamischen Frequenz entspricht. Diese dynamische Frequenz ist wesentlich kleiner als der charakteristische Frequenzshift, und deshalb kann das Static-Dephasing-Regime als das zugrunde liegende Diffusionsregime angesehen werden.
Die Korrelationszeit um Zylinder kann genutzt werden, um den Diffusionsprozess im Myokard zu quantifizieren [8]. In diesem Fall ist der Volumenanteil äquivalent zum regionalen Blutvolumen . Der typische Radius einer Kapillare im Myokard beträgt [54]. Mit einem typischen Wert für den Diffusionskoeffizienten von ergibt sich aus Gleichung (3.30) für die Korrelationszeit der Wert , was der dynamischen Frequenz entspricht. Der charakteristische Frequenzshift auf der Oberfläche einer Kapillare im Myokard beträgt [55]. In diesem Fall haben die dynamische Frequenz und die charakteristische Frequenz die gleiche Größenordnung. Deshalb wird die Spindephasierung im Myokard dem intermediären Diffusionsregime zugeordnet. Hier sind weder die Ausdrücke des Motional-Narrowing-Grenzfalls noch die des Static-Dephasing-Grenzfalls anwendbar.
3.4.2 Relaxationsraten
Die Spindephasierung, die durch die Magnetfeldinhomogenitäten verursacht wird, beeinflusst den Magnetisierungszerfall. Dieser kann für alle Diffusionsregime durch die Bloch-Torrey-Gleichung [31] beschrieben werden. Die Signalentstehung im Static-Dephasing-Regime [6] wurde für den sphärischen Fall [49] und den zylindrischen Fall [51] ausführlich untersucht. Mittels der oben erhaltenen Ergebnisse für die Korrelationszeiten können nun die Relaxationsraten im Motional-Narrowing-Regime bestimmt werden. In diesem Diffusionsregime wird der Signalverlust hauptsächlich durch die Dephasierung aufgrund der Diffusion der Spins im inhomogenen Magnetfeld hervorgerufen. Im Gegensatz zum Static-Dephasing-Grenzfall kann der Signalverlust im Motional-Narrowing-Regime nicht durch Spinechos refokussiert werden.
Im Motional-Narrowing-Regime sind die Frequenzfluktuationen, die durch den Diffusionsprozess verursacht und durch das Inverse der Korrelationszeit charakterisiert werden, größer als die durch die Feldinhomogenität erzeugte Frequenzverschiebung, d. h. . In diesem Fall ist die Relaxationsrate durch die einfache Beziehung
| (3.33) |
gegeben, wobei für Kugeln und Zylinder in Gleichung (3.16) und Gleichung (3.28) gegeben sind. In Abbildung 3.2 werden die Relaxationsraten in Abhängigkeit vom Volumenanteil für Kugeln und Zylinder miteinander verglichen.
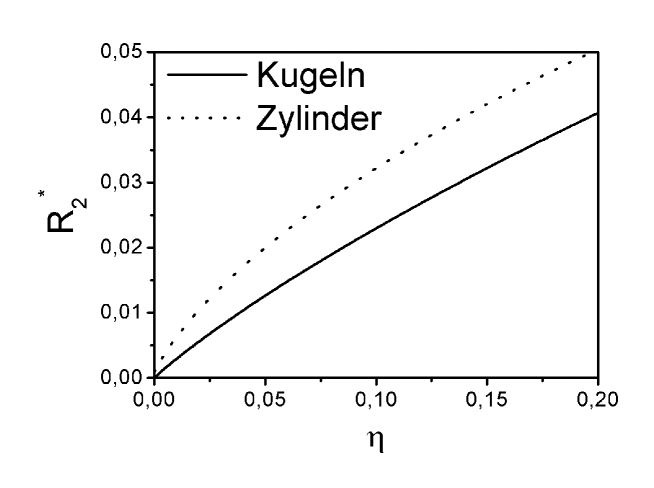
Im Falle kleiner Volumenanteile ergibt sich aus den beiden Gleichungen (3.33) und (3.27) der einfache Ausdruck für die Relaxationsrate einer Suspension kleiner Kugeln
| (3.34) |
welcher mit den Ergebnissen von Moiny et al. [56] und Brooks et al. [57] übereinstimmt. Mit der allgemeinen Beziehung (3.33) ergibt sich damit die Korrelationszeit
| (3.35) |
Die auf diesem Wege erhaltene Korrelationszeit stimmt auch mit dem ersten Glied der Taylor-Entwicklung aus Gleichung (3.27) überein.
Jensen und Chandra [38] bestimmten die Relaxationsrate im Falle eines durchlässigen Kerns zu
| (3.36) |
Die Kombination dieses Ergebnisses mit dem allgemeinen Ausdruck (3.33) führt zur Korrelationszeit, die den Diffusionsprozess um eine durchlässigen Kern beschreibt:
| (3.37) |
Zur Ableitung der obigen Ergebnisse wurde die Näherung benutzt, dass benachbarte Feldinhomogenitäten keinen Einfluss auf das betrachtete Voxel haben. Um den Gültigkeitsbereich dieser Näherung zu quantifizieren, wird zuerst der Fall von Kapillaren betrachtet. Es wird eine regelmäßige Anordnung der Kapillaren angenommen, d. h. im Querschnitt befindet sich die Kapillare im Zentrum eines Hexagons und hat sechs gleichnahe Nachbarn. Jedes Hexagon mit der Seitenlänge und der Fläche wird in diesem Modell durch einen Kreis mit dem Radius und dem gleichen Flächeninhalt ersetzt. Der Abstand zwischen zwei Kapillaren ist demzufolge . Der Einfluss benachbarter Kapillaren kann vernachlässigt werden, wenn die charakteristische Frequenz an der Oberfläche einer Kapillare viel größer ist als die Frequenz, die durch die sechs umgebenden Kapillaren im Abstand erzeugt wird. Mit diesen geometrischen Anschauungen ergibt sich nach Gleichung (2.53) die Ungleichung , was zu einer Abschätzung für den Volumenanteil führt: .
Im dreidimensionalen Fall der regelmäßigen Anordnung ist jede Kugel im Zentrum eines Rhombendodekaeders (der Wigner-Seitz-Zell eines fcc-Bravais-Gitters) von zwölf gleichnahen Nachbarn umgeben. In diesem Modell wird jeder Rhombendodekaeder mit der Seitenlänge und dem Volumen durch eine Kugel mit dem Radius und dem gleichen Volumen ersetzt. Daraus folgt, dass der Abstand zur nächsten Kugel beträgt. Der Einfluss des Magnetfeldes benachbarter Kugeln kann vernachlässigt werden, wenn die charakteristische Frequenz auf der Oberfläche einer Kugel viel größer ist als die Frequenz, die durch die zwölf umgebenden Kugeln im Abstand erzeugt wird. Mit diesen geometrischen Anschauungen ergibt sich nach Gleichung (2.53) die Ungleichung , was zu einer Abschätzung für den Volumenanteil führt: .
Innerhalb des Diffusionsraumes werden also nur die Wechselwirkung eines Kernspins mit dem Magnetfeld einer Kugel oder eines Zylinders betrachtet, d. h. die Beiträge benachbarter Körper werden nicht berücksichtigt. In einem Gewebe, in dem der magnetisierte Körper einen kleinen Volumenanteil besitzt und dieser nur ein schwaches lokales Magnetfeld erzeugen, ist die Vernachlässigung der umgebenden Störkörper gerechtfertigt und die Näherungen in den Gleichungen (3.26) und (3.27) sind gültig.
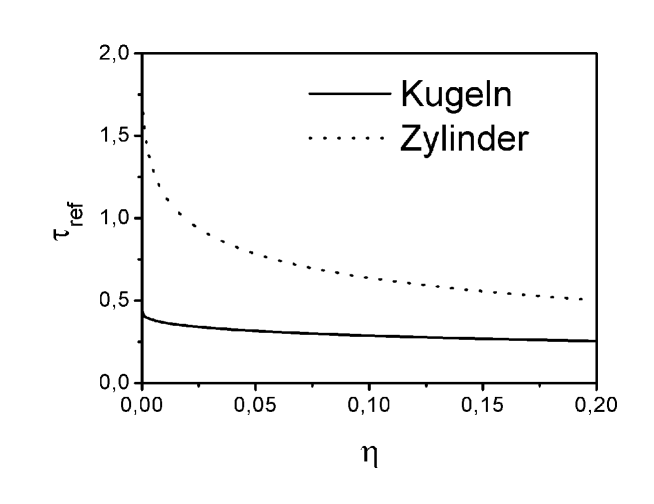
Kapitel 4 Frequenzverteilungen
4.1 Formalismus zur Beschreibung der Frequenzverteilung
Bereits in Abschnitt 2.4 wurde dargestellt, wie das Signal aus einem Voxel, das einen magnetischen Körper enthält, untersucht werden kann. Der magnetische Körper erzeugt ein lokales inhomogenes Magnetfeld innerhalb des Voxels. Die Spins bewegen sich aufgrund der Diffusion in diesem Feld und beeinflussen dadurch das Dephasierungsverhalten. Diese Dephasierungseffekte können genutzt werden, um Informationen über das untersuchte Gewebe zu erhalten. So konnten aus diesen Informationen z. B. die Zelldichte [58] oder die Kapillardichte im Myokard [8, 9] bestimmt werden. Um dies zu erreichen werden Modelle benötigt, welche den zeitlichen Signalverlauf in Abhängigkeit von der Anordnung der magnetischen Körper beschreiben. Da diese magnetischen Körper ein inhomogenes Magnetfeld erzeugen, das die Relaxation der signalgebenden Spins beschleunigt, ist die Information über die Anordnung der magnetischen Körper im Zeitverlauf des Magnetisierungszerfalls oder äquivalent dazu im zugehörigen Frequenzspektrum enthalten.
Um den Signal-Zeit-Verlauf exakt zu beschreiben, muss, wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben wurde, zuerst aus der Form des Körpers die lokale Resonanzfrequenz bestimmt werden. Dann wird die Bloch-Torrey-Gleichung für diese lokale Resonanzfrequenz gelöst, wie es in Abschnitt 2.3.1 dargestellt wurde. Unter Berücksichtigung der Diffusionseffekte ist dies sehr mühsam und nur in Spezialfällen möglich, z. B. wenn die Frequenz ist, welche durch einen linearen Gradienten erzeugt wird [31, 59]. Alternativ dazu ist es möglich, die Bloch-Torrey-Gleichung numerisch zu lösen. Dies wurde beispielsweise genutzt, um die Effekte der Kantenverstärkung durch Diffusion zu beschreiben [60, 61, 62], und zwar unter Anwendung der Linienform-Theorie von Kubo [63, 64]. Eine weitere Methode zur Beschreibung der transversalen Relaxation stellten kürzlich Kiselev und Posse [10, 65] vor. Hierbei nutzten sie analytische Modelle für sehr lange und sehr kurze Korrelationszeiten. Das Modell für lange Korrelationszeiten erweitert das Static-Dephasing-Regime und das Modell für kurze Korrelationszeiten basiert auf einem Störungsansatz im lokalen Magnetfeld. Jedoch sind diese Ergebnisse auf Spezialfälle begrenzt, was deren Anwendbarkeit einschränkt. Ein anderer Ansatz zur Beschreibung der Spindephasierung über den gesamten Dynamikbereich ist die Gaußsche Dephasierung [11, 12, 13], die jedoch nur anwendbar ist, solange die Dynamik auf eine eingeschränkte Klasse stochastischer Prozesse beschränkt bleibt [35]. Die Lösung der Bloch-Torrey-Gleichung kann auch durch die Strong-Collision-Approximation beschrieben werden [66]. Um dem Nicht-Gaußschen Charakter der Diffusion gerecht zu werden, wird diese Approximation in der vorliegenden Arbeit genutzt.
Im folgenden Teil der Arbeit wird ein anderer Weg zur Beschreibung der Anordnung der Feldinhomogenitäten gegangen. Wie in Abschnitt 2.1 dargestellt, beeinflussen verschiedene Parameter das Signal, das in dem Voxel entsteht, welches den magnetisierten Körper enthält. Sowohl die genutzte Sequenz und ihre Parameter als auch die Verteilung der Feldinhomogenitäten im Gewebe beeinflussen das entstehende Signal (siehe auch Abbildung 2.2). Um Informationen über die Signalentwicklung zu erhalten, wird die Frequenzverteilung, die durch die räumliche Verteilung der Feldinhomogenitäten bestimmt wird, untersucht.
Für viel Probleme der Bildgebung stellt sich oft die Frage, welche Sequenz mit welchen Parametern zu nutzen ist. Um diese Frage zu beantworten ist es notwendig, das zu untersuchende Gewebe durch seine Frequenzverteilung zu charakterisieren. Für eine vorgegebene Anordnung der magnetischen Körper innerhalb des Voxels hat die Frequenzverteilung eine typische Form. Die Kenntnis über die Form der Frequenzverteilung erlaubt eine Wahl der Bildgebungssequenz mit den optimalen Parametern, um Informationen über die Gewebeeigenschaften zu erhalten.
Zuerst wird die Frequenzverteilung im Static-Dephasing-Regime untersucht, d. h. Diffusionseffekte um die magnetischen Körper werden vernachlässigt. Für die beiden wichtigen Spezialfälle Kugel und Zylinder können die Frequenzverteilungen explizit angegeben werden. In beiden Fällen ist die typische Form der Frequenzverteilung abhängig von der Suszeptibilitätsdifferenz zwischen dem magnetisierten Objekt und dem umgebenden Gewebe, von der Stärke des äußeren Magnetfeldes und auch vom Volumenanteil des magnetischen Materials innerhalb des Voxels.
Ein wichtiger Faktor, der die Frequenzverteilung und demzufolge auch die Signalentstehung im Voxel beeinflusst, ist die Diffusion der Wassermoleküle in den lokalen Magnetfeldinhomogenitäten [67]. Während das Static-Dephasing-Regime gut verstanden ist [6, 21], sind Diffusionseffekte nur bei speziellen Geometrien untersucht worden. Im Gegensatz dazu wird hier eine rigorose Ableitung der Frequenzverteilung innerhalb des Voxels angegeben [68]. Dabei wird sowohl die Form der Körper, welche die Suszeptibilitätsdifferenz erzeugen, als auch die Diffusion um diese Körper berücksichtigt. Um den Diffusionsprozess zu beschreiben, wurde eine Strong-Collision-Approximation genutzt, welche die Diffusionsdynamik durch einen einfacheren stochastischen Prozess ersetzt. Damit ist es möglich einen Formalismus herzuleiten, der die Frequenzverteilung um beliebig geformte magnetische Körper beschreiben kann.
4.1.1 Erweiterung auf alle andere Diffusionsregime
Um einen Ausdruck für die Frequenzverteilung zu finden ist es zweckmäßig, mit einer Verallgemeinerung von Gleichung (2.74) auf alle Diffusionsregime zu beginnen, wonach das Signal als Fourier-Transformierte der Frequenzverteilung geschrieben werden kann:
| (4.1) |
Sowohl die Magnetisierung als auch die Frequenzverteilung sind nun vom Diffusionskoeffizienten abhängig. Im Grenzfall stimmen und bzw. und überein. Die Frequenzverteilung wiederum ist die Fourier-Transformierte des Signals:
| (4.2) | ||||
| (4.3) |
wobei die Laplace-Transformierte der Magnetisierung durch Gleichung (2.65) definiert ist. Hierbei wurde der Zusammenhang zwischen Laplace-Transformation und Fourier-Transformation genutzt. Für negative Zeiten wurde eine analytische Fortsetzung des Magnetisierungs-Zeit-Verlaufes in der Form angenommen. Der Vorteil beim Benutzen der Laplace-Transformation besteht darin, dass nach Gleichung (2.68) eine Relation zwischen der Laplace-Transformierten des Magnetisierungs-Zeit-Verlaufs im Static-Dephasing-Regime und dem Magnetisierungs-Zeit-Verlauf in allen anderen Diffusionsregimen existiert. Um dieses Ergebnis zu erhalten, wurde die Strong-Collision-Näherung benutzt, die den Laplace-Operator in der Bloch-Torrey-Gleichung durch einen einfacheren stochastischen Prozess ersetzt [8, 41]. Obiges Ergebnis gilt, solange die Korrelationszeit kleiner ist als die transversale Relaxationszeit des Magnetisierungszerfalls. Wie in Kapitel 3 gezeigt wurde, kann die Korrelationszeit nach Gleichung (3.10)
| (4.4) |
genutzt werden, um die Zeitskala der durch die molekulare Bewegung induzierten Feldfluktuationen zu beschreiben.
Die Laplace-Transformierte des Magnetisierungszerfalls im Static-Dephasing-Regime kann aus Gleichung (2.74) oder aus Gleichung (2.72) ermittelt werden:
| (4.5) | ||||
| (4.6) | ||||
| (4.7) |
Einsetzen von Gleichung (4.7) in Gleichung (2.68) und Verwenden von Gleichung (4.3) ergibt letztlich einen allgemeinen Ausdruck für die Frequenzverteilung:
| (4.8) |
Dieser Ausdruck ist die Verallgemeinerung von Gleichung (2.75) auf alle Diffusionsregime. Die diffusionsabhängige Frequenzverteilung ist also nur von der Korrelationszeit und der lokalen Larmor-Frequenz abhängig. Obwohl der Ausdruck für diese Frequenzverteilung eine einfache Struktur hat, sind analytische Lösungen nur für wenige Spezialfälle möglich.
Aus Gleichung (2.68) ergibt sich im Grenzfall kleiner Korrelationszeiten , was entsprechend dem Fourier-Theorem zu einem Delta-Peak für die Frequenzverteilung im Motional-Narrowing-Regime führt: . Wie erwartet, streben alle Observablen im Grenzfall sich nicht bewegender Spins zu ihrem Grenzwert des Static-Dephasing-Regimes, d. h. , was letztlich zu der Frequenzverteilung des Static-Dephasing-Regimes aus der Gleichung (2.75) führt: .
Bisher wurden nur Gradientenecho-Sequenzen oder Sequenzen, die im Sinne von Gleichung (2.27) beschrieben werden können, betrachtet. Um jedoch z. B. den Magnetisierungs-Zeit-Verlauf eines klassischen Hahnschen Spinecho-Experimentes (siehe Abbildung 4.1) beschreiben zu können [69], kann man von den Ergebnissen der Gradientenecho-Sequenz ausgehen. Aus dem freien Induktionszerfall der Gradientenecho-Sequenz nach Gleichung (4.1) kann man den Magnetisierungs-Zeit-Verlauf eines Spinechos folgendermaßen berechnen [55]:
| (4.9) |
Um beispielsweise eine SSFP-Sequenz zu beschreiben, kann der Ausdruck (2.27) benutzt werden.
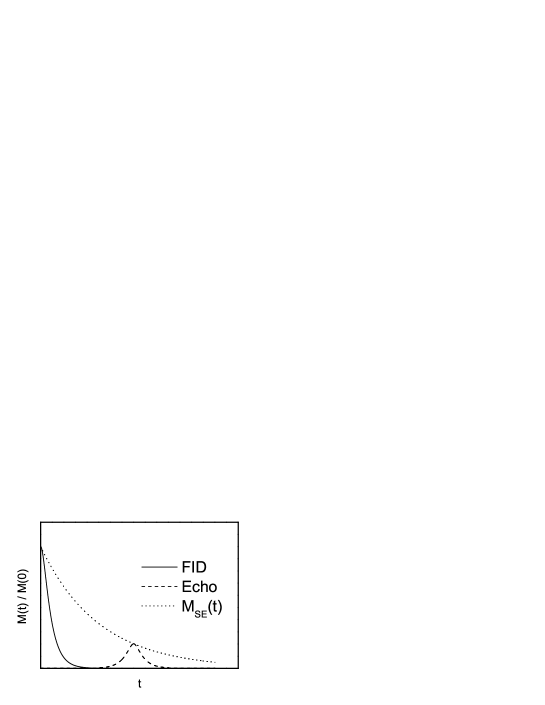
Die Bloch-Torrey-Gleichung hat die Form einer Schrödinger-Gleichung mit rein imaginärem Potential im Hamilton-Operator. Aufgrund dieses imaginären Potentials ist der Hamilton-Operator nicht-hermitesch, was die Entwicklung der Lösung in ein vollständiges Orthonormalsystem verhindert. Damit liefern die oben beschriebenen Methoden ein praktisches Verfahren zum Lösen der Bloch-Torrey-Gleichung in der Strong-Collision-Näherung. Weitere Analogien zur Quantenmechanik lassen sich aus Gleichung (2.75) erkennen. Die lokale Resonanzfrequenz entspricht der Dispersionsrelation eines angeregten Ensembles (z. B. eines Elektronengases). In diesem Bild entspricht der Diffusionskoeffizient der Temperatur und Gleichung (4.8) ist die Verallgemeinerung von Gleichung (2.75) auf endliche Temperaturen.
4.2 Anwendung auf inhomogene Gewebe
Die im vorigen Abschnitt abgeleitete allgemeine Theorie kann genutzt werden, um die Frequenzverteilung für jedes Diffusionsregime zu berechnen, das durch einen beliebig geformten Körper erzeugt wird. Um die Allgemeingültigkeit der Theorie zu demonstrieren, wird der Formalismus zuerst unabhängig von der Form des magnetischen Körpers entwickelt und im Nachhinein auf einige Spezialfälle angewandt, um auch analytische Ausdrücke zu erhalten.
4.2.1 Allgemeine Ausdrücke
Um allgemeine Ausdrücke zu erhalten wird vorausgesetzt, dass das Voxel die gleiche Form wie der magnetische Körper besitzt, d. h. das Voxel entsteht aus der Form des Körpers durch eine zentrische Streckung. Dies bedeutet, dass im Falle eines zylinderförmigen magnetisierten Körpers das Voxel auch zylinderförmig ist (siehe Abbildung 2.5). Diese Vorgehensweise erfolgt analog zum aus der Physiologie bekannten Kroghschen Kapillarmodell [29], bei dem eine zylinderförmige Kapillare von einem zylinderförmigen Versorgungsgebiet umgeben ist. Es wird angenommen, dass der Volumenanteil sehr klein ist und die Bedingung erfüllt. Deshalb ist die wahre Form des Voxels irrelevant und das ursprüngliche Voxel kann durch ein kubisches Voxel gleichen Volumens ersetzt werden [6, 51]. Durch diese Annahme ist es möglich, den Magnetisierungs-Zeit-Verlauf im Static-Dephasimg-Regime entsprechend Gleichung (2.72) in der Form
| (4.10) |
zu schreiben, wobei die Funktion nur von der Form des Körpers abhängig ist. Die Existenz und Eindeutigkeit dieser Funktion werden durch den Hauptsatz der Differential-und Integralrechnung gesichert. Obere und untere Grenze des Integrals in Gleichung (2.72) sind die Oberfläche des Voxels und die Oberfläche des magnetisierten Körpers. Die Funktion kann sowohl numerisch als auch analytisch für jede beliebige Form des Körpers ermittelt werden. Für den Spezialfall von kugelförmigen und zylinderförmigen Objekten kann die Funktion analytisch angegeben werden. In Analogie zur Gleichung (4.10), die den Signal-Zeit-Verlauf beschreibt, kann die Laplace-Transformierte des Signal-Zeit-Verlaufs in der Form
| (4.11) |
geschrieben werden, wobei die Funktion auch einzig von der Form des Objektes abhängt.
Zur Charakterisierung der Diffusionseffekte muss die Korrelationszeit entsprechend Gleichung (3.10) ausgewertet werden. Wie in [33, 44, 45] gezeigt, ist die Integration direkt ausführbar und liefert folgende Relation:
| (4.12) |
wobei eine charakteristische Länge des Körpers ist (z. B. der Radius des Zylinders oder der Kugel). Wie in [45] dargestellt, ist die Funktion auch nur von der Form des Körpers abhängig.
Um einen Ausdruck für die Frequenzverteilung zu finden, muss Gleichung (4.8) ausgewertet werden. Somit erhält man letztlich
| (4.13) |
Dieser Ausdruck stellt die Frequenzverteilung in Abhängigkeit von der Diffusion (charakterisiert durch die Korrelationszeit ), vom Suszeptibilitätseffekt (charakterisiert durch den in Gleichung (2.43) gegebenen Frequenzshift ) und von der Form des Körpers (charakterisiert durch die Funktion ) dar. Für zylinderförmige und kugelförmige Körper werden analytische Ausdrücke für die Funktion in den nächsten Abschnitten angegeben.
4.2.2 Kugel
Der erste analytisch lösbare Fall ist der einer homogen magnetisierten Kugel in einem äußeren Magnetfeld. Die Frequenzverteilung und die Signaleigenschaften im Static-Dephasing-Regime wurden von Cheng et al. [49] analytisch untersucht. Diese Ergebnisse wurden von Seppenwoolde et al. [70] experimentell bestätigt. Um die Signalentstehung im Lungengewebe zu beschreiben, wurden die Alveolen als Kugeln betrachtet, die von einer wassergefüllten Kugelschale umgeben sind [71, 72, 73, 74]. In diesen Arbeiten wurde die Frequenzverteilung entsprechend der in Abschnitt 2.4.2 dargestellten Histogramm-Technik numerisch ermittelt. Bowen et al. [53] haben das Static-Dephasing-Regime zur Beschreibung der Signalentstehung um magnetisch markierte Zellen angewandt. Die lokale Resonanzfrequenz um eine Kugel ist in Gleichung (2.48) gegeben. In Analogie zum zylindrischen Fall ist die Kugel im Zentrum eines kugelförmigen Voxels mit dem Radius lokalisiert (siehe Abbildung 2.4). Einsetzen der lokalen Resonanzfrequenz aus Gleichung (2.48) in Gleichung (2.75) und Integration über das Relaxationsvolumen liefert die Frequenzverteilung im Static-Dephasing-Regime, wie sie bereits in [49] angegeben wurde:
| (4.18) |
wobei der Volumenanteil ist (). Das Einsetzen dieser Frequenzverteilung (4.18) in die Fourier-Transformation (2.73) oder direktes Berechnen des Integrals (2.72) liefert den Signal-Zeit-Verlauf, der im Sinne der allgemeinen Form nach Gleichung (4.10) geschrieben werden kann mit Hilfe der kugelspezifischen -Funktion:
| (4.19) |
Die verallgemeinerte hypergeometrische Funktion oder auch Barnes erweiterte hypergeometrische Funktion ist durch
| (4.20) |
definiert [75], und das Pochhammersymbol ist definiert als
| (4.21) |
Die Kummersche konfluente hypergeometrische Funktion ist ein Spezialfall von Barnes erweiterter hypergeometrischer Funktion (4.20) für . Integralsinus und Integralcosinus sind folgendermaßen definiert [76]:
| (4.22) | ||||
| (4.23) |
Wird die Integration in einer der Gleichungen (4.5) bis (4.7) ausgeführt, ergibt sich die Laplace-Transformierte des Magnetisierungszerfalles im Static-Dephasing-Regime, welche in der Form (4.11) mit der kugelspezifischen Funktion
| (4.24) |
geschrieben werden kann. Die für die Berechnung der Frequenzverteilung notwendige Korrelationszeit ist in Gleichung (3.25) angegeben, welche auch folgendermaßen geschrieben werden kann:
| (4.25) |
Mit Kenntnis der Funktion und der Korrelationszeit kann durch Einsetzen in Gleichung (4.13) ein analytischer Ausdruck für die Frequenzverteilung angegeben werden, der in allen Diffusionsregimen gültig ist. Um die Abhängigkeit von der Diffusion zu illustrieren, ist in Abbildung 4.2 die Frequenzverteilung für verschiedene Diffusionskoeffizienten dargestellt.
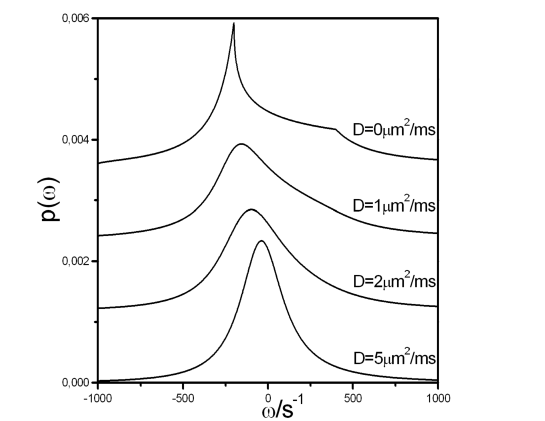
Erreicht der Diffusionskoeffizient den Wert , dann stimmt die Frequenzverteilung mit der in Gleichung (4.18) angegebenen Frequenzverteilung im Static-Dephasing-Grenzfall überein, welche auch in Abbildung 1 in [49] zu sehen ist.
Die Fourier-Transformation der Frequenzverteilung entsprechend Gleichung (4.1) führt zum Signal-Zeit-Verlauf wie er in Abbildung 4.3 gezeigt wird.
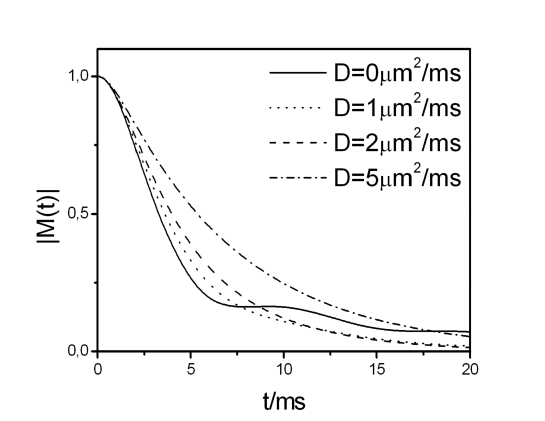
Der Magnetisierungs-Zeit-Verlauf für ein Spin-Echo-Experiment kann aus dem Magnetisierungs-Zeit-Verlauf des Gradienten-Echos entsprechend Gleichung (4.9) ermittelt werden. Die entsprechenden Verläufe sind in Abbildung 4.4 dargestellt.
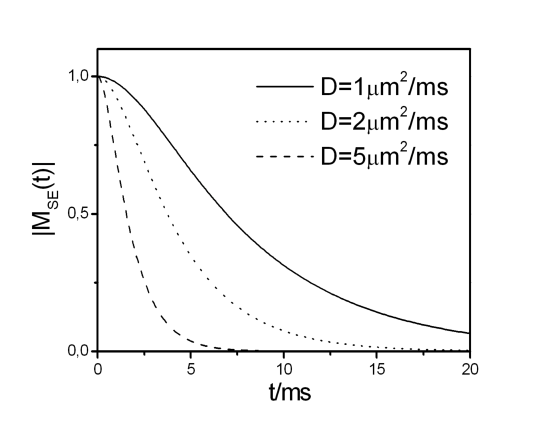
4.2.3 Zylinder
Analytische Lösung
Das zweite analytisch lösbare Beispiel ist das bereits in Abschnitt 2.2.3 betrachtete zylinderförmige Objekt, das von einem zylindrischen Voxel umgeben ist (siehe Abbildung 2.5). Die Ausführung der Integration in Gleichung (2.75) unter Benutung der lokalen Resonanzfrequenz aus Gleichung (2.53) ergibt für die Frequenzverteilung im Static-Dephasing-Regime den Ausdruck
| (4.29) |
wobei der Volumenanteil () des Zylinders innerhalb des Voxels ist. Im Grenzfall eines kleinen Volumenanteils konvergiert die Frequenzverteilung gegen die Delta-Funktion
| (4.30) |
und im entgegengesetzten Grenzfall eines großen Volumenanteils, in dem das Relaxationsvolumen verschwindet, konvergiert die Frequenzverteilung gegen den folgenden Ausdruck:
| (4.31) |
In Abbildung 4.5 ist die Frequenzverteilung im Static-Dephasing-Regime für verschiedene Werte des Volumenanteiles zu sehen. Aus der Gleichung (2.53), welche die lokale Resonanzfrequenz um einen Zylinder beschreibt, kann man erkennen, dass der minimale Wert der Frequenz bei und der maximale Wert von bei liegt. Diese beiden speziellen Werte werden an Punkten auf der Oberfläche des Zylinders angenommen. Da Beiträge von Spins innerhalb des Zylinders vernachlässigt werden, sind Resonanzfrequenzen, die außerhalb dieses Intervalls liegen, nicht möglich. Dies bedeutet, dass die Frequenzverteilung im Static-Dephasing-Regime einen kompakten Träger hat. Eine weitere wichtige mathematische Eigenschaft besteht darin, dass die Frequenzverteilung eine rein reelle Funktion ist, was auch von einer Wahrscheinlichkeitsdichte erwartet wird. Des Weiteren ist die Frequenzverteilung eine gerade Funktion, d. h. , wohingegen die Frequenzverteilung um eine homogen magnetisierte Kugel [49] keine Symmetrieeigenschaften besitzt.
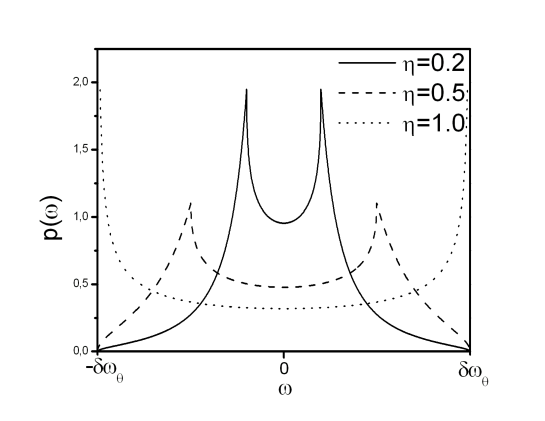
Ähnliche Frequenzverteilungen wurden von Zimmerman und Foster (Abbildung 6 in [77]) angegeben. Numerische Simulationen im Sinne des oben beschriebenen Histogramms bestätigen die analytischen Ergebnisse für die Frequenzverteilung .
Da das Magnetfeld im Inneren des Zylinders konstant ist, erzeugt dieser Beitrag die konstante innere Frequenz , die zu einem Delta-Peak an der Position führt (siehe Abbildung 5 in [78]).
Wird diese Frequenzverteilung des Static-Dephasing-Regimes (4.29) in die Fourier-Transformation (2.73) eingesetzt, ergibt sich ein Ausdruck für den Magnetisierungs-Zeit-Verlauf im Static-Dephasing-Regime, der in der Form von Gleichung (4.10) mit der zylinderspezifischen -Funktion ausgedrückt werden kann:
| (4.32) |
Um den Ausdruck für den Signal-Zeit-Verlauf im Static-Dephasing-Regime zu erhalten, kann man auch die lokale Resonanzfrequenz aus Gleichung (2.53) direkt in den allgemeinen Ausdruck (2.72) einsetzen. Die Symmetrie , die Annahme rein reeller Werte und der kompakte Träger sind mathematische Eigenschaften der Frequenzverteilung, die dazu führen, dass die Fourier-Transformierte, also der Magnetisierungs-Zeit-Verlauf, eine rein reelle Funktion ist. Das Ergebnis für den Magnetisierungs-Zeit-Verlauf stimmt mit den von Yablonskiy und Haacke angegebenen Resultaten überein (siehe Gleichung (36) in [6]).
Im Grenzfall großer Volumenanteile, in dem das Relaxationsvolumen gegen eine unendlich dünne Röhre konvergiert, ergibt sich aus Gleichung (4.10) der Ausdruck
| (4.33) |
wobei die Bessel-Funktion erster Art und nullter Ordnung ist. Dieses Ergebnis kann auch abgeleitet werden, wenn man die Frequenzverteilung im Grenzfall großer Volumenanteile aus Gleichung (4.31) in die Fourier-Transformation entsprechend Gleichung (2.74) einsetzt. Entsprechen dem allgemeinen Ausdruck für das NMR-Signal im Static-Dephasing-Regime (2.72) führt die Konvergenz des Relaxationsvolumens bis hin zu einer unendlich dünnen Röhre in der Folge zu einer verschwindenden Anfangsmagnetisierung , während jedoch das Verhältnis zur oben beschriebenen Bessel-Funktion konvergiert.
Für kleine Zeiten führt die Taylor-Entwicklung des Magnetisierungs-Zeit-Verlaufes aus Gleichung (4.10) zu dem Ausdruck
| (4.34) |
d. h. das Signal zerfällt quadratisch mit der Zeit. Dieses Ergebnis stimmt auch mit dem von Yablonskiy und Haacke in Gleichung (37) ihrer Veröffentlichung [6] angegebenen Kurzzeitverhalten des Magnetisierungszerfalles überein.
Die Eigenschaften von Geweben, die Magnetfeldinhomogenitäten enthalten, werden oft durch ihre Relaxationszeit oder den Volumenanteil charakterisiert. Die Angabe einer Relaxationszeit setzt einen exponentiellen Signalzerfall der Form voraus. Eine Relaxationszeit , die den exakten Verlauf des Magnetisierungszerfalles nach Gleichung (4.10) am besten durch einen exponentiellen Zerfall approximiert, kann mit Hilfe der Mean-Relaxation-Time-Approximation angegeben werden [32]:
| (4.35) |
Nach Ausführung der Integration ergibt sich ein einfacher Ausdruck für die transversale Relaxationszeit und ein Zusammenhang zur Frequenzverteilung kann gefunden werden:
| (4.36) | ||||
| (4.37) |
In Abbildung 4.6 wird der exakte Zeitverlauf des Magnetisierungszerfalles für verschiedene Werte des Volumenanteiles dargestellt und die dazugehörige Relaxationszeit angegeben.
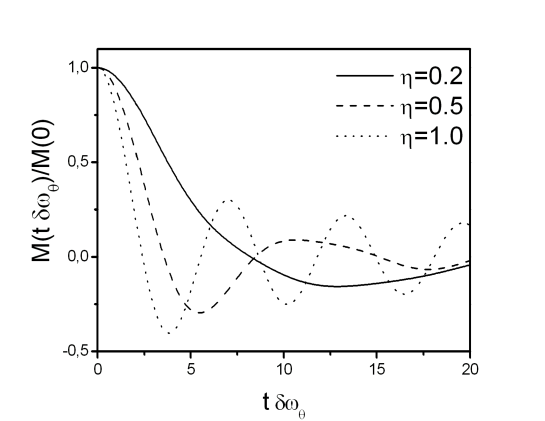
In Abbildung 4.6 erkennt man für große Zeiten einen oszillierenden Anteil, insbesondere für große Volumenverhältnisse. Dieser oszillierende Anteil erklärt sich aus der charakteristischen Frequenzverteilung mit zwei Peaks (siehe Abbildung 4.5) an den Stellen . Im Sinne einer Schwebung überlagern sich also zwei Schwingungen mit gleicher Frequenz und unterschiedlichem Vorzeichen. Es resultiert eine Schwebung mit der Frequenz . Dies ist auch aus Gleichung (4.33) ersichtlich, wenn man beachtet, dass die Besselfunktion für große Argumente gegen die Sinusfunktion strebt.
Im Gegensatz zu Kugeln haben Zylinder einen Neigungswinkel zum äußeren Magnetfeld. Sowohl die Frequenzverteilung als auch der Magnetisierungszerfall sind von dieser Orientierung des Zylinders abhängig. Ein von der Orientierung des Zylinders unabhängiger Wert ist die in Abbildung 4.7 markierte Fläche mit folgendem Flächeninhalt:
| (4.38) |
Wenn die Frequenzverteilung im Static-Dephasing-Grenzfall feststeht, dann ist es somit möglich, den Volumenanteil unabhängig von der Orientierung zu berechnen. Ist erst einmal der Volumenanteil bekannt, kann der äquatoriale Frequenzshift aus der Peakposition berechnet werden. Bei Kenntnis der Stärke des äußeren Magnetfeldes ist es deshalb möglich, die Suszeptibilitätsdifferenz zwischen Zylinder und umgebendem Medium zu ermitteln. So kann man z. B. im Fall von blutgefüllten Kapillaren auf den Oxygenierungsgrad des Blutes innerhalb des Gefäßes rückschließen.
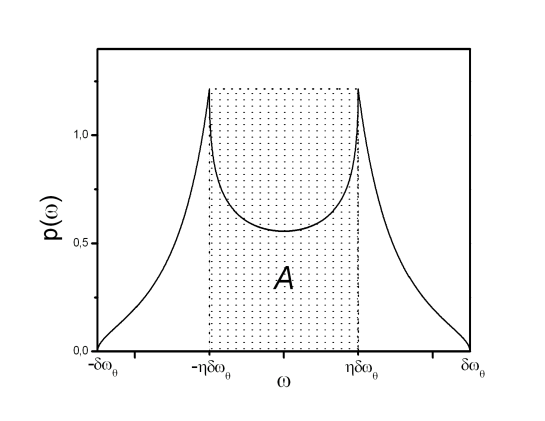
Zur Quantifizierung des Volumenanteils basierend auf der obigen Methode ist ein kleines Frequenzintervall notwendig, wofür entsprechend dem Fourier-Theorem das Signalverhalten bei langen Zeiten benötigt wird. Aus praktischen Gründen wird der Magnetisierungszerfall jedoch für kurze Echozeiten aufgenommen, um ein ausreichend hohes SNR zu erhalten.
Um die Frequenzverteilung für alle Diffusionsregime zu erhalten, muss die Funktion , die in Gleichung (4.13) benötigt wird, ermittelt werden. Deshalb wird zuerst die Laplace-Transformierte des Magnetisierungs-Zerfalles im Static-Dephasing-Regime ermittelt. Dazu kann eine der Gleichungen (4.5) bis (4.7) genutzt werden. Die Auswertung aller drei Gleichungen führt zu dem gleichen Ergebnis für die Laplace-Transformierte des Magnetisierungs-Zerfalles , die in der allgemeinen Form (4.11) mit der zylinderspezifischen Funktion
| (4.39) |
geschrieben werden kann.
Die zweite Größe, die zur Berechnung der Frequenzverteilung in Gleichung (4.13) benötigt wird, ist die Korrelationszeit , welche die Diffusionseffekte beschreibt. Im Falle eines undurchlässigen Zylinders werden reflektierende Randbedingungen auf der Oberfläche des inneren Zylinders angenommen. Die zugehörige Korrelationszeit ist in Gleichung (3.30) gegeben. Werden die Ausdrücke (4.39) und (3.30) genutzt, kann aus Gleichung (4.13) die Frequenzverteilung erhalten werden. Um die Abhängigkeit von der Diffusion zu demonstrieren, ist in Abbildung 4.8 die Frequenzverteilung für verschiedene Werte des Diffusionskoeffizienten dargestellt. Wenn die Diffusion vernachlässigbar ist, stimmt die Frequenzverteilung mit der des Static-Dephasing-Regimes aus Gleichung (4.29) überein, wie in Abbildung 4.5 gezeigt. Eine ähnliche charakteristische Form der Frequenzverteilung bei zylinderförmiger Geometrie wurde von Zimmerman und Foster numerisch beschrieben [77].
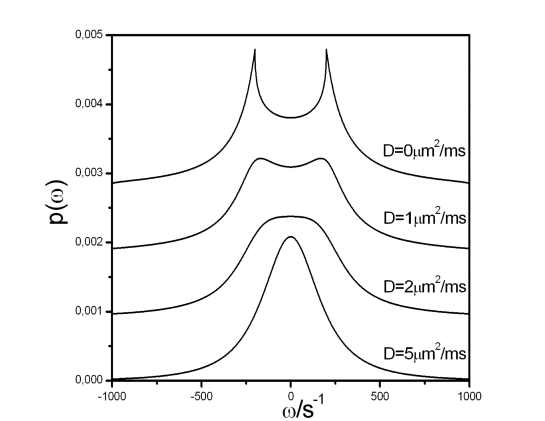
Eine Fourier-Transformation der Frequenzverteilung entsprechend Gleichung (4.1) führt zum Signal-Zeit-Verlauf wie er in Abbildung 4.9 dargestellt wird. Auch für den Signal-Zeit-Verlauf im Static-Dephasing-Regime stimmt das Ergebnis mit früheren Ergebnissen aus Gleichung (4.10) und der zylinderspezifischen Funktion (4.32) überein, wie aus Abbildung 4.9 hervorgeht.
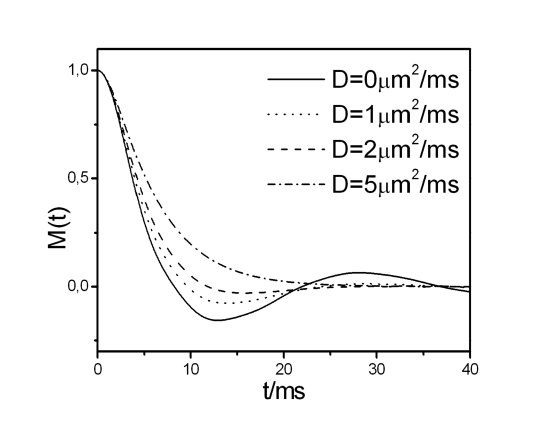
Der Magnetisierungs-Zeit-Verlauf für ein Spin-Echo-Experiment kann aus dem Magnetisierungs-Zeit-Verlauf des Gradienten-Echos entsprechend Gleichung (4.9) ermittelt werden. Die entsprechenden Verläufe sind in Abbildung 4.10 dargestellt.

Numerische Lösung
Um den Magnetisierungs-Zeit-Verlauf numerisch zu ermitteln wird die Bloch-Torrey-Gleichung (2.54) in der einfachen Form
| (4.40) |
geschrieben, wobei dem Diffusionskoeffizienten entspricht und der Stärke des Suszeptibilitätseffektes. Zum Zeitpunkt zeigt die Magnetisierung in jedem Punkt des Voxels in -Richtung. Dies entspricht der Anfangsbedingung
| (4.41) |
und den reflektierenden Randbedingungen . Dabei seien und reelle Konstanten sowie eine reelle Funktion. Gesucht ist die Funktion
| (4.42) |
Durch Diskretisierung (z. B. mittels finiter Differenzen oder durch Entwicklung nach Basisfunktionen) geht (4.40) in die Vektor-Matrix-Gleichung
| (4.43) |
über. Dabei sind und hermitesche Matrizen (im allgemeinen Sinne, siehe [79]), die sich durch die Diskretisierung von und ergeben. Die Lösung von (4.43) kann am einfachsten durch das folgende Schema erfolgen:
| (4.44) |
Dabei muss die Stabilitätsbedingung erfüllt sein, wobei die Spektralnorm von , d. h. der Betrag des größten Eigenwertes von , ist. Um eine hohe Genauigkeit zu erzielen, muss außerdem sein; die Aufteilung des Exponentials erhöht die Genauigkeit. Idealerweise ist schwachbesetzt und diagonal, dann ist die Lösung nach (4.43) eine -Methode; aber auch vollbesetzte Matrizen mit bis zu sind noch tolerierbar.
Im zweidimensionalen Fall ist der Laplace-Operator in Polarkoordinaten durch
| (4.45) |
gegeben. Das Potential ergibt sich aus der lokalen Resonanzfrequenz in Gleichung (2.53) zu
| (4.46) |
Die Schrittweiten für den Abstand sowie für den Winkel ergeben die Gitterpunkte ; und ; . Um eine gleichmäßige Diskretisierung zu gewährleisten, sollte sein. Es folgt die Approximation des Integrals (4.42) durch
| (4.47) |
mit
| (4.48) |
Die Diskretisierung des Operators ergibt
| (4.49) |
wobei die Punkte und übereinstimmen.
Die Diskretisierung von ist aufwändiger, da die reflektierenden Randbedingungen eingearbeitet werden müssen. Die entsprechende Matrix muss folgende Bedingungen erfüllen:
-
1.
Wegen für muss gelten:
(4.50) -
2.
Aus der Teilchenzahlerhaltung folgt:
(4.51) -
3.
Aus der Hermitizität von folgt:
(4.52) Eine schwächere Forderung wäre, dass Koeffizienten existieren, welche die obige Gleichung erfüllen.
-
4.
Das Differenzenschema muss konsistent sein, d. h. für müssen die gegen konvergieren. Daraus folgt insbesondere, dass für die Punkte, welche keine Randpunkte sind, sich der bekannte Ausdruck für [79] ergeben muss.
Eine Tridiagonalmatrix, welche die obigen Bedingungen erfüllt, ist
| (4.53) |
Die Diskretisierung des Potentials aus Gleichung (4.46) führt auf eine Diagonalmatrix, und es ist
| (4.54) |
Für die Matrixnormen gilt nach [79]:
| (4.55) |
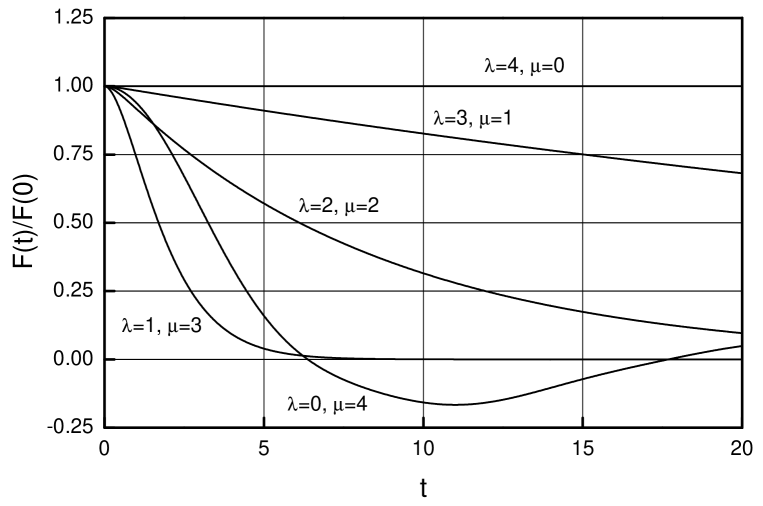
Die numerische Lösung von Gleichung (4.40) für den zweidimensionalen Fall mit Hilfe der Methode (4.43) erfolgt mittels eines selbstgeschriebenen Fortran-Programms. Die Lösung ist in Abbildung 4.11 für verschiedene Parameter und dargestellt. Bei bleibt . Für bestimmte Parameter kann die Funktion negativ werden, wie sich an dem Grenzfall zeigt.
Für den dreidimensionalen Fall ist die Diskretisierung des Laplace-Operators komplizierter. Hier könnte es vorteilhaft sein, nach einem Orthonormalsystem zu entwickeln.
Experimentelle Lösung
Um die analytischen Ergebnisse experimentell zu verifizieren, muss die exakte Form des freien Induktionsabfalls, der alleine durch das lokale inhomogene Magnetfeld verursacht wird, gemessen werden. Alle zusätzlichen Gradienten, wie Shimgradienten, beeinflussen die Form des freien Induktionszerfalls. Eine geeignete Methode, den Signal-Zeit-Verlauf in einem vorgegebenen Volumen zu messen, ist die voxelselektive PRESS-Sequenz (Point RESolved Spectroscopy) [80, 81].
Die Lokalisierung des Voxels wird, wie in Abbildung 4.12 dargestellt, durch drei frequenzselektive Hochfrequenzpulse (), die jeweils während eines angelegten Magnetfeldgradienten eingestrahlt werden, erreicht. Die Signalbeiträge von außerhalb des selektierten Voxels werden durch Spoiler-Gradienten, welche die -Pulse umgeben, dephasiert. Um die unerwünschten Einflüsse zusätzlicher Gradienten zu minimieren, wird zuerst auf das Voxel ohne Kapillare geshimmt. Dazu wurde ein Phantom konstruiert, das es ermöglicht, die Kapillare erst nach dem Shimmen in das selektierte Voxel einzuführen, ohne dabei das Phantom zu bewegen. Ein Phantom, welches diesen Anforderungen genügt, ist in Abbildung 4.13 zu sehen. Es besteht aus einem wassergefüllten -Zentrifugenröhrchen (Nunc GmbH Co. KG, Thermo Fisher Scientific, Wiesbaden) mit einen Innendurchmesser von . An einer Seite ist eine luftgefüllte Glaskapillare mit einem Durchmesser von (Glas Nr. 140, Hilgenberg GmbH, Malsfeld) verschiebbar angebracht. Diese Glaskapillare mit vernachlässigbarer Wanddicke erzeugt einen Suszeptibilitätssprung von zum umgebenden Wasser.
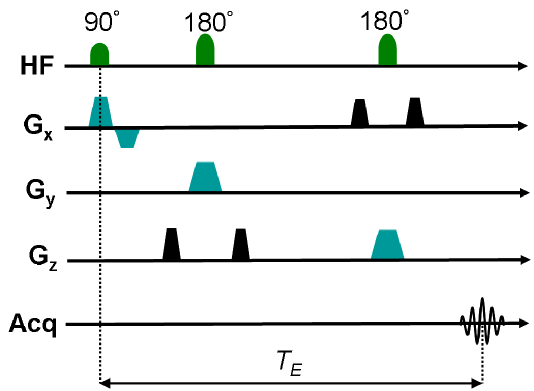
Die Experimente wurden an einem Bruker Biospec-System (Bruker BioSpin GmbH, Rheinstetten) mit einer Feldstärke von durchgeführt. Es wurde ein aktiv geschirmtes Gradientensystem ( maximale Gradientenstärke) und ein -Quadratur-Birdcage-Resonator zum Senden und Empfangen benutzt. Die PRESS-Sequenz wurde in einem einzigen Scan mit einer Echozeit von durchgeführt. Um das Voxel auszuwählen, wurden frequenzselektive Hermite-Pulse mit einer Bandbreite von genutzt. Der freie Induktionszerfall wurde für bei einer Bandbreite von aufgenommen, was einer spektralen Auflösung von entsprach.
Zuerst wurde auf das Voxel ohne Glaskapillare geshimmt, wie es auf der linken Seite von Abbildung 4.13 dargestellt ist. Somit konnte im gesamten Voxel ein nahezu homogenes Magnetfeld erreicht werden. Die Linienbreite des Wassersignals ohne Kapillare im untersuchten Voxel betrug . Anschließend wurde die Glaskapillare in das Phantom eingeführt, wie auf der rechten Seite von Abbildung 4.13 gezeigt. Jetzt erzeugt die Kapillare ein lokales inhomogenes Magnetfeld im Voxel. Der durch dieses lokale Magnetfeld beeinflusste Induktionszerfall kann nun mittels der oben beschriebenen voxelselektiven PRESS-Sequenz gemessen werden.
Entscheidend für die Qualität des aufgenommenen Induktionszerfalles ist die Lage und Größe des gewählten Voxels. Das Voxel darf nicht zu groß gewählt werden, damit die Suszeptibilitätssprünge vom Rand des Phantoms keinen Einfluss auf den Induktionszerfall nehmen. Andererseits darf das Voxel nicht zu klein gewählt werden, damit die Bedingung nicht verletzt wird. Aus Symmetriegründen sollte die Kapillare im Zentrum des Voxels liegen und senkrecht zum äußeren Magnetfeld orientiert werden (), was die Suszeptibilitätseffekte maximiert.
Um den optimalen Kompromiss zwischen beiden Anforderungen zu finden, wurde ein würfelförmiges Voxel mit der Kantenlänge gewählt. Für diese gewählte Voxelgröße ergab sich ein Volumenanteil von .
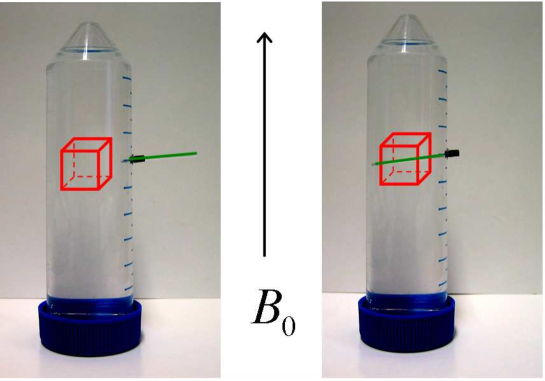
Entsprechend der Gleichung (2.2.3) erzeugt die Glaskapillare theoretisch den Frequenzshift auf der Oberfläche der Kapillare. Damit ergibt sich, dass die beiden Peaks bei liegen. Dies stimmt auch gut mit den experimentell ermittelten Werten von überein (siehe Abbildung 4.14).
Mit den bekannten Werten für den Frequenzshift und für den Volumenanteil kann das experimentell erhaltene Spektrum mit den Vorhersagen von Gleichung (4.29) verglichen werden. In Abbildung 4.14 ist eine sehr gute Übereinstimmung zwischen der theoretisch berechneten und der experimentell gemessenen Frequenzverteilung über den gesamten Frequenzbereich zu sehen.
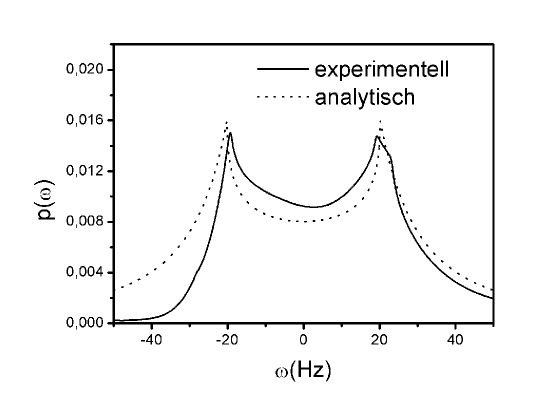
Auch der experimentell ermittelte Signal-Zeit-Verlauf stimmt, wie Abbildung 4.15 zeigt, mit dem theoretisch nach Gleichung (4.10) berechneten gut überein.
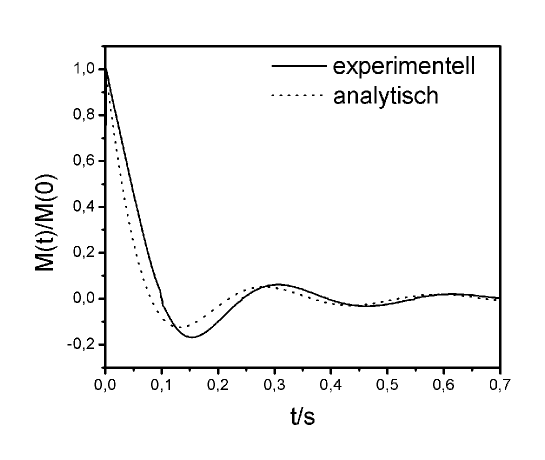
Die Frequenzverteilung um Kugeln wurde zuerst von Cheng et al. [49] untersucht. Die experimentelle Bestätigung wurde von Seppenwoolde et al. [70] erbracht, wobei ähnliche Phantome und Methoden wie die hier vorgestellten verwendet wurden. Hiermit entspricht Abbildung 7 für eine kugelförmige Geometrie in der Arbeit [70] der Abbildung 4.14 dieser Arbeit für eine zylindrische Geometrie.
Kapitel 5 Nicht-Gaußförmige Dephasierung
5.1 Theorien zur Spindephasierung
Die suszeptibilitätssensitive Bildgebung spielt bei der Untersuchung der Lokalisation magnetisch markierter Zellen [82] oder in der BOLD-Bildgebung [3] eine entscheidende Rolle. Lokale Variationen der Spindephasierung sind für den Kontrast bei der suszeptibilitätssensitiven Bildgebung verantwortlich.
Für die Suszeptibilitätseffekte sind entweder ein intrinsisches Kontrastmittel (Desoxyhämoglobin [4]) oder ein extrinsisches Kontrastmittel (USPIO) verantwortlich, die ein inhomogenes Magnetfeld erzeugen, welches die Spindephasierung beschleunigt. Dieser Effekt kann den Gewebestrukturen zugeordnet werden, die mit dem Kontrastmittel assoziiert sind, z. B. der vaskulären Architektur beim BOLD-Effekt [6, 8, 9, 55, 65] oder der Zelldichte [82, 83, 84]. Um diesen Effekt zu interpretieren, muss der Zusammenhang zwischen der Spinbeweglichkeit und den räumlichen Dimensionen als auch der Stärke der Feldinhomogenitäten beachten werden. Dadurch werden wie in Abschnitt 2.3.3 beschrieben die sogenannten Diffusionsregime definiert. Die meisten Theorien zur Beschreibung der Spindephasierung beschränken sich auf die Grenzfälle des Static-Dephasing-Regimes [6, 65] oder des Motional-Narrowing-Regimes [85]. Jedoch liegt vielen Situationen ein intermediäres Diffusionsregime zugrunde [8, 9, 11, 12, 13, 55], in dem keine der beiden Näherungen gültig ist.
Bisher gibt es nur zwei Näherungen, welche die Spindephasierung über den gesamten Dynamikbereich beschreiben: die Strong-Collision-Näherung [8, 9] mit ihrer Erweiterung [66] und die Gaußsche Näherung. Die Strong-Collision-Näherung approximiert die Diffusionsdynamik der Spins durch eine einfachere stochastische Dynamik, wobei die ursprünglichen Parameter des Originalprozesses in selbstkonsistenter Weise erhalten bleiben. In der Gaußschen Näherung wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Phasenwinkel eine Gaußsche Funktion ist, was die Berechnung der Relaxation der Magnetisierung erleichtert. Obwohl die Voraussetzungen, die zur Anwendung der Gaußschen Näherung erfüllt sein müssen, noch nicht ausreichend ermittelt wurden, konnte empirisch gezeigt werden, dass die Gaußsche Näherung in vielen Fällen anwendbar ist [11, 12, 13] und auch durch die (erweiterte) Strong-Collision-Näherung [66] approximierbar ist. Nun stellt sich die Frage, welche stochastische Dynamik der Phasenmodulation die Gaußsche Näherung rechtfertigt. Diese Fragestellung wird in den nächsten Abschnitten erörtert.
5.2 Gleichgewichtsverteilung der lokalen Frequenzen
Für die folgenden Untersuchungen wird ein Spin betrachtet, der im klassischen Sinne durch einen Hochfrequenzpuls in eine Ebene senkrecht zum äußeren Magnetfeld ausgelenkt wurde. Dieser Spin präzediert jetzt in dieser senkrechten Ebene und wird deshalb transversal polarisierter Spin genannt. Der Phasenwinkel dieses präzedierenden Spins, der in einer inhomogenen magnetischen Umgebung diffundiert, unterliegt stochastischen Modulationen, deren Zeitverlauf durch
| (5.1) |
gegeben ist, wobei die Trajektorie des Spins und die Präzessionsfrequenz im lokalen Magnetfeld ist. Der Zeitverlauf des transversalen Anteils der Magnetisierung ist durch den Ensemblemittelwert des Phasenfaktors gegeben:
| (5.2) |
Die Gaußsche Dephasierung impliziert, dass die Wahrscheinlichkeitsdichte, einen Phasenwinkel zur Zeit zu finden, eine Gaußsche Funktion ist, d. h.
| (5.3) |
wobei die Ensemblevarianz des Phasenwinkels ist. Unter diesen Bedingungen liefert Gleichung (5.2) den bekannten Ausdruck [34]
| (5.4) |
Wie üblich, werden Gleichgewichtsbedingungen für die Wechselwirkung des Spinensembles mit seiner Umgebung angenommen, d. h. die Dephasierung ist unabhängig von einer Zeitverschiebung. Um die Varianz des Phasenwinkels zu erhalten, wird Gleichung (5.1) auf beiden Seiten quadriert:
| (5.5) |
Um die Klammern zu entfernen, wird die Integrationsvariable in der ersten Klammer und in der zweiten Klammer genannt. Damit ergibt sich
| (5.6) |
Die Bildung der Varianz kann nun ausgeführt werden und ergibt
Hierbei ist die Zweipunktkorrelationsfunktion, die unter Gleichgewichtsbedingungen durch
| (5.8) |
definiert ist.
Die Verteilung des Phasenwinkels legt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der lokalen Frequenzen fest. Gleichung (5.1) liefert für kleine Zeitintervalle :
| (5.9) |
Demzufolge ist die Verteilung des Phasenwinkels proportional zur Gleichgewichtsverteilung der lokalen Frequenzen
| (5.10) |
Diese Relation impliziert, dass im Falle Gaußscher Dephasierung (siehe Gleichung (5.3)) die lokale Frequenzverteilung eine Gaußsche Funktion ist.
5.3 Nicht-Gaußförmige Phasenakkumulation
Von Anderson und Weiss wurde angenommen, dass die Verteilung der lokalen Frequenzen gaußförmig ist. Die entscheidende weitere Annahme basiert auf der stochastischen Akkumulation des Phasenwinkels (5.1). Der Phasenwinkel kann als Summe lokaler Frequenzen multipliziert mit dem Zeitintervall betrachtet werden. Anderson und Weiss behaupteten, dass die Summe gaußverteilter lokaler Frequenzen auch wieder gaußverteilt ist. Das Gleiche gilt für den Phasenwinkel, was den einfachen Zusammenhang zum Magnetisierungs-Zeit-Verlauf nach Gleichung (5.4) impliziert.
Jedoch ist die Aussage „eine Summe gaußverteilter Variablen ist gaußverteilt“ im Allgemeinen nicht richtig. Diese Aussage gilt, wenn die Variablen stochastisch unabhängig sind. Jedoch ist diese stochastische Unabhängigkeit für die Dynamik der lokalen Frequenzen offensichtlich nicht erfüllt, es sei denn, die Fluktuationen sind extrem schnell. Um dies zu zeigen, wird ein Beispiel der Strong-Collision-Näherung mit gaußverteilten lokalen Frequenzen betrachtet, das eine Nicht-Gaußsche Phasenakkumulation zeigt.
Anstatt sich auf das gesamte Integral der Phasenakkumulation in Gleichung (5.1) zu konzentrieren, werden nur zwei lokale Frequenzen und betrachtet, die durch das Zeitintervall getrennt sind. Der Phasenwinkel kann als
| (5.11) |
geschrieben werden. In der Dynamik eines Strong-Collision-Prozesses ist die Übergangsrate zwischen verschiedenen lokalen Frequenzen proportional zur Gleichgewichtswahrscheinlichkeit der Frequenz. Für die Wahrscheinlichkeitsdichte im Gleichgewicht wird eine Gaußsche Form angenommen:
| (5.12) |
Die Greensche Funktion, d. h. die bedingte Wahrscheinlichkeit, einen Spin unter dem Einfluss des lokalen Feldes mit der Frequenz nach der Zeit zu finden, wenn er ursprünglich die Frequenz besaß, hat in der Strong-Collision-Näherung die Form [8, 9]
| (5.13) |
wobei für die Korrelationszeit der Zweipunktkorrelationsfunktion steht und die Dirac-Distribution darstellt. Nach dieser Gleichung nimmt der Anfangszustand mit der Korrelationszeit ab und der Gleichgewichtszustand wächst entgegengesetzt dazu.
Die Wahrscheinlichkeit, den Phasenwinkel zu finden, ist
| (5.14) |
Wird die Greensche Funktion (5.13) eingesetzt, ergibt sich für die Fourier-Transformierte der Wahrscheinlichkeit des Phasenwinkels
| (5.15) | ||||
| (5.16) |
wobei die Fourier-Transformierte der Gleichgewichtsdichte (5.12) darstellt. Da sich aus der Fourier-Transformation einer Gaußfunktion wieder eine Gaußfunktion ergibt, zeigt Gleichung (5.15), dass die Fourier-Transformierte des Phasenwinkels aus der Summe der Gaußschen Funktionen und entsteht. Diese Summe stellt jedoch im Allgemeinen keine Gaußsche Funktion dar. Deshalb ist die Originalfunktion, also die Verteilung des Phasenwinkels im Allgemeinen auch keine Gaußsche Funktion. In Abbildung 5.1 ist die Fourier-Transformierte des Phasenwinkels für verschiedene Werte dargestellt. Weder für sehr kurze noch für sehr lange Zeitintervalle ist die Fourier-Transformierte des Phasenwinkels eine rein Gaußsche Funktion, sondern immer eine Linearkombination aus und .
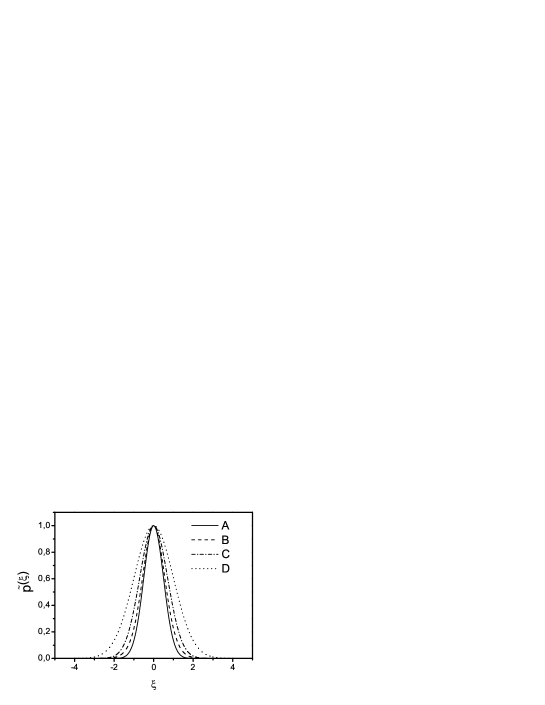
Unter der Annahme einer gaußförmigen Gleichgewichtsdichte der Form (5.12) stellt sich die Frage, welche Greensche Funktion zu einer gaußförmigen Verteilung führt. Wenn beide Verteilungen gaußförmig sind, dann sind sie ein Fourier-Paar und deshalb ist das innere Integral in Gleichung (5.14) der Kern der Fourier-Transformation, d. h. .
5.4 Übergangsdynamik zwischen lokalen Frequenzen
Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, dass eine gaußförmige Gleichgewichtsverteilung der lokalen Frequenzen nicht automatisch eine gaußförmige Verteilung des Phasenwinkels impliziert. Dieser Sachverhalt ist noch einmal in Abbildung 5.2 illustriert.
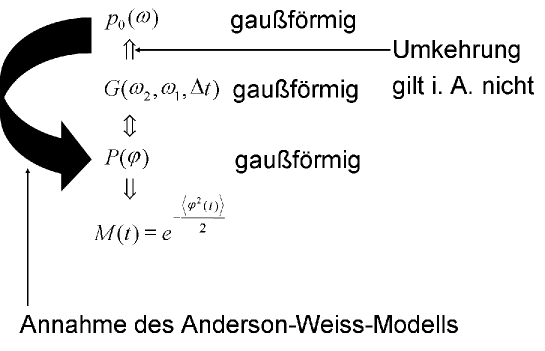
In diesem Abschnitt wird der entgegengesetzte Fall behandelt. Die stochastische Abhängigkeit der aufeinanderfolgenden lokalen Frequenzen, welche die Annahme der Gaußschen Dephasierung impliziert, wird abgeleitet, d. h. die Übergangsdynamik der lokalen Frequenzen wird definiert.
Wie auch im vorangehenden Abschnitt werden nur zwei lokale Frequenzen und betrachtet, die durch das Zeitintervall getrennt sind, anstatt das gesamte Integral der Phasenakkumulation in Gleichung (5.1) zu untersuchen. Der Phasenwinkel ergibt sich dann nach Gleichung (5.11) und für diesen Winkel wird eine Gaußverteilung vorausgesetzt. Zur Verallgemeinerung wird angenommen, dass nicht nur die Summe, sondern jede Linearkombination
| (5.17) |
der lokalen Frequenzen und gaußverteilt ist. Die Wahrscheinlichkeitsdichte für diese Variable ist
| (5.18) |
wobei die Wahrscheinlichkeitsdichte ist, die lokalen Frequenzen und im Zeitabstand zu finden; mit ist die Dirac-Distribution bezeichnet. Die Fourier-Transformierten von und genügen der Beziehung
| (5.19) |
Die Fourier-Transformierte einer Gaußfunktion ist wieder eine solche, d. h. die Funktionen und sind Gaußfunktionen. Da die Parameter und beliebig gewählt werden können, ist eine Gaußfunktion in den Variablen und . Die inverse Fourier-Transformation impliziert, dass auch eine Gaußfunktion ist.
Die Gaußsche Dephasierung impliziert also, dass die Wahrscheinlichkeitsdichte, die Frequenz zur Zeit und die Frequenz zum späteren Zeitpunkt zu finden, eine Gaußfunktion ist.
Als nächstes wird die Greensche Funktion untersucht, d. h. die Dichte der bedingten Wahrscheinkichkeit , dass sich ein Spin unter dem Einfluss eines lokalen Feldes mit der Frequenz nach dem Zeitintervall befindet, wenn er ursprünglich unter Einfluss des lokalen Feldes mit der Frequenz stand. Solange die Gleichgewichtsbedingungen erfüllt sind, gilt die Relation
| (5.20) |
und da eine Gaußfunktion ist, impliziert diese Relation, dass auch die bedingte Wahrscheinlichkeit eine Gaußfunktion ist. Diese Greensche Funktion ist der Propagator der stochastischen Dynamik der Frequenzen und hat die Eigenschaft
| (5.21) |
Nun stellt sich die Frage, welche Form diese Greensche Funktion annimmt. Um diese Frage zu beantworten, werden einige fundamentale Eigenschaften der Greenschen Funktion genutzt. Eine Eigenschaft ist, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Spin nach dem Zeitintervall unter dem Einfluss irgendeiner lokalen Frequenz zu finden, auf Eins normiert ist, d. h.
| (5.22) |
Wird die gaußförmige Greensche Funktion
| (5.23) |
mit den zeitabhängigen Funktionen , , und dem Normalisierungsfaktor geschrieben, folgt aus Gleichung (5.22) der Zusammenhang
| (5.24) |
Mit der Beziehung nimmt der Propagator demzufolge die Form
| (5.25) |
an, die eine verschobene gaußförmige Funktion in ist. Entsprechend Gleichung (5.21) und aufgrund der Tatsache, dass die Greensche Funktion für in die Gleichgewichtswahrscheinlichkeit übergeht, ergibt sich
| (5.26) |
wobei die Varianz der Gleichgewichtsverteilung ist.
Eine weitere fundamentale Eigenschaft ergibt sich, wenn angenommen wird, dass die stochastische Dynamik der lokalen Feldfluktuationen ein Markovprozess ist, d. h., dass der stochastische Übergang zwischen zwei Frequenzen unabhängig vom vorhergehenden Übergang ist. Damit können für die Zeitintervalle und folgende Relation gefunden werden:
| (5.27) |
Das Einsetzen der Greenschen Funktion (5.25) ergibt:
| (5.28) |
und
| (5.29) |
Die Gleichungen (5.28) und (5.29) werden unter Beachtung der Randbedingungen (5.26) gelöst. Zuerst ergibt sich
| (5.30) |
wobei für die Zerfallsrate steht. Einsetzen in Gleichung (5.29) ergibt
| (5.31) |
Deshalb gilt für beliebige Zeiten :
| (5.32) |
Dieser Ausdruck zeigt, dass die Greensche Funktion eine Gaußfunktion ist, die zum Zeitpunkt mit verschwindender Varianz um die Anfangsfrequenz zentriert ist. Mit zunehmender Zeit erreicht diese Gaußfunktion den Gleichgewichtszustand, d. h. die Varianz stimmt mit der des Gleichgewichtszustandes überein und das Zentrum verlagert sich von zum Nullpunkt (Abbildung 5.3).
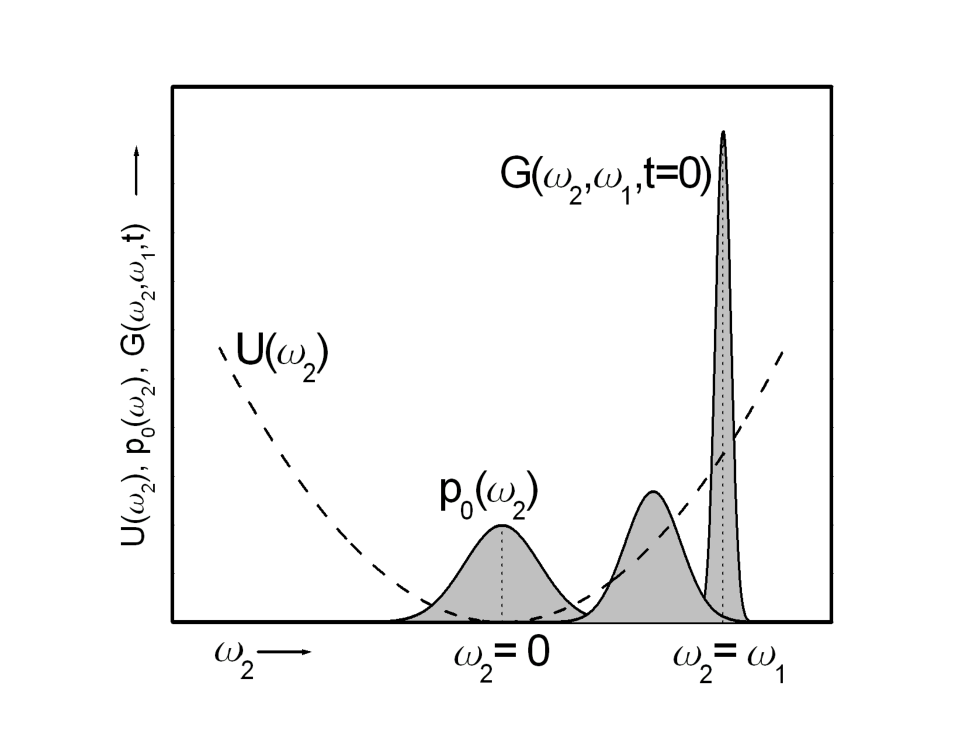
Die Dynamik dieses Prozesses wird durch die Rate bestimmt. Dieser Typ der Greenschen Funktion ist als Lösung der Diffusionsgleichung
| (5.33) |
mit dem Diffusionskoeffizienten bekannt. Dies ist eine Fokker-Planck-Gleichung, welche die Diffusion in einem harmonischen Potential
| (5.34) |
beschreibt (siehe Abbildung 5.3). Die dazugehörige treibende Kraft ist
| (5.35) |
Der Zusammenhang zwischen der Rate und dem Diffusionskoeffizienten
| (5.36) |
zeigt, dass ein größerer Diffusionskoeffizient und ein steileres Potential (kleines ) zu einer schnelleren Einstellung des Gleichgewichts führen. Die Diffusion findet im Frequenzraum statt und die vom harmonischen Potential abgeleiteten Kräfte sind Entropiekräfte, die durch die Gleichgewichtswahrscheinlichkeitsdichte und die Übergangsdynamik zwischen den Frequenzzuständen festgelegt sind.
Die Zweipunktkorrelationsfunktion der lokalen Frequenzen dieses stochastischen Prozesses ist durch
gegeben (siehe Gleichung (5.27)), wobei die Varianz der lokalen Frequenz ist. Diese Gleichung zeigt, dass die Zweipunktkorrelationsfunktion exponentiell mit der Korrelationszeit
| (5.38) |
abfällt. Daher ergibt sich der Magnetisierungs-Zeit-Verlauf nach Gleichung (5.4) zu
| (5.39) |
wobei die Relaxationszeit im Motional-Narrowing-Regime ()
| (5.40) |
eingesetzt wurde. Dies zeigt, dass für große Zeiten der Signalzerfall rein exponentiell ist und durch die Relaxationszeit des Motional-Narrowing-Regimes charakterisiert ist, wohingegen für kleine Zeiten der Signalzerfall gaußförmig ist. Das stimmt auch mit Gleichung (2) der Arbeit von Sukstanskii und Yablonskiy [13] überein.
5.5 Zusammenfassung der Implikationen
Entscheidend ist, dass die Gleichung
| (5.41) |
die den Magnetisierungszerfall beschreibt, nur dann anwendbar ist, wenn die Greensche Funktion , welche die Wahrscheinlichkeit des Überganges zwischen den beiden Frequenzen charakterisiert, gaußförmig ist. Diese Gaußsche Näherung schränkt die Vielfalt der möglichen Zerfallskurven beträchtlich ein.
Unter der Annahme einer Gaußschen Verteilung des Phasenwinkels konnte in Abschnitt 5.4 gezeigt werden, dass dies unter Gleichgewichtsbedingungen zu einer gaußförmigen bedingten Wahrscheinlichkeitsdichte führt:
| (5.42) |
Umgekehrt kann eine gaußförmige Dichte dafür angenommen werden, dass ein Spin unter dem Einfluss des lokalen Feldes mit der Frequenz nach der Zeit steht, wenn er ursprünglich unter dem Einfluss des lokalen Feldes mit der Frequenz stand. Mit dieser Annahme kann die Verteilung des Phasenwinkels in folgender Weise berechnet werden: während eines kleinen Zeitintervalls ergibt sich der Phasenwinkel zu . Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeitsdichte eines Phasenwinkels durch die Beziehung
| (5.43) |
gegeben. Dieser Ausdruck ist eine verkettete Faltung von Gaußfunktionen, woraus folgt, dass selbst eine Gaußfunktion ist. Daher folgt die Implikation
| (5.44) |
Mit den Implikationen (5.42) und (5.44) konnte die Äquivalenz zwischen einer Gaußverteilung des Phasenwinkels und einer gaußförmigen Greenschen Funktion demonstriert werden.
Die einzige Annahme, die im Modell von Anderson und Weiss gemacht wurde, war eine gaußförmige Gleichgewichtsverteilung der Frequenzen . Aus Gleichung (5.43) kann man sehen, dass diese Annahme nicht ausreichend ist. Das Anderson-Weiss-Modell ist für einen speziellen Fall von Fluktuationen anwendbar, und zwar dann und nur dann, wenn die Greensche Funktion , welche die Wahrscheinlichkeit des Überganges zwischen zwei Frequenzen beschreibt, gaußförmig ist.
Wird der Gleichgewichtszustand durch die Greenschen Funktion beschrieben, bedeutet dies, dass eine gaußförmige Greensche Funktion eine gaußförmige Gleichgewichtsverteilung der Frequenzen impliziert. Damit kann die Implikation (5.44) erweitert werden:
| (5.45) |
Die Umkehrung dieser Implikation ist jedoch im Allgemeinen falsch. Es gibt stochastische Prozesse wie den der Strong-Collision und seine Erweiterung (ESC), die eine gaußförmige Gleichgewichtsverteilung besitzen, deren Dynamik jedoch durch eine nicht-gaußförmige Greensche Funktion beschrieben wird [66]. Zusammengefasst ergeben sich nun die folgenden Implikationen:
die sowohl den Zusammenhang zwischen der Greenschen Funktion und der Gleichgewichtsverteilung der Frequenzen als auch den Zusammenhang zwischen der Verteilung der Phasenwinkel und dem Magnetisierungszerfall zeigen.
Es wurde also gezeigt, dass die Annahme der Gaußschen Dephasierung des Phasenwinkels die stochastische Dynamik zwischen den lokalen Frequenzen auf eine sehr begrenzte Klasse von Übergangsdynamiken beschränkt, die durch Gleichung (5.32) beschrieben werden. Die Übergangsdynamiken sind die eines Teilchens, dass in dem harmonischen Potential diffundiert. Der Magnetisierungszerfall folgt aus Gleichung (5.39). Obwohl Gleichung (5.4) eine Vielzahl möglicher Zerfallskurven suggeriert, sind nur die in der Form von Gleichung (5.39) mit der Gaußschen Näherung vereinbar.
Kapitel 6 Relaxationszeiten magnetisch markierter Zellen
6.1 Bedeutung magnetisch markierter Zellen
Viele Krankheiten beruhen auf dem irreversiblen Absterben von gewebespezifischen Zellen. So kann z. B. nach einem Myokardinfarkt ischämisch geschädigtes Gewebe nicht mehr regenerieren, es kann eine Herzmuskelinsuffizienz entstehen. Zur Regeneration des abgestorbenen Gewebes können noch nicht differenzierte Stammzellen in das betroffene Gewebe eingebracht werden, um sich in gewebespezifische Zellen weiter zu differenzieren. Um diese Zellen lokalisieren zu können, werden sie vorher mit kleinen magnetischen Kontrastmittelteilchen (USPIOs) markiert, um eine für die Kernspinresonanzbildgebung nutzbare Suszeptibilitätsdifferenz zum umgebenden Gewebe zu erzeugen. Diese Kontrastmittelteilchen können nun als kleine magnetisierte Objekte betrachtet werden, die aufgrund der Suszeptibilitätsdifferenz ein lokales inhomogenes Magnetfeld erzeugen. Während bisher die Signalentstehung in einem Voxel untersucht wurde, wird nun die transversale Relaxationszeit untersucht, die durch die Anwesenheit von magnetischen Kontrastmittelteichen beeinflusst wird.
6.2 Relaxationsverhalten
Als physikalisches Modell für magnetisch markierte Zellen wird angenommen, dass eine unbekannte Anzahl von Nanopartikeln mit bekanntem Radius von der Zelle phagozytiert wurden und sich zu einem Kern innerhalb der Zelle zusammenlagern. Um dieses Problem mathematisch zu erfassen, wurde vorerst angenommen, dass sämtliche magnetische Kerne den gleichen Radius haben und der Volumenanteil magnetischen Materials am gesamten untersuchten Gewebe proportional zur Konzentration der Nanopartikel sei. Diese geometrische Anordnung mitsamt der um die magnetischen Kerne stattfindenden Diffusion bestimmt das Signalverhalten in einem Bildgebungsexperiment.
Um die transversale Relaxationszeit zu bestimmen wird angenommen, dass die Zeitentwicklung der Magnetisierung in der Form
| (6.1) |
darstellbar ist, wobei ein unbekannter Phasenfaktor ist. Wird dieser Zeitverlauf in die Definition der Laplace-Transformation (4.7) eingesetzt, ergibt sich
| (6.2) |
Daraus folgt, dass die Relaxationsrate entsprechend der Gleichung
| (6.3) |
bestimmt werden kann. Um den Wert zu erhalten, wird der bekannte Zusammenhang
| (6.4) |
(siehe Gleichung (2.68) mit ) genutzt, wobei die Laplace-Transformierte des Zeitverlaufs der Magnetisierung im Static-Dephasing-Regime ist. Diese Laplace-Transformierte wurde schon in Gleichung (4.11) in Kapitel 4 untersucht, wobei in diesem Fall die für sphärische Körper spezifische -Funktion aus Gleichung (4.24) relevant ist. Wird dieses Ergebnis in Gleichung (6.4) eingesetzt, ergibt sich letztlich für die Relaxationsrate der Ausdruck
| (6.5) |
Diese Methode zur Bestimmung der Relaxationszeit ist der schon früher verwendeten Mean-Relaxation-Time-Approximation [32] analog, in welcher die Relaxationszeit das erste Langzeitmoment des Magnetisierungszerfalls ist: . Um die Relaxationszeit zu bestimmen, wurde die Laplace-Transformierte für den Grenzfall kleiner genutzt. Dies reflektiert jedoch das Signalverhalten für lange Zeiten, obwohl die Messwerte für üblicherweise aus Messungen mit kurzen Echozeiten ermittelt werden. Deshalb wäre die Definition sicherlich sinnvoller. Eine genaue Beschreibung des Magnetisierungszerfalls für kurze Echozeiten erfolgt durch die Extended-Strong-Collision-Approximation [66].
Die Korrelationszeit um kugelförmige Objekte wurde schon in Abschnitt 3.3.1 bestimmt. Für die weiteren Untersuchungen wird der Zusammenhang (3.35) genutzt, um die Korrelationszeit zu berechnen.
Die Relaxationsrate magnetisch markierter Zellen im Motional-Narrowing-Regime wurde bereits in Abschnitt 3.4.2 untersucht. Die Relaxationsrate ist in diesem Fall vom Radius der Teilchen und vom Diffusionskoeffizienten des umgebenden Mediums abhängig (siehe Abschnitt 3.4.2):
| (6.6) |
Die Relaxationszeiten im Static-Dephasing-Regime wurden bereits ausführlich von Yablonskiy und Haacke untersucht [6]. Sie geben für die Relaxationsrate im Static-Dephasing-Regime die Beziehung
| (6.7) |
an, während Jensen und Chandra [86] das Ergebnis
| (6.8) |
erhalten, wobei für kompakte Objekte gilt. Sowohl die Gleichung (6.7) als auch die Gleichung (6.8) sind vom Kugelradius unabhängig und stimmen im Grenzfall großer Radien (d. h. ) mit den Ergebnissen, die aus der Strong-Collision-Näherung erhalten werden, gut überein (siehe Abbildung 6.1 für große Radien).
Wie in Abschnitt 2.3.3 beschrieben, wird das zugrunde liegende Diffusionsregime durch die Werte von und festgelegt. Da die Oberflächenfrequenz vom Kugelradius unabhängig ist, wird das Diffusionsregime alleine durch die Korrelationszeit festgelegt. Deshalb ist für kleine Kugeln der Motional-Narrowing-Grenzfall () anzuwenden und für große Kugeln der Static-Dephasing-Grenzfall (). Abbildung 6.1 zeigt, dass die Resultate des Strong-Collision-Modells nach Gleichung (6.5) gut mit den numerischen Simulationen von Muller et al. übereinstimmen [87]. Auch die Werte für die Grenzfälle Static-Dephasing-Regime und Motional-Narrowing-Regime stimmen mit den jeweiligen Näherungsformeln überein.
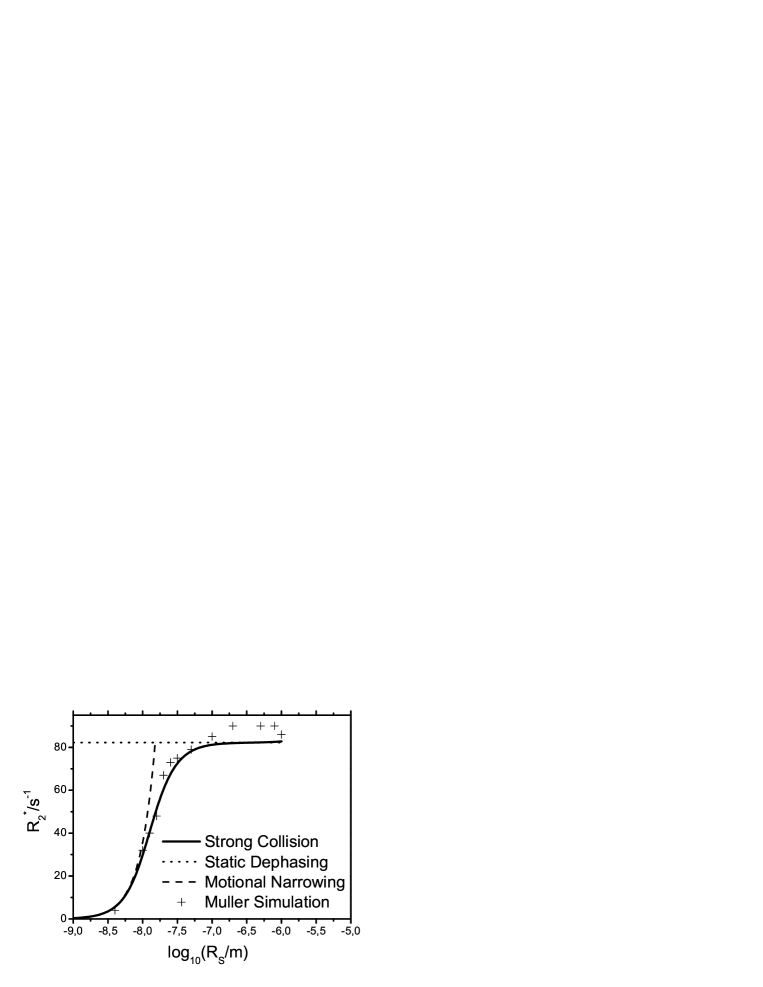
Die Abhängigkeit der Relaxationsrate vom Kugelradius lässt sich sehr gut an Abbildung 6.1 veranschaulichen. Im Motional-Narrowing-Regime (kleine Radien) ist die Relaxationsrate vom Radius abhängig (siehe Gleichung (6.6)). Wenn die Bedingungen des Static-Dephasing-Regimes erfüllt sind, ist die Relaxationsrate vom Kugelradius unabhängig (siehe Gleichung (6.7)). Dies ist nach Ungleichung (3.32) der Fall, wenn die Bedingung
| (6.9) |
erfüllt ist.
Um zu zeigen, dass die Ergebnisse des Strong-Collision-Modells über den gesamten Dynamikbereich gültig sind, werden diese Ergebnisse mit denen von Jensen und Chandra [86] sowie mit denen von Yung [46] verglichen. Jensen und Chandra interpolierten den gesamten dynamischen Bereich durch einfache Addition der Relaxationszeiten des Static-Dephasing-Regimes (Gleichung (6.8)) und des Motional-Narrowing-Regimes (Gleichung (3.34)), und erhielten
| (6.10) |
Das gleiche Ergebnis wurde von Yung [46] gefunden, indem er eine empirische Interpolationsformel für die skalierte Relaxationsrate in Abhängigkeit vom skalierten Radius fand:
| (6.11) |
mit und . In Abbildung 6.2 werden die Vorhersagen des Strong-Collision-Modells (Normierung des Plots in Abbildung 6.1) mit Gleichung (6.11) verglichen.
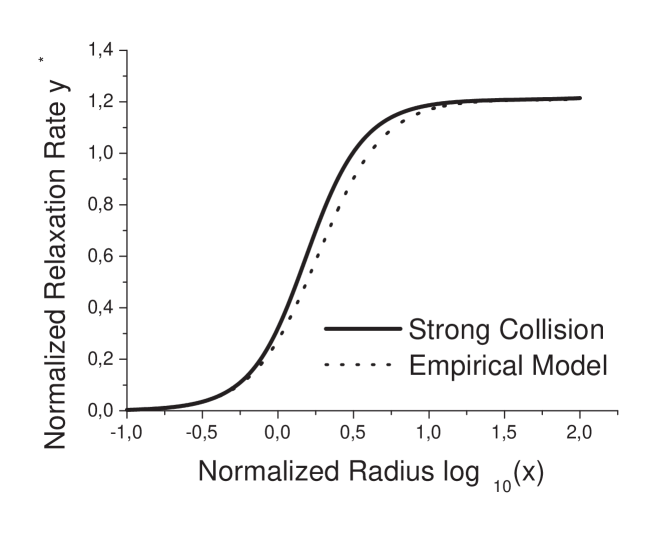
Eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse des Strong-Collision-Modells und des empirischen Modells für alle Werte des Kugelradius ist zu erkennen.
Um die Abhängigkeit der Relaxationsrate vom Frequenzshift zu untersuchen, wurden in Abbildung 6.3 die Ergebnisse des Strong-Collision-Modells nach Gleichung (6.5) mit der Interpolationsformel (6.10) und mit Monte-Carlo-Simulationen von Jensen und Chandra (siehe Abbildung 1 in [86]) verglichen. Zwischen den Ergebnissen der Strong-Collision-Näherung, den Simulationen von Jensen und Chandra und der Interpolationsformel ist eine gute Übereinstimmung zu erkennen. Zusätzlich kann der Übergang zwischen den Diffusionsregimen identifiziert werden und der Wendepunkt (siehe Abbildung 6.3) stimmt mit der Vorhersage von Yablonskiy und Haacke nach Ungleichung (3.31) überein.
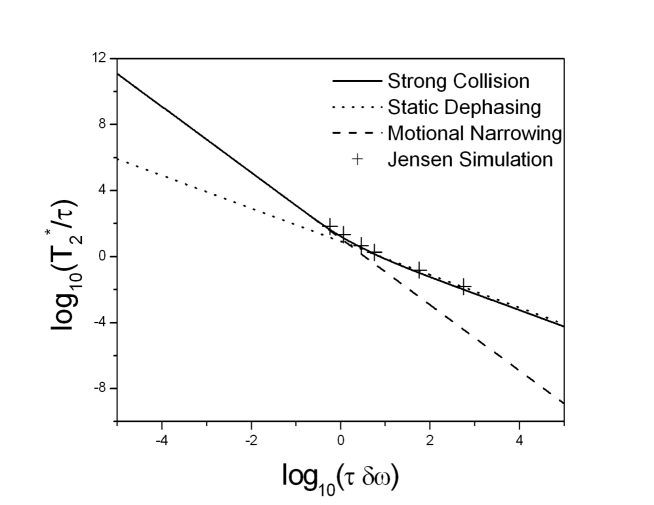
Die entscheidenden Parameter, welche die Relaxationsrate bestimmen, sind die Konzentration der USPIOs, der Radius des magnetischen Kernes, die Magnetisierungsdifferenz zwischen magnetischem Kern und umgebendem Gewebe sowie der Diffusionskoeffizient. Zwei Frequenzskalen bestimmen den ursächlichen Relaxationsmechanismus. Die dynamische Frequenzskala charakterisiert den stochastischen Prozess der Diffusion durch die Korrelationszeit. Die magnetische Frequenzskala, die durch die äquatoriale Frequenz beschrieben wird, charakterisiert die Stärke der Magnetfeldinhomogenität aufgrund der Suszeptibilitätseffekte. Vergleicht man beide Frequenzen, können wie in Abschnitt 2.3.3 gezeigt, verschiedene Diffusionsregime unterschieden werden. Analytische Ausdrücke für die Relaxationszeit existierten bisher für jedes Diffusionsregime getrennt. Die Anwendbarkeit eines solchen Ausdrucks setzt die Kenntnis des zugrunde liegenden Diffusionsregimes voraus. Sind die Gewebeeigenschaften (d. h. der charakteristische Frequenzshift und die dynamische Frequenz ) bekannt, kann entschieden werden, welche Näherung angewandt werden soll. Werden jedoch magnetisch markierte Zellen betrachtet, ist die Ausgangssituation genau umgekehrt. Die Messung der Relaxationszeit soll ja erst die Information über das zu untersuchende Gewebe liefern, d. h. man weiß nicht, in welchem Diffusionsregime man sich befindet und folglich ist auch nicht bekannt, welche Näherung benutzt werden soll, um die Konzentration der Zellen zu berechnen. Deshalb wurde eine quantitative Beschreibung der Relaxationszeit abgeleitet, die über den gesamten Frequenzbereich gültig ist und deshalb auch die Grenzfälle (Motional-Narrowing und Static-Dephasing) enthält.
Mit den erhaltenen Ergebnissen können jetzt aus der gemessenen Relaxationszeit Informationen über die untersuchten Zellen gewonnen werden. Mit den bekannten Parametern (Volumenanteil , Frequenzshift und Diffusionskoeffizient ) kann die Relaxationsrate in Abhängigkeit vom Radius nach Gleichung (6.5) ermittelt werden. Aus der gemessenen Relaxationsrate kann nun, wie in Abbildung 6.4 veranschaulicht, der Radius ermittelt werden. Des Weiteren kann man auch erkennen, in welchem Diffusionsregime man sich befindet. Solange die Näherung nach Gleichung (6.6) gilt (in Abbildung 6.4 als gestrichelte Linie dargestellt), befindet man sich im Motional-Narrowing-Grenzfall. Im Plateu-Bereich (in Abbildung 6.4 als gepunktete Linie dargestellt) ist die Relaxationsrate vom Kugelradius unabhängig und man befindet sich im Static-Dephasing-Bereich. In dem in Abbildung 6.4 skizzierten Beispiel ist man jedoch weder im Motional-Narrowing-Grenzfall noch im Static-Dephasing-Bereich.
Ähnlich kann man verfahren, wenn man beispielsweise die Konzentration bzw. die Dichte der markierten Zellen bestimmen will. Wenn man weiß, wie groß die magnetischen Partikel im Inneren der Zelle sind, kann man die Abhängigkeit der Relaxationsrate vom Volumenanteil darstellen und dann aus der gemessenen Relaxationsrate den Volumenanteil ermitteln.
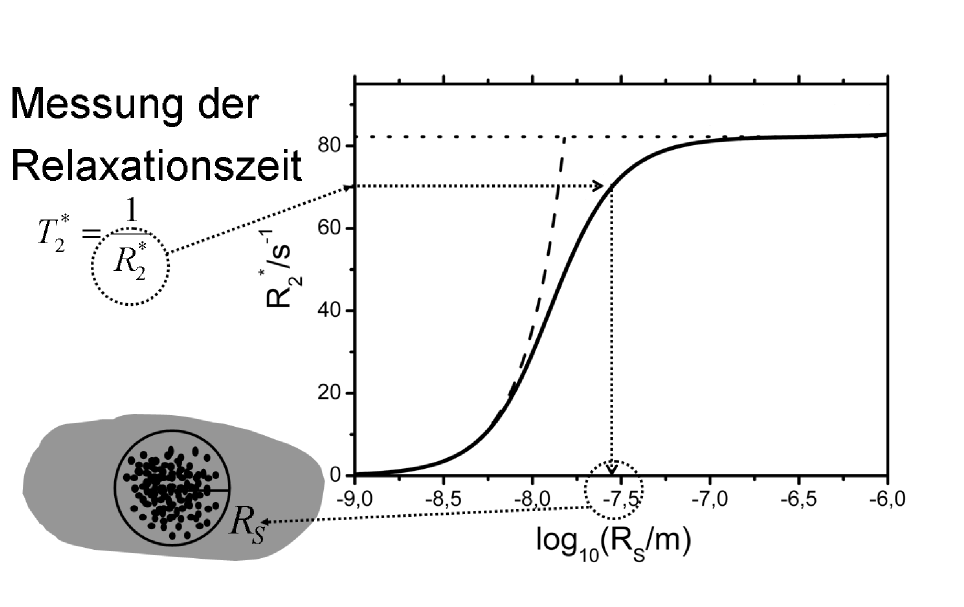
Kapitel 7 Skalierungsgesetze
7.1 Skalierungen in der Kernspinresonanz
Die transversalen Relaxationszeiten und sind fundamentale Größen in der Kernspinresonanzbildgebung, besonders zur Charakterisierung von Geweben und deren Eigenschaften. Der Einfluss statischer Magnetfeldinhomogenitäten auf diese Relaxationszeiten ist von grundsätzlichem Interesse zum Verständnis der Relaxationsprozesse innerhalb des Voxels. Die Relaxationszeiten und werden durch den Suszeptibilitätskontrast, durch äußere Magnetfelder und durch die Diffusion im umgebenden Medium beeinflusst. Um Veränderungen dieser Parameter und deren Auswirkung auf die Relaxationszeit beschreiben zu können, ist es wichtig, das Skalierungsverhalten dieser Parameter zu verstehen.
So stellt sich beispielsweise die Frage, wie sich Kontrastmittel verhalten, die einen stärkeren Suszeptibilitätssprung zum umgebenden Gewebe erzeugen. Reicht es aus, einfach die Feldstärke oder die Suszeptibilitätsdifferenz um einen bestimmten Faktor zu erhöhen, oder müssen gleichzeitig auch die charakteristischen Abmessung des Teilchens verändert werden, um die Relaxivität zu erhöhen? Dabei ist es oft sinnvoll zu wissen, wie sich Gewebeparameter bei anderen Feldstärkewerten verhalten. Deshalb ist es wichtig, einen allgemeinen Zusammenhang zu finden, der die Veränderungen der charakteristischen Abmessung und der äußeren Feldstärke mit der transversalen Relaxationszeit verbindet. Trotz dieser Tatsache gibt es in der Literatur nur wenige Arbeiten, die sich mit diesem Thema befassen. Weisskoff et al. [88] diskutierten das Skalierungsverhalten der Relaxationsrate im Kontext mikroskopischer Suszeptibilitätsvariationen. Ausgehend von der Bloch-Torrey-Gleichung [31] wurden in [88] zwei spezielle Skalierungsgesetze erhalten und durch numerische Simulationen verifiziert.
Durch Anwenden der Strong-Collision-Approximation [8, 9, 55] kann eine rigorose Ableitung verallgemeinerter Skalierungsgesetze für die transversalen Relaxationszeiten und angeben werden. Zuerst wird ein einfaches Modell eines magnetisierten Körpers in einem Voxel betrachtet und dann wird die Strong-Collision-Approximation genutzt, um allgemeingültige Skalierungsgesetze zu erhalten. Zur Illustration werden die Ergebnisse auf eine zylindrische Geometrie, die üblicherweise als Modell für eine Kapillare benutzt wird, angewandt.
7.2 Modell des Voxels
Wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, wird ein Körper innerhalb eines Voxels betrachtet, der einen Suszeptibilitätsunterschied zum umgebenden Medium erzeugt (siehe Abbildung 2.3). Aus der Form des Gebietes ergibt sich die Geometriefunktion , welche zur Berechnung der Korrelationszeit benötigt wird. Einsetzen der lokalen Resonanzfrequenz (2.42) in den Ausdruck für die Korrelationszeit in Gleichung (3.10) ergibt
| (7.1) |
Offensichtlich hängt diese Korrelationszeit nur von der Geometriefunktion des Körpers und dem Diffusionskoeffizienten ab. Nach Ausführen der Integration zeigt sich, dass die Korrelationszeit nur von einer charakteristischen Länge , dem Diffusionskoeffizienten und dem Volumenanteil abhängt. Dies bedeutet, dass die Signaleigenschaften eines bestimmten Voxels vollständig durch die Geometriefunktion , den Diffusionskoeffizienten und der charakteristischen Frequenz festgelegt sind. Mit der Korrelationszeit, die sich aus der Geometriefunktion des Körpers ergibt, kann das gesamte Problem auf die Untersuchung der Abhängigkeit reduziert werden.
7.3 Allgemeine Ergebnisse
Um einen Zusammenhang zwischen der Relaxationszeit , der Korrelationszeit und der charakteristischen Frequenz zu finden, wird (wie in Abschnitt 2.3 beschrieben) die Zeitentwicklung des Signals aus dem Voxel analysiert. Die Laplace-Transformierte des Magnetisierungs-Zeit-Verlaufs lässt sich in der Strong-Collision-Näherung entsprechend Gleichung (2.68) durch die Laplace-Transformierte im Static-Dephasing-Regime ausdrücken. Der Signal-Zeit-Verlauf im Static-Dephasing-Regime (Gleichung (2.72)) hängt nur von der lokalen Resonanzfrequenz und dem Dephasierungsvolumen ab.
Zur Bestimmung der Relaxationszeit wird die Mean-Relaxation-Time-Approximation genutzt [32]. In dieser Näherung erhält man:
| (7.2) |
Anwenden dieser Mean-Relaxation-Time-Approximation auf den allgemeinen Zusammenhang in Gleichung (2.68) liefert
| (7.3) |
Die Laplace-Transformierte ergibt sich aus dem Signal-Zeit-Verlauf im Static-Dephasing-Regime (Gleichung (2.72)) zu
| (7.4) |
Mit der in Gleichung (2.42) eingeführten Darstellung der lokalen Resonanzfrequenz in der Form folgt die Abhängigkeit der Relaxationszeit von und :
| (7.5) |
Dieses Ergebnis impliziert direkt das Skalierungsgesetz
| (7.6) |
wobei die Skalierungsparameter und beliebige reelle Zahlen sind. Da die Geometriefunktion zur Ableitung dieser Beziehung nicht näher spezifiziert wurde, ist dieses Skalierungsgesetz für alle Objekte der gleichen Form gültig. Die Parameter wie Größe, Suszeptibilität, äußeres Magnetfeld oder Diffusionskoeffizient des umgebenden Mediums können beliebig gewählt werden. Diese Parameter bestimmen die zwei Skalierungsvariablen und für eine vorgegebene Form des magnetischen Körpers.
Um ein ähnliches Ergebnis für die Spin-Echo-Relaxationszeit zu erhalten, wird die aus der Strong-Colission-Näherung herleitbare Beziehung
| (7.7) |
genutzt, die sowohl das Static-Dephasing-Regime als auch das Motional-Narrowing-Regime als Grenzfall enthält [9, 55]. Das resultierende Skalierungsgesetz kann in der Form
| (7.8) |
geschrieben werden. Die Gleichungen (7.5) und (7.7) wurden in der Strong-Colission-Näherung abgeleitet. Deshalb gelten die Skalierungsgesetze auch nur in dieser Näherung. Jedoch wurde in [8] angegeben, dass die Vorhersagen dieses Modells auch weit über die Annahmen der Strong-Colission-Näherung hinaus gültig sind. Dies trifft dann auch für den Gültigkeitsbereich der Skalierungsgesetze zu. Entsprechend den Ausführungen von Weisskoff et al. [88] ist es möglich, aus der Bloch-Torrey-Gleichung (2.54) die Relation
| (7.9) |
herzuleiten, wobei eine charakteristische Länge des magnetisierten Objektes und eine beliebige reelle Konstante ist. Dieses Skalierungsgesetz ist abhängig von der charakteristischen Größe , dem Diffusionskoeffizienten und der charakteristischen Frequenz . Dies impliziert zusammen mit Gleichung (7.8), dass die Korrelationszeit eine Funktion von und ist. Im Skalierungsgesetz von Weisskoff werden und variiert, während konstant bleibt. Dies entspricht in unserem Skalierungsgesetz nach Gleichung (7.8) dem Fall und impliziert, dass auch konstant bleiben muss. Daraus kann gefolgert werden, dass eine Funktion des Verhältnisses von zu sein muss:
| (7.10) |
Um diese Abhängigkeit zu präzisieren, kann die Koordinatentransformation auf Gleichung (7.1) angewandt werden - was einer zentrischen Streckung entspricht -, wobei der Volumenanteil unverändert bleibt. Wird berücksichtigt, dass die Form der Geometriefunktion unter dieser Transformation variablenunabhängig ist, d. h. , ergibt sich für die Korrelationszeit . Dies stimmt auch mit dem in Gleichung (4.12) erhaltenen Ergebnis überein. Ein analoger Zusammenhang wurden von Stables et al. postuliert (siehe Gleichung (15) in [33]). Für eine vorgegebene Gestalt des magnetischen Körpers ergibt sich für die Abhängigkeit von :
| (7.11) |
wobei alle Größen und Operatoren bezüglich der neuen Variable angegeben sind. Die implizite Abhängigkeit von ist durch die Integrationsgebiete und in der Gleichung (2.44) bzw. in der Gleichung (7.1) gegeben.
7.4 Gültigkeitsbereich der Strong-Collision-Näherung
Mit dem allgemeinen Ausdruck für die Relaxationszeit nach Gleichung (7.5) kann nun ein mathematisches Kriterium für den Gültigkeitsbereich der Strong-Collision-Näherung angeben werden, welche im Fall gültig ist. Wird der Zusammenhang aus Gleichung (6.5) genutzt und in Gleichung (7.5) eingesetzt, ergibt sich das Kriterium
| (7.12) |
Im Motional-Narrowing-Regime (in dem für die Relaxationszeit gilt) führt die Gültigkeitsbedingung für die Strong-Collision-Näherung zu der Ungleichung . Im entgegengesetzten Grenzfall des Static-Dephasing-Regimes (in dem für die Relaxationszeit gilt) führt dieselbe Bedingung zu . Daher kann Gleichung (7.12) bis zum quadratischen Term in entwickelt werden und es ergibt sich
| (7.13) |
wobei der Erwartungswert einer Funktion in Gleichung (3.11) definiert ist. Die erhaltene Relation (7.13) kann als mathematisches Kriterium benutzt werden, um den Gültigkeitsbereich der Strong-Collision-Näherung für eine bestimmte Form des untersuchten magnetischen Körpers festzulegen.
7.5 Anwendung auf eine Kapillare
Die oben erhaltenen allgemeingültigen Skalierungsgesetze werden auf den konkreten Fall einer Kapillare angewandt. Die Abhängigkeit der transversalen Relaxationszeit von den Parametern des Kapillarsystems kann genutzt werden, um die Perfusionsreserve im Myokard zu bestimmen [5]. Dazu wurden nach kombinierter Gabe von Vasodilatator und Kontrastmittel Messungen der transversalen Relaxationszeit durchgeführt. Das Konzept dieser Methode ist in der Arbeit [5] erklärt. Sowohl die Konzentration des Vasodilatators als auch die Konzentration des Kontrastmittels beeinflussen die transversalen Relaxationszeiten. Der Vasodilatator beeinflusst den Kapillarradius und die Suszeptibilitätseffekte des Kontrastmittels verändern den Parameter . Im Falle einer hohen Konzentration sowohl von Vasodilatator als auch von Kontrastmittel ist das Static-Dephasing-Regime das zugrunde liegende Diffusionsregime, während im entgegengesetzten Fall niedriger Konzentrationen von Vasodilatator und Kontrastmittel das Motional-Narrowing-Regime das zugrunde liegende Diffusionsregime ist. Während das Static-Dephasing-Regime im Abschnitt 4.2.3 ausführlich untersucht wurde, können die abgeleiteten Skalierungsgesetze benutzt werden, um allgemeine Ergebnisse zu erhalten. Diese Ergebnisse können zur Beschreibung des Effektes von gleichzeitiger Gabe des Vasodilatators und des Kontrastmittels verwendet werden.
Zu diesem Zweck wird eine Kapillare mit dem Neigungswinkel in einem äußeren Magnetfeld betrachtet (siehe Abbildung 2.5). Die Suszeptibilität im Inneren der Kapillare wird durch die Konzentration des Kontrastmittels bestimmt, während die Suszeptibilität des umgebenden Mediums ist (siehe Abbildung 2.5). Der Radius der Kapillare kann direkt durch die Konzentration des Vasodilatators beeinflusst werden. Die lokale Larmor-Frequenz, die durch die Suszeptibilitätsdifferenz innerhalb des Voxels induziert wird, ist in Gleichung (2.53) gegeben.
Die Korrelationszeit der um die Kapillare diffundierenden Spins wurde in Abschnitt 3.3.2 berechnet und ist in den Gleichungen (3.29) und (3.30) für strahlende bzw. reflektierende Randbedingungen angegeben. Der Zusammenhang zwischen der transversalen Relaxationszeit und der geometrischen Anordnung der Kapillare wurde bereits in verschiedenen Arbeiten untersucht [8, 10, 55, 89]:
| (7.14) |
Mit den beiden Gleichungen (4.12) und (7.14) ist es nun möglich, die Suszeptibilitätsdifferenz , den Kapillarradius und die Relaxationszeiten und miteinander zu verknüpfen. Um die Anwendbarkeit der Skalierungsgesetze zu illustrieren, wurde der Einfluss der Erweiterung des Kapillarradius auf die Relaxationsrate für verschiedene Suszeptibilitätsdifferenzen untersucht. Mit dem allgemeinen Skalierungsgesetz nach Gleichung (7.8) und dem Ausdruck für die Korrelationszeit nach Gleichung (4.12), ergibt sich im Fall folgende Form des Skalierungsgesetzes für die transversale Relaxationszeit: . Dieser Spezialfall des allgemeinen Skalierungsverhaltens stimmt mit dem Ergebnis von Weisskoff et al. (Gleichung (9) in [88]) überein. Eine Anwendung dieses Skalierungsgesetzes ist in Abbildung 7.1 dargestellt.
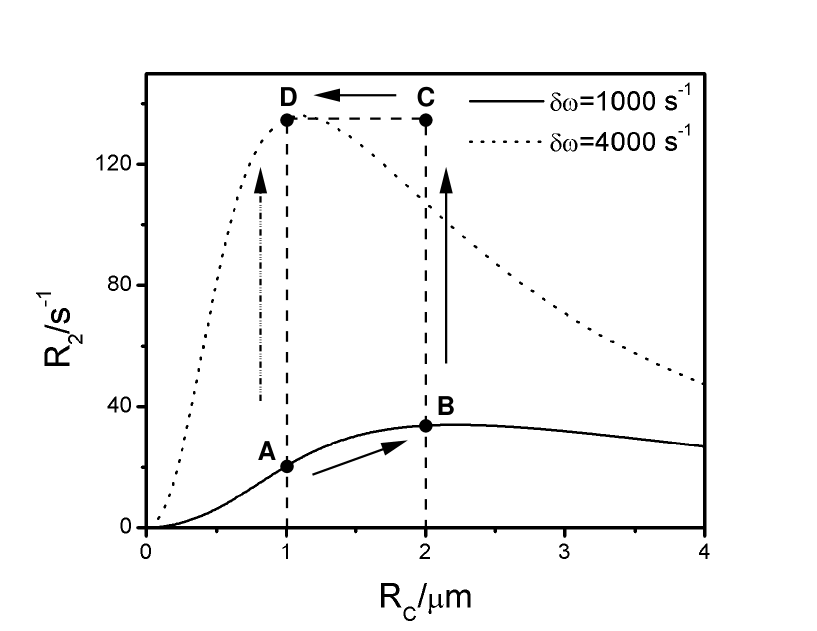
7.6 Weitere Beispiele zu den Skalierungsgesetzen
Die oben angegebenen allgemeinen Skalierungsgesetze in den Gleichungen (7.6) und (7.8) können noch weiter vereinfacht werden, um zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dazu wird auf der linken Seite von Gleichung (7.6) die Substitution und vorgenommen. Auf der rechten Seite von Gleichung (7.6) wird dann durch und durch ersetzt. Damit ergibt sich
| (7.15) |
Jetzt können und wieder in und umbenannt werden. Es zeigt sich, dass nur noch der Quotient in die Betrachtungen eingeht. Damit können die Skalierungsgesetze in der Form
| (7.16) | ||||
| (7.17) |
geschrieben werden. Diese Form der Skalierungsgesetze erlaubt es nun, die Parameter, welche die Relaxationszeiten beeinflussen, durch nur einen einzigen Skalierungsfaktor zu beschreiben.
Als Beispiel wird ein beliebig geformtes Kontrastmittelteilchen betrachtet. Dies kann entweder ein kugelförmiger USPIO oder ein zylinderförmiges Nanoröhrchen sein. Wird statt der Relaxationszeit die Relaxationsrate betrachtet, so ergibt sich die Beziehung
| (7.18) |
Dieser Zusammenhang ist nun leicht interpretierbar. Ein Kontrastmittelteichen erzeugt aufgrund des Suszeptibilitätsunterschiedes zur Umgebung (charakterisiert durch den Frequenzshift ) und unter Berücksichtigung der Diffusion um das Kontrastmittelteilchen (charakterisiert durch die Korrelationszeit ) die Relaxationsrate . Will man nun diese Relaxationsrate um den Faktor erhöhen (siehe linke Seite der Gleichung (7.18)), reicht es nicht aus, nur den Frequenzshift um den Faktor auf den Wert zu vergrößern, es muss auch gleichzeitig die Korrelationszeit um den Faktor auf den Wert verkleinert werden. Da die Korrelationszeit proportional zum Quadrat eines charakteristischen Durchmessers des Kontrastmittelteilchens ist (, wobei der Radius eines USPIOs oder eines Nanoröhrchens ist), muss also auch die Abmessung des Kontrastmittelteichens um den Faktor verkleinert werden.
Kapitel 8 Zusammenfassung
Das Dephasierungsverhalten und die daraus resultierende Relaxation der Magnetisierung sind Grundlage aller auf der Kernspinresonanz basierenden bildgebenden Verfahren. Das erhaltene Signal der präzedierenden Protonen wird wesentlich von den Eigenschaften des untersuchten Gewebes bestimmt. Insbesondere die durch magnetisierte Stoffe wie z. B. desoxygeniertes Blut (BOLD-Effekt) oder magnetische Nanopartikel erzeugten Suszeptibilitätssprünge gewinnen zunehmend Bedeutung in der biomedizinischen Bildgebung. In der vorliegenden Arbeit wurden die Einflüsse von Feldinhomogenitäten auf das NMR-Signal untersucht.
Nach einer kurzen Einleitung in Kapitel 1, die einen Überblick zum Inhalt der Arbeit gibt, folgt in Kapitel 2 die Vorstellung der für die folgenden Untersuchungen nötigen Grundlagen, sowohl aus physikalischer und mathematischer, als auch aus biologischer Sicht. Ein allgemeines Modell der Magnetfeldinhomogenitäten wird entwickelt und die lokale Resonanzfrequenz um Zylinder und Kugeln wird angegeben. Des Weiteren wird die für die nachfolgende Beschreibung der Diffusionseffekte um magnetisierte Körper benutzte „Strong-Collision-Näherung“ erklärt.
Wie in den physikalischen Grundlagen dargestellt wurde, kann die Diffusion in einem inhomogenen Magnetfeld als stochastischer Prozess im Sinne einer Brownschen Molekularbewegung aufgefasst werden. Eine wesentliche Größe zur Beschreibung dieses Prozesses ist die Korrelationszeit. In Kapitel 3 wurde diese Korrelationszeit der Diffusionsbewegung um einen magnetisierten Körper untersucht. Ein Großteil dieser Ergebnisse ist in unserer Arbeit [44] veröffentlicht. Für die im Folgenden interessierenden Spezialfälle in Form von Zylindern und Kugeln konnte ein Zusammenhang zwischen der Korrelationszeit, dem Diffusionskoeffizienten, dem Volumenanteil und dem Zylinder- bzw. Kugelradius hergestellt werden. Des Weiteren wurde die Oberflächenbeschaffenheit des magnetisierten Körpers berücksichtigt. Im Falle einer impermeablen Oberfläche wurden reflektierende Randbedingungen angenommen, d. h. sobald ein Spin die Oberfläche berührt, wird die Trajektorie durch eine symmetrische Trajektorie fortgesetzt. Können die Wassermoleküle die Oberfläche des magnetisierten Körpers jedoch durchdringen, müssen strahlende Randbedingungen angenommen werden. Diese können im Sinne eines aus der Physiologie bekannten Oberflächenpermeabilitätsproduktes berücksichtigt werden.
Die Stärke der Suszeptibilitätseffekte wird durch die charakteristische Frequenz beschrieben, wobei die Suszeptibilitätsdifferenz zum umgebenden Medium ist. Diese sogenannte statische Frequenzskala kann mit der dynamischen Frequenzskala, die als das Inverse der Korrelationszeit definiert ist, verglichen werden. Dadurch ist eine Einteilung der Diffusionsregime möglich. Wenn die durch die Suszeptibilitätsdifferenz hervorgerufenen Effekte größer sind als der Einfluss der Diffusion, d. h. , ist das Static-Dephasing-Regime das zugrunde liegende Diffusionsregime. Im umgekehrten Grenzfall herrscht das Motional-Narrowing-Regime. Mit den Ergebnissen aus Kapitel 3 kann nun aus den charakteristischen Parametern des Gewebes (Diffusionskoeffizient, Durchmesser des magnetisierten Körpers, Volumenanteil, Suszeptibilitätsdifferenz) ermittelt werden, welches Diffusionsregime das zugrunde liegende ist. Damit kann entschieden werden, welche Näherungsmethode zur Beschreibung der Relaxation angewandt werden muss.
Für den Fall des Motional-Narrowing-Regimes, der z. B. zur Beschreibung der Relaxationseffekte von injizierbaren MR-Kontrastmitteln angewandt wird, kann die Relaxationszeit leicht aus der Korrelationszeit und dem Erwartungswert der lokalen Frequenz um ein Kontrastmittelteilchen entsprechend der Gleichung ermittelt werden. Für niedrige Kontrastmittelkonzentrationen ergibt sich wie erwartet ein linearer Zusammenhang zwischen Relaxationsrate und Konzentration des Kontrastmittels.
Zur Charakterisierung biologischer Gewebe, die Feldinhomogenitäten enthalten, eignen sich nicht nur die Relaxationszeiten, sondern auch die Frequenzverteilung, die von den Feldinhomogenitäten erzeugt wird. Diese Frequenzverteilungen werden in Kapitel 4 untersucht. Mit dieser Methode ist es möglich, die NMR-Signalentstehung im magnetisch inhomogenen Gewebe über den gesamten Dynamikbereich, also vom Motional-Narrowing-Regime zum Static-Dephasing-Regime zu beschreiben. Dazu wird die Frequenzverteilung innerhalb eines Voxels beschrieben. Zuerst wurde das einfach zu beschreibende Static-Dephasing-Regime untersucht, in dem die Diffusion vernachlässigt werden kann. Durch Anwenden des aus der statistischen Physik bekannten Formalismus der Zustandsdichten konnte die Frequenzverteilung um ein zylinderförmiges Objekt analytisch ermittelt werden. Die Ergebnisse sind in unserer Arbeit [51] veröffentlicht. Diese analytischen Werte konnten durch Simulationen und durch numerische Rechnungen bestätigt werden. Ein Phantom zur Messung der exakten Form der Frequenzverteilung wurde entwickelt und auch die experimentellen Ergebnisse stimmen mit den analytischen Resultaten überein. An diesem Beispiel der Frequenzverteilung um eine Kapillare konnte sehr gut gezeigt werden, wie die vier Grundlagen, auf denen der Prozess der physikalischen Erkenntnisgewinnung basiert – nämlich analytische Ergebnisse, Computersimulationen, numerische Rechnungen und die experimentelle Bestätigung – genutzt wurden, um saubere und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Aus dieser intensiven Bearbeitung – sowohl von theoretischer als auch experimenteller Seite – ergaben sich weitere interessante Fragestellungen, wie z. B. der Einfluss der Diffusionseffekte des umgebenden Mediums auf die Frequenzverteilung. Um diese Fragestellung erschöpfend zu beantworten, wurde die im Grundlagenabschnitt beschriebene Strong-Collision-Approximation genutzt. Durch Verallgemeinerung der Ergebnisse des Static-Dephasing-Regimes konnte ein Formalismus zur Beschreibung der Frequenzverteilung, der über den gesamten Dynamikbereich gültig ist, abgeleitet werden. Die erhaltenen Ergebnisse stimmen mit den aus der Linienformtheorie nach Kubo erhaltenen Resultaten überein. Diese Ergebnisse wurden in der Arbeit [68] veröffentlicht.
Mit der in Kapitel 3 untersuchten Korrelationszeit konnte die Frequenzverteilung um zylinderförmige und kugelförmige Objekte über den gesamten Dynamikbereich beschrieben werden. Mit diesen Ergebnissen können nun nicht nur Gradientenechoexperimente, sondern auch weiterentwickelte Pulssequenzen, wie z. B. SSFP-Sequenzen, beschrieben werden.
Die Charakterisierung von Geweben durch Relaxationszeiten setzt die Annahme eines exponentiellen Magnetisierungszerfalles voraus. Die bisherigen Verfahren zur Beschreibung der Dephasierung in Bildgebungsexperimenten beruhen auf dem Anderson-Weiss-Modell. Ausgangspunkt dieses Modells ist die Annahme einer gaußverteilten Stärke der Störfelder bzw. Störfrequenzen, die durch Magnetfeldinhomogenitäten induziert werden. Entscheidend für den Magnetisierungszerfall ist jedoch der Phasenwinkel. Problematisch ist, dass Anderson und Weiss als bewiesen annahmen, es sei die Gaußverteilung des Phasenwinkels automatisch bei einer Gaußverteilung der Störfelder gegeben.
Eine exakte Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Frequenz- und Phasenverteilung wurde in Kapitel 5 vorgenommen und in unserer Arbeit [35] veröffentlicht. Dabei wurden auch erstmals die exakten Kriterien für die Anwendbarkeit des Anderson-Weiss-Modell herausgearbeitet. Zentraler Untersuchungsgegenstand ist die Übergangswahrscheinlichkeit eines diffundierenden Spins von der Störfrequenz zur Frequenz innerhalb des Zeitintervalls , auch als Greensche Funktion bezeichnet. Diese Betrachtungsweise knüpft direkt an die bereits von Einstein eingeführte stochastische Beschreibung der Diffusion an.
Im Rahmen dieser Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass eine gaußförmige Verteilung der Phasenwinkel äquivalent zu einer gaußförmigen Übergangswahrscheinlichkeit der Resonanzfrequenzen ist, jedoch folgt aus einer gaußförmigen Frequenzverteilung nicht eine gaußförmige Phasenwinkelverteilung. Dies bedeutet, dass die Annahme einer Gaußschen Dephasierung der Phasenwinkel die Übergangsdynamik zwischen lokalen Frequenzen auf eine sehr spezielle Klasse von stochastischen Prozessen beschränkt. Nur wenn die Übergangsdynamik durch einen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess beschrieben werden kann, also sämtliche Charakteristika eines stationären Gaußschen Prozesses aufweist, ist das Anderson-Weiss-Modell der Dephasierung anwendbar. Während Anderson und Weiss als einzige Voraussetzung für die Anwendbarkeit ihres Modells eine gaußförmige Gleichgewichtsverteilung in den Störfeldfrequenzen nannten, konnte gezeigt werden, dass diese Voraussetzung nicht ausreichend ist, sondern dass noch weitere Anforderungen an die Stochastik des Übergangsprozesses zu stellen sind.
Zur praktischen Anwendung auf klinische Fragestellungen reichen jedoch die transversalen Relaxationszeiten zur Charakterisierung von Geweben aus. Dazu wurde in Kapitel 6 die transversale Relaxationszeit magnetisch markierter Zellen untersucht. Die Ergebnisse wurden in unserer Arbeit [84] veröffentlicht. Zur Ableitung der Ergebnisse wurde angenommen, dass die Kontrastmittelteilchen (USPIOs) von den Zellen phagozytiert werden und sich zu einem Kern innerhalb der Zelle vereinigen. Dieser Kern wird von einer Wasserhülle umgeben, in der die Dephasierung stattfindet. In Abhängigkeit von dem Volumenanteil der magnetischen Teilchen (Kontrastmittelkonzentration), dem Diffusionskoeffizienten des umgebenden Mediums und dem Radius der magnetischen Teilchen konnte die Relaxationszeit bestimmt werden.
Einfache Skalierungsgesetze sind nützliche Werkzeuge, um Effekte zu verstehen, die durch die Veränderung verschiedener Parameter auftreten, welche das NMR-Experiment beeinflussen. In Kapitel 7 wird das allgemeine Skalierungsverhalten der transversalen Relaxationszeiten diskutiert. Die Ergebnisse wurden in unserer Arbeit [45] veröffentlicht. Dabei wird der Dephasierungsprozess um einen beliebig geformten Körper betrachtet, die in einem Voxel eingebettet ist. Das Signal von diesem Voxel kann als exponentieller Abfall mit einer transversalen Relaxationszeit angenähert werden. Diese transversale Relaxationszeit wird durch verschiedene Parameter beeinflusst: durch die Suszeptibilitätsdifferenz zwischen magnetischen Körper und umgebenden Medium, durch die äußere Feldstärke, durch den Diffusionskoeffizienten des umgebenden Mediums sowie durch eine charakteristische Länge des magnetischen Körpers. Mit den Skalierungsgesetzen kann nun beschrieben werden, wie sich beispielsweise eine Vervielfachung der äußeren Magnetfeldstärke, eine Vervielfachung des Diffusionskoeffizienten (durch Erwärmung des umgebenden Mediums) oder eine Vervielfachung der charakteristischen Abmessungen (Übergang vom Tierexperiment zur klinischen Anwendung) auf die transversalen Relaxationszeiten auswirken. Die Skalierungsgesetze werden am Beispiel einer blutgefüllten Kapillare unter dem gleichzeitigen Einfluss von Kontrastmittel und Vasodilatator illustriert.
Brief Summary
The properties of dephasing and the resulting relaxation of the magnetization are the basic principle on which all magnetic resonance imaging methods are based. The signal obtained from the gyrating spins is essentially determined by the properties of the considered tissue. Especially the susceptibility differences caused by magnetized materials (for example, deoxygenated blood, BOLD-effect) or magnetic nanoparticles are becoming more important for biomedical imaging. In the present work, the influence of such field inhomogeneities on the NMR-signal is analyzed.
A short introduction in Chapter 1 gives a survey of the content of the work. In Chapter 2, the physical and mathematical as well as biological fundamentals which are necessary for the following analysis are presented. A general model of the magnetic field inhomogeneities is developed and the local resonance frequency around a cylinder and a sphere is given. Furthermore, the strong collision approximation, which is used for the subsequent description of the diffusion effects around magnetized objects, is explained.
As illustrated in the section about the physical basics, the diffusion in an inhomogeneous magnetic field can be considered a stochastic process analogous to Brownian motion. An essential parameter to describe this process is the correlation time. In Chapter 3, this correlation time of the diffusion around a magnetized object is analyzed. Further results have been published in the work [44]. For the below-mentioned special cases of cylinders and spheres, it was possible to give a relation between the correlation time, diffusion coefficient, volume fraction, and radius. Furthermore, the surface structure of the magnetized object was considered. In the case of an impermeable surface, reflective boundary conditions were assumed, i.e. if a spin reaches the surface, the trajectory of this spin is continued by a symmetric one. If water molecules can penetrate the surface of the magnetized object, radiative boundary conditions have to be assumed. These boundary conditions can be considered in the same sense of the surface-permeability-product, which is well known from physiology.
The intensity of the susceptibility effects is described by the characteristic frequency , where is the susceptibility difference of the surrounding medium. This so-called static frequency scale can be compared with the dynamic frequency scale, which is defined as the inverse of the correlation time. Thus, it is possible to classify the diffusion regimes. If the effects caused by the susceptibility difference are greater than the influence of the diffusion (i.e., ) the underlying diffusion regime is the static dephasing regime. In the opposite limiting case the motional-narrowing regime dominates. With the results of Chapter 3 in hand, it is possible to determine the underlying diffusion regime from the characteristic parameters of the tissue (diffusion coefficient, diameter of the magnetized object, volume fraction, susceptibility difference). It is then possible to decide which approximation has to be applied to describe the relaxation effects.
In the motional narrowing regime, which is applied to describe the relaxation effects of MR contrast agents, the relaxation time can be easily calculated from the correlation time and the expectation value of the local frequency around a contrast agent particle according to the equation . Small values of the concentration of the contrast agent yield, as expected, a linear relationship between the relaxation rate and the concentration of the contrast agent.
Not only the relaxation time, but also the frequency distribution, which is caused by the field inhomogeneities, is applicable to characterizing biological tissues containing field inhomogeneities. These frequency distributions are analyzed in Chapter 4. Using this method, it is possible to describe the NMR signal formation in magnetic inhomogeneous tissue over the whole dynamic range from the motional narrowing regime to the static dephasing regime. For this reason, the frequency distribution inside a voxel is analyzed. First, the static dephasing regime, in which diffusion effects can be neglected, was analyzed. The formalism of the density of states, which is well known from statistical physics, could be applied to calculate the frequency distribution around a cylindrical object. The results are published in the work [51]. These analytical results could be verified by simulations and numerical analysis. To measure the exact form of the frequency distribution, an MRI phantom was developed. The experimental values were in good agreement with the analytical results. In the example of the frequency distribution around a capillary, it was demonstrated very well how the four fundamentals on which the gain of knowledge in physics is based - analytical analysis, computational simulation, numerical calculation, and the experimental verification - were utilized to obtain exact and reproducible results. This intensive treatment raised further new and interesting problems, such as the influence of the diffusion effects of the surrounding medium on the frequency distribution. To consider this issue, the strong collision approximation, described in the chapter on basic physical principles, was utilized. Generalizing the results of the static dephasing regime, it was possible to deduce a formalism valid over the whole dynamic range to describe the frequency distribution. The obtained results are in agreement with the results obtained from Kubos line shape theory. These results are published in the work [68].
With the correlation time studied in Chapter 3 in hand, it was possible to describe the frequency distribution around cylindrical and spherical objects over the whole dynamic range. These results can be used to describe more sophisticated pulse sequences (for example, SSFP-sequences).
The characterization of tissues by relaxation times presumes an exponential decay of the magnetization. Until now, the methods used to describe the dephasing in magnetic resonance imaging experiments have been based on the Anderson-Weiss-Model. The starting point of this model is the assumption of a Gaussian distribution of the fields and frequencies induced by the magnetic field inhomogeneities. However, the phase angle is essential for the time evolution of the magnetization. The problem is that Anderson and Weiss assumed that a Gaussian distribution of the phase angle necessarily follows from a Gaussian distribution of the resonance frequencies.
An exact analysis of the relation between the distribution of the resonance frequencies and the distribution of the phase angle is performed in Chapter 5 of this work and published in [35]. First, exact criteria for the applicability of the Anderson-Weiss-Model are achieved. The object of investigation is the transition probability of a diffusing spin from the resonance frequency to the resonance frequency during the time interval , which is also denoted as Green’s function This approach ties in directly with the description of the diffusion as a stochastic process, as established by Einstein.
In the framework of this analysis, it could be shown that a Gaussian distribution of the phase angle is equivalent to a Gaussian transition probability of the resonance frequencies, but a Gaussian distribution of the frequencies does not imply a Gaussian distribution of the phase angles. This means that the assumption of a Gaussian dephasing of the phase angles restricts the transition probability between local frequencies to a very limited class of stochastic processes. Only if the transition dynamics can be described by a Ornstein-Uhlenbeck-process, which exhibits all characteristics of a stationary Gaussian process, is the Anderson-Weiss-model applicable. While Anderson and Weiss assumed that only a Gaussian distribution of the frequencies is necessary for the applicability of their model, it could be shown that this assumption is not sufficient. Rather, further assumptions about the stochastic of the transition process have to be fulfilled.
However, for practical application in medical problems, the transverse relaxation times suffice to characterize tissues. Therefore, in Chapter 6 the transverse relaxation time of magnetically labeled cells is analyzed. The results are published in the work [84]. To deduce the results, it was assumed that the contrast agents (USPIOs) are phagocytosed and agglomerate to a magnetic core inside the cell. This core is surrounded by a shell of water in which the dephasing occurs. It was possible to determine the relaxation time as a function of the volume fraction of the magnetic core (concentration of the contrast agent), diffusion coefficient of the surrounding medium and the radius of the magnetic core.
Simple scaling laws are a useful tool to understand effects which arise from the variation of different parameters influencing the NMR-experiment. In Chapter 7, the general scaling behavior of the transverse relaxation times is discussed. The results are published in the work [45]. To achieve this, the diffusion process around an arbitrary object embedded in a voxel is considered. The signal of this voxel can be approximated as an exponential decay with a transverse relaxation time. This transverse relaxation time is influenced by many parameters: the susceptibility difference between the magnetized object and the surrounding medium, the strength of the external magnetic field, the diffusion coefficient of the surrounding medium, as well as a characteristic length of the magnetized object. With the scaling laws in hand, it is possible to describe the influence of a multiplication of the strength of the external magnetic field, a multiplication of the diffusion coefficient (by heating of the surrounding medium), or a multiplication of the characteristic diameter (change from animal experiment to the measurement of humans) on the transverse relaxation time. The scaling laws are visualized by the example of a blood filled capillary under the simultaneous influence of contrast agent and vasodilatator.
Literatur
- [1] Lauterbur PC. Measurements of local nuclear magnetic-resonance relaxation-times. Bull Am Phys Soc 1973;18:86.
- [2] Lauterbur PC. Image formation by induced local interactions - Examples employing nuclear magnetic resonance. Nature 1973;242:190-191.
- [3] Ogawa S, Lee TM, Kay AR, Tank DW. Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation. Proc Natl Acad Sci USA 1990;87:9868-9872.
- [4] Pauling L, Coryell CD. The magnetic properties and structure of hemoglobin, oxyhemoglobin and carbonmonoxyhemoglobin. Proc Natl Acad Sci USA 1936;22:210-216.
- [5] Wacker CM, Hartlep AW, Pfleger S, Schad LR, Ertl G, Bauer WR. Susceptibility-sensitive magnetic resonance imaging detects human myocardium supplied by a stenotic coronary artery without a contrast agent. J Am Coll Cardiol 2003;41:834-840.
- [6] Yablonskiy DA, Haacke EM. Theory of NMR signal behavior in magnetically inhomogeneous tissues: the static dephasing regime. Magn Reson Med 1994;32:749-763.
- [7] Callaghan PT. Principles of Nuclear Magnetic Resonance Microscopy. Clarendon Press, Oxford, 1991.
- [8] Bauer WR, Nadler W, Bock M, Schad LR, Wacker C, Hartlep A, Ertl G. Theory of the BOLD effect in the capillary region: an analytical approach for the determination of T2 in the capillary network of myocardium. Magn Reson Med 1999;41:51-62.
- [9] Bauer WR, Nadler W, Bock M, Schad LR, Wacker C, Hartlep A, Ertl G. Theory of coherent and incoherent nuclear spin dephasing in the heart. Phys Rev Lett 1999;83:4215-4218.
- [10] Kiselev VG, Posse S. Analytical model of susceptibility-induced MR signal dephasing: effect of diffusion in a microvascular network. Magn Reson Med 1999;41:499-509.
- [11] Sukstanskii AL, Yablonskiy DA. Effects of restricted diffusion on MR signal formation. J Magn Reson 2002;157:92-105.
- [12] Sukstanskii AL, Yablonskiy DA. Gaussian approximation in the theory of MR signal formation in the presence of structure-specific magnetic field inhomogeneities. J Magn Reson 2003;163:236-247.
- [13] Sukstanskii AL, Yablonskiy DA. Gaussian approximation in the theory of MR signal formation in the presence of structure-specific magnetic field inhomogeneities. Effects of impermeable susceptibility inclusions. J Magn Reson 2004;167:56-67.
- [14] Anderson PW, Weiss PR. Exchange narrowing in paramagnetic resonance. Rev Mod Phys 1953;25:269-276.
- [15] Kennan RP, Zhong J, Gore JC. Intravascular susceptibility contrast mechanisms in tissues. Magn Reson Med 1994;31:9-21.
- [16] Haase A, Frahm J, Matthaei D, Hanicke W, Merboldt K. FLASH imaging: rapid NMR imaging using low flip-angle pulses. J Magn Reson 1986;67:258-266.
- [17] Frahm J, Hänicke W, and Merboldt KD. Transverse coherence in rapid FLASH NMR imaging. J Magn Reson 1987;72:307-314.
- [18] Wood ML, Silver M, Runge VM. Optimization of Spoiler Gradients in FLASH MRI. Magn Reson Imaging 1987;5:455-463.
- [19] Crawley AP, Wood ML, Henkelman RM. Elimination of transverse coherences in FLASH MRI. Magn Reson Med 1988;8:248-260.
- [20] Ernst RR and Anderson WA. Application of Fourier transform spectroscopy to magnetic resonance. Rev Sci Instrum 1966;37:93-102.
- [21] Haacke EM, Brown RW, Thompson MR and Venkatesan R. Magnetic Resonance Imaging: Physical Principles and Sequence Design. John Wiley, New York, 1999.
- [22] Hinshaw WS. Image formation by magnetic resonance: the sensitive point method. J Appl Phys 1976;47:3709-3721.
- [23] Freeman R, Hill HDW. Phase and intensity anomalies in Fourier transform NMR. J Magn Reson 1971;4:366-383.
- [24] Gyngell ML. The Steady-State Signals in Short-Repetition-Time Sequences. J Magn Reson 1989;81:474-483.
- [25] Scheffler K, Hennig J. Is TrueFISP a gradient-echo or a spin-echo sequence? Magn Reson Med 2003;49:395-397.
- [26] Jackson JD. Classical Electrodynamics. 3rd ed. John Wiley and Sons Ltd. New York 2004.
- [27] Salomir R, de Senneville BD, Moonen CTW. A fast calculation method for magnetic field inhomogeneity due to an arbitrary distribution of bulk susceptibility. Concepts Magn Reson B 2003;9B:26-34.
- [28] Landau LD, Lifshitz EM. Course of Theoretical Physics, Vol. 2, 2nd. ed. Pergamon, Oxford, 1999.
- [29] Krogh A. The number and the distribution of capillaries in muscle with the calculation of the oxygen pressure necessary for supplying the tissue. J Physiol (Lond) 1919;52:409-415.
- [30] Reichenbach JR, Haacke EM. High-resolution BOLD venographic imaging: a window into brain function. NMR Biomed 2001;14:453-467.
- [31] Torrey HC. Bloch Equations with Diffusion Terms. Phys Rev 1956;104:563-565.
- [32] Nadler W, Schulten K. Generalized moment expansion for Brownian relaxation processes. J Chem Phys 1985;82:151-160.
- [33] Stables LA, Kennan RP, Gore JC. Asymmetric spin-echo imaging of magnetically inhomogeneous systems: theory, experiment, and numerical studies. Magn Reson Med 1998;40:432-442.
- [34] Cowan B. Nuclear Magnetic Resonance and Relaxation. University Press, Cambridge, 1997.
- [35] Bauer WR, Ziener CH, and Jakob PM. Non-Gaussian spin dephasing. Phys Rev A 2005;71:053412.
- [36] Spees WM, Yablonskiy DA, Oswood MC, Ackerman JJ. Water proton MR properties of human blood at 1.5 Tesla: magnetic susceptibility, T(1), T(2), T*(2), and non-Lorentzian signal behavior. Magn Reson Med 2001;45:533-542.
- [37] Abragam A. Principles of Nuclear Magnetism. Oxford University Press, New York, 1989.
- [38] Jensen JH, Chandra R. NMR relaxation in tissues with weak magnetic inhomogeneities. Magn Reson Med 2000;44:144-156.
- [39] Bauer WR, Schulten K. Theory of contrast agents in magnetic resonance imaging: coupling of spin relaxation and transport. Magn Reson Med 1992;26:16-39.
- [40] Szabo A, Schulten K, Schulten Z. First passage time approach to diffusion controlled reactions. J Chem Phys 1980;72:4350-4357.
- [41] Dattagupta S, Blume M. Stochastic theory of line shape. I. Nonsecular effects in the strong-collision model. Phys Rev B 1974;10:4540-4550.
- [42] Dattagupta S, Blume M. Stochastic theory of spin relaxation in liquids. Phys Rev A 1976;14:480-494.
- [43] Lynden-Bell RM. A density matrix formulation of the theory of magnetic resonance spectra in slowly reorienting systems. Mol Phys 1971;22:837-851.
- [44] Ziener CH, Bauer WR, Melkus G, Weber T, Herold V, Jakob PM. Structure-specific magnetic field inhomogeneities and its effect on the correlation time. Magn Reson Imaging 2006;24:1341-1347.
- [45] Ziener CH, Kampf T, Melkus G, Jakob PM, Bauer WR. Scaling laws for transverse relaxation times. J Magn Reson 2007;184:169-175.
- [46] Yung KT. Empirical models of transverse relaxation for spherical magnetic perturbers. Magn Reson Imaging 2003;21:451-463.
- [47] Carr HY. Steady-State Free Precession in Nuclear Magnetic Resonance. Phys Rev 1958;112:1693-1701.
- [48] Lebel RM, Menon RS, Bowen CV. Relaxometry model of strong dipolar perturbers for balanced-SSFP: application to quantification of SPIO loaded cells. Magn Reson Med 2006;55:583-591.
- [49] Cheng YC, Haacke EM, Yu YJ. An exact form for the magnetic field density of states for a dipole. Magn Reson Imaging 2001;19:1017-1023.
- [50] Bakker CJG, Bhagwandien R, Moerland MA, Ramos LMP. Simulation of susceptibility artifacts in 2D and 3D Fourier transform spin-echo and gradient-echo magnetic resonance imaging. Magn Reson Imaging 1994;12:767-774.
- [51] Ziener CH, Bauer WR, Jakob PM. Frequency distribution and signal formation around a vessel. Magn Reson Mater Phy 2005;18:225-230.
- [52] Landau LD, Lifshitz EM. Course of Theoretical Physics, Vol. 5, 2nd. ed. Pergamon, Oxford, 1999.
- [53] Bowen CV, Zhang X, Saab G, Gareau PJ, Rutt BK. Application of the static dephasing regime theory to superparamagnetic iron-oxide loaded cells. Magn Reson Med 2002;48:52-61.
- [54] Bassingthwaighte JB, Yipintsoi T, Harvey RB. Microvasculature of the dog left ventricular myocardium. Microvasc Res 1974;7:229-249.
- [55] Bauer WR, Nadler W, Bock M, Schad LR, Wacker C, Hartlep A, Ertl G. The relationship between T2* and T2 in myocardium. Magn Reson Med 1999;42:1004-1010.
- [56] Moiny F, Gillis, P, Roch A, Muller RN. Transverse relaxation of superparamagnetic contrast agents: a numerical analysis. Book of Abstracts: Eleventh Annual Meeting of the Society of Magnetic Resonance in Medicine 1992;2:1431.
- [57] Brooks RA, Moiny F, Gillis P. On T2-shortening by weakly magnetized particles: the chemical exchange model. Magn Reson Med 2001;45:1014-1020.
- [58] Baklanov DV, Demuinck ED, Thompson CA, Pearlman JD. Novel double contrast MRI technique for intramyocardial detection of percutaneously transplanted autologous cells. Magn Reson Med 2004;52:1438-1442.
- [59] Stoller SD, Happer W, Dyson FJ. Transverse spin relaxation in inhomogeneous magnetic fields. Phys Rev A 1991;44:7459.
- [60] Pütz B, Barsky D, Schulten K. Edge enhancement by diffusion: Microscopic magnetic resonance imaging of an ultra-thin glass capillary. Chem Phys Lett 1991;183:391-396.
- [61] Pütz B, Barsky D, Schulten K. Edge enhancement by diffusion in microscopic magnetic resonance imaging. J Magn Reson 1992;97:27-53.
- [62] Barsky D, Pütz B, Schulten K. Diffusional edge enhancement observed by NMR in thin glass capillaries. Chem Phys Lett 1992;200:88-96.
- [63] Kubo R. Fluctuations, Relaxation and Resonance in Magnetic Systems. Oliver & Boyd, Edinburgh, 1962.
- [64] Kubo R. Stochastic Liouville Equations. J Math Phys 1963;4:174-183.
- [65] Kiselev VG, Posse S. Analytical theory of susceptibility induced NMR signal dephasing in a cerebrovascular network. Phys Rev Lett 1998;81:5696-5699.
- [66] Bauer WR, Nadler W. Spin dephasing in the strong collision approximation. Phys Rev E 2002;65:066123.
- [67] Norris DG. The effects of microscopic tissue parameters on the diffusion weighted magnetic resonance imaging experiment. NMR Biomed 2001;14:77-93.
- [68] Ziener CH, Kampf T, Melkus G, Herold V, Weber T, Reents G, Jakob PM, Bauer WR. Local frequency density of states around field inhomogeneities in magnetic resonance imaging: effects of diffusion. Phys Rev E 2007;76:031915
- [69] Hahn EL. Spin Echoes. Phys Rev 1950;80:580-594.
- [70] Seppenwoolde JH, van Zijtveld M, Bakker CJ. Spectral characterization of local magnetic field inhomogeneities. Phys Med Biol 2005;50:361-372.
- [71] Case TA, Durney CH, Ailion DC, Cutillo AG, Morris AH. A mathematical model of diamagnetic line broadening in lung tissue and similar heterogeneous systems: calculations and measurements. J Magn Reson 1987;73:304-314.
- [72] Durney CH, Bertolina JA, Ailion DC, Christman R, Cutillo AG, Morris AH, Hashemi S. Calculation and interpretation of inhomogeneous line broadening in models of lungs and other heterogeneous structures. J Magn Reson 1989;85:554-570.
- [73] Bertolina JA, Durney CH, Ailion DC, Cutillo AG, Morris AH, Goodrich KC. Experimental verification of inhomogeneous line-broadening calculations in lung models and other inhomogenous structures. J Magn Reson 1992;99:161-169.
- [74] Cutillo AG. Application of Magnetic Resonance to the Study of Lung. Futura Publishing, Armonk, New York, 1996.
- [75] Oberhettinger F. Tables of Bessel Transforms. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1972.
- [76] Gradstein IS and Ryshik IM. Summen-, Produkt- und Integraltafeln/ Tables of Series, Products, and Integrals. Verlag Harry Deutsch, Thun, Frankfurt/Main, 1981.
- [77] Zimmerman JR, Foster MR. Standardization of N.M.R. high resolution spectra. J Phys Chem 1957;61:282-289.
- [78] Scheffler K, Seifritz E, Bilecen D, Venkatesan R, Hennig J, Deimling M, Haacke EM. Detection of BOLD changes by means of a frequency-sensitive trueFISP technique: preliminary results. NMR Biomed 2001;14:490-496.
- [79] Glutsch S. Excitons in Low-Dimensional Semiconductors: Theory, Numerical Methods, Applications. Springer, Berlin, 2004.
- [80] Bottomley PA. Selective volume method for performing localized NMR spectroscopy. United States Patent 1984:4 480 228.
- [81] Bottomley PA. Spatial Localization in NMR Spectroscopy in Vivo. Ann N Y Acad Sci 1987;508:333-348.
- [82] Weissleder R, Cheng H, Bogdanova A, Bogdanova A Jr. Magnetically labeled cells can be detected by MR imaging. J Magn Reson Imaging 1997;7:258-263.
- [83] Stroh A, Faber C, Neuberger T, Lorenz P, Sieland K, Jakob PM, Webb A, Pilgrimm H, Schober R, Pohl EE, Zimmer C. In vivo detection limits of magnetically labeled embryonic stem cells in the rat brain using high-field (17.6 T) magnetic resonance imaging. Neuroimage 2005;24:635-645.
- [84] Ziener CH, Bauer WR, Jakob PM. Transverse relaxation of cells labeled with magnetic nanoparticles. Magn Reson Med 2005;54:702-706.
- [85] Gillis P, Koenig SH. Transverse relaxation of solvent protons induced by magnetized spheres: application to ferritin, erythrocytes, and magnetite. Magn Reson Med 1987;5:323-345.
- [86] Jensen JH, Chandra R. Transverse Relaxation Time Field Dependence for Tissues with Microscopic Magnetic Susceptibility Variations. Proc Int Soc Magn Reson Med 1999:656.
- [87] Muller RN, Gillis P, Moiny F, Roch A. Transverse relaxivity of particulate MRI contrast media: from theories to experiments. Magn Reson Med 1991;22:178-182.
- [88] Weisskoff RM, Zuo CS, Boxerman JL, Rosen BR. Microscopic susceptibility variation and transverse relaxation: theory and experiment. Magn Reson Med 1994;31:601-610.
- [89] Kiselev VG, Novikov DS. Transverse NMR relaxation as a probe of mesoscopic structure. Phys Rev Lett 2002;89:278101.
Publikationsliste
Veröffentlichungen als Erstautor
-
1.
C. H. Ziener, S. Glutsch, and F. Bechstedt. RKKY interaction in semiconductors: Effects of magnetic field and screening, Phys. Rev. B 70, 075205 (2004).
-
2.
C. H. Ziener, W. R. Bauer, and P. M. Jakob. Transverse Relaxation of Cells Labeled with Magnetic Nanoparticles, Magn. Reson. Med. 54, 702-706 (2005).
-
3.
C. H. Ziener, W. R. Bauer, and P. M. Jakob. Frequency distribution and signal formation around a vessel, Magn. Reson. Mater. Phy. 18, 225-230 (2005).
-
4.
C. H. Ziener, W. R. Bauer, G. Melkus, T. Weber, V. Herold, P. M. Jakob. Structure-specific magnetic field inhomogeneities and its effect on the correlation time, Magn. Reson. Imaging 24, 1341-1347 (2006).
-
5.
C. H. Ziener, T. Kampf, G. Melkus, P. M. Jakob, W. R. Bauer. Scaling Laws for Transverse Relaxation Times, J. Magn. Reson. 184, 169-175 (2007).
-
6.
C. H. Ziener, T. Kampf, W. R. Bauer, P. M. Jakob, S. Glutsch, F. Bechstedt. Quantum Beats in Semiconductors, International Journal of Modern Physics B 21, Nos. 8-9, 1621-1625 (2007).
-
7.
C. H. Ziener, T. Kampf, G. Melkus, V. Herold, T. Weber, G. Reents, P. M. Jakob, W. R. Bauer. Local frequency density of states around field inhomogeneities in magnetic resonance imaging: Effects of diffusion, Phys. Rev. E 76, 031915 (2007).
-
8.
C. H. Ziener, T. Kampf, V. Herold, P. M. Jakob, W. R. Bauer, W. Nadler. Frequency autocorrelation function of stochastically fluctuating fields caused by specific magnetic field inhomogeneities, J. Chem. Phys. 129, 014507 (2008).
Veröffentlichung als Zweitautor
-
9.
W. R. Bauer, C. H. Ziener, and P. M. Jakob. Non-Gaussian spin dephasing, Phys. Rev. A 71, 053412 (2005)
Sonstige Veröffentlichung
-
10.
G. Klug, T. Kampf, C. H. Ziener, M. Parczyk, E. Bauer, V. Herold, E. Rommel, P. M. Jakob, W. R. Bauer. Murine atherosclerotic plaque imaging with the USPIO Ferumoxtran-10, Frontiers in Biosci., im Druck.
Diplomarbeit
-
•
C. H. Ziener. Spinquantenschwebungen in semimagnetischen Halbleitern, Jena (2003).
Wissenschaftspreis
-
•
C. H. Ziener. Frequency distribution in a vascular network, Young Investigator Award der ESMRMB, zweiter Preis, Basel (2005).
Vorträge
-
1.
C. H. Ziener, W. R. Bauer, and P. M. Jakob. Frequency distribution in a vascular network, ESMRMB, Vortrag 148 (Basel 2005).
-
2.
C. H. Ziener, W. R. Bauer, P. M. Jakob. Skalierungsgesetze für transversale Relaxationszeiten, 8. Jahrestreffen der Deutschen Sektion der ISMRM (Münster 2005).
-
3.
C. H. Ziener, T. Kampf, G. Melkus, W. R. Bauer, and P. M. Jakob. SSFP signal analysis, ESMRMB, Vortrag 42 (Warschau 2006).
-
4.
C. H. Ziener, T. Kampf, G. Melkus, W. R. Bauer, P. M. Jakob. Diffusionsabhängige Frequenzverteilungen, 9. Jahrestreffen der Deutschen Sektion der ISMRM (Jena 2006).
-
5.
C. H. Ziener, T. Weber, W. R. Bauer, and P. M. Jakob. Quantification of the Spinal Cord Axon Diameter using an Extension of the PGSE Sequence, Proc. Int. Soc. Magn. Reson. Med. 2007:2290 (Berlin 2007).
-
6.
C. H. Ziener, T. Kampf, W. R. Bauer, and P. M. Jakob. Magnetic resonance imaging of magnetically labelled cells, Fellows Meeting 2007 der Ernst-Schering-Foundation (Berlin 2007).
Eingeladener Vortrag
-
•
C. H. Ziener. From Microscopic Field Inhomogeneities to a Macroscopic MR-Signal, Bayer Schering Pharma Symposium „Keeping Track of Innovation“ anlässlich des Joint Annual Meeting ISMRM-ESMRMB (Berlin 2007).
Poster
-
1.
C. H. Ziener, W. R. Bauer, P. M. Jakob. Relaxationsverhalten magnetisch markierter Zellen, 7. Jahrestreffen der Deutschen Sektion der ISMRM (Mainz 2004).
-
2.
C. H. Ziener, W. R. Bauer, and P. M. Jakob. Transverse Relaxation of Cells Labeled with Magnetic Nanoparticles, Proc. Int. Soc. Magn. Reson. Med. 2005:2611 (Miami 2005).
-
3.
C. H. Ziener, T. Kampf, G. Melkus, R. Kharrazian, M. Choli, W. R. Bauer, C. Faber, P. M. Jakob. SSFP Signal Formed by a Lorentzian Frequency Distribution, International Symposium on Biomedical Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy at Very High Fields, Poster 14 (Würzburg 2006).
-
4.
C. H. Ziener, T. Kampf, S. Glutsch, W. R. Bauer, P. M. Jakob, F. Bechstedt. Quantum Beates in Magnetic Semiconductors, 17th International Conference on High Magnetic Fields in Semiconductor Physics (HMF), Poster HMF (Würzburg 2006).
-
5.
T. Kampf, C. H. Ziener, G. Melkus, A. Purea, M. Parczyk, W. R. Bauer, P. M. Jakob. USPIO-Modelle im Vergleich, 9. Jahrestreffen der Deutschen Sektion der ISMRM (Jena 2006).
-
6.
T. Kampf, C. H. Ziener, P. M. Jakob, W. R. Bauer. Dependence of the frequency distribution on the orientation of the voxel, Molekulare Bildgebung 07, Poster 1 (Kiel 2007).
-
7.
C. H. Ziener, T. Kampf, W. R. Bauer, P. M. Jakob. Diffusion Dependent Frequency Distribution, 9th International Conference on Magnetic Resonance Microscopy, Poster 42 (Aachen 2007).
-
8.
T. Kampf, C. H. Ziener, X. Helluy, P. M. Jakob, W. R. Bauer. Computation of inter and intra voxel diffusion using MC-simulations in frequency and spatial domain: a comparison, 9th International Conference on Magnetic Resonance Microscopy, Poster 34 (Aachen 2007).
-
9.
C. Ziener, V. Herold, G. Klug, M. Parczyk, E. Rommel, P. Jakob, W. R. Bauer. Nichtinvasive in vivo Messung der regionalen Pulswellengeschwindigkeit mittels hochauflösender MRI, 74. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie Herz - und Kreislaufforschung e.V., Poster 1491 (Mannheim 2008).
-
10.
V. Herold, M. Parczyk, C. Ziener, G. Klug, E. Rommel, W. R. Bauer, P. Jakob In vivo Magnetresonanzbildgebung zur Messung der lokalen Pulswellengeschwindigkeit an der Maus bei 17,6 Tesla, 74. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie Herz - und Kreislaufforschung e.V., Poster 841 (Mannheim 2008).
-
11.
C. H. Ziener, V. Herold, M. Parczyk, G. Klug, T. Kampf, E. Rommel, P. Jakob, W. Bauer. In-vivo-Messung der regionalen und lokalen Pulswellengeschwindigkeit in der Aorta der Maus mittels MR-Bildgebung bei 17,6 Tesla, 114. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Poster 245 (Wiesbaden 2008).
-
12.
T. C. Basse-Luesebrink, T. Kampf, C. H. Ziener, G. Klug, W. R. Bauer, P. M. Jakob, and D. Haddad. Evaluation of sensitivity increase by T1 and T2 contrast agents in 19F MRI of PF15C, Proc. Int. Soc. Magn. Reson. Med. 2008:1655 (Toronto 2008).
-
13.
V. Herold, G. Klug, M. Parczyk, C. Ziener, T. Weber, S. Sarkar, W. R. Bauer, E. Rommel, and P. M. Jakob. In vivo measurement of local pulse-wave velocity in mice with MRI at 17.6 T, Proc. Int. Soc. Magn. Reson. Med. 2008:907 (Toronto 2008).
-
14.
C. H. Ziener, T. Kampf, V. Herold, P. M. Jakob, W. R. Bauer and W. Nadler. Temporal correlation function around spheres and cylinders, 9th International Bologna Conference Magnetic Resonance in Porous Media (MRPM9), Poster 101 (Cambridge MA, USA 2008).
Lebenslauf
Persönliche Daten
| Vor- und Zuname | Christian Herbert Ziener |
| Geburtsdatum | 18.12.1978 |
| Geburtsort | Weimar |
| Staatsangehörigkeit | deutsch |
| Familienstand | ledig |
| Adresse | dienstlich: privat: |
| Experimentelle Physik 5 Straubmühlweg SWH2 | |
| Am Hubland Zimmer 211 | |
| 97074 Würzburg 97078 Würzburg | |
| Telefon | 0931-888 4957 0931-203 88262 |
| ziener@physik.uni-wuerzburg.de |
Werdegang
| 1985-1991 | Polytechnische Oberschule „Friedrich Leßner“ in Blankenhain |
| 1991-1993 | Geschwister-Scholl-Gymnasium in Bad Berka |
| 1993-1997 | Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena, Spezialschule mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung, Abschluss: Abitur, Durchschnittsnote: 1,1; Internat der Spezialschule in Jena |
| 1997-1998 | Wehrdienst bei der Bundeswehr in Eschweiler und in Gotha |
| 1998-2003 | Studium der Physik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, Diplomarbeit am Institut für Festkörpertheorie und Theoretische Optik. Abschluss: Diplomphysiker, Durchschnittsnote: 1,0 (mit Auszeichnung), Nebenfach: Funktionalanalysis |
| seit 2004 | Promotionsstudium am Lehrstuhl für Experimentelle Physik 5 der Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| seit WS 2004 | Studium der Humanmedizin an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| 2005 -2006 | Stipendiat der Schering-Stiftung |
| 08/2006 | Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung, Durchschnittsnote: 1,5 (sehr gut), Wahlpflichtfach: Magnetresonanzverfahren in der kardiologischen Grundlagenforschung und in klinischer Anwendung |
| seit 2007 | Stipendiat des Berufsverbandes Deutscher Internisten |
Würzburg, 04. September 2008
Christian H. Ziener
Eidesstattliche Versicherung
gemäß §5 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 Satz 2 der Promotionsordnung der Fakultät für Physik und Astronomie der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich, Christian Herbert Ziener, geboren am 18.12.1978 in Weimar, die Dissertation selbständig angefertigt habe. Ich habe keine anderen Hilfsmittel als die in der Arbeit angegebenen benutzt. Alle Ausführungen, die wörtlich oder sinngemäß übernommen wurden, sind als solche gekennzeichnet. Die Dissertation wurde bisher weder vollständig noch teilweise einer anderen Hochschule mit dem Ziel, einen akademischen Grad zu erwerben, vorgelegt.
Am 24. 09. 2003 wurde mir von der Friedrich-Schiller-Universität Jena der akademische Grad „Diplomphysiker“ verliehen. Weitere akademische Grade habe ich weder erworben, noch versucht zu erwerben. Mir wurde kein akademischer Grad entzogen. Es wurde kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder ein Disziplinarverfahren gegen mich eingeleitet.
Am 31. 08. 2006 habe ich den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung bestanden. Den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung werde ich voraussichtlich im Jahre 2010 absolvieren.
Würzburg, 04. September 2008
Christian H. Ziener